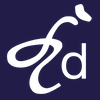[071] An Ulrike v. Kleist, 13. März 1803
nach Handschrift.
Die textkritische Fassung Handschrift zeigt die diplomatische, nicht emendierte Wiedergabe der Handschrift. Der originale Zeilenfall ist beibehalten. Die Fassung wird auf Smartphones wegen der Zeilenlänge nicht angezeigt.
In der Fassung Konstituierter Text ohne originalen Zeilenfall wird der Zeilenfall mit einem Schrägstrich / angezeigt, die Zeile wird aber nicht umbrochen. Alle Emendationen sind ausgeführt und im Anhang einzeln verzeichnet. Ansonsten fusst die Fassung auf dem konstituierten Text der textkritischen Fassung der Handschrift.
In der Fassung Konstituierter Text ohne langes ſ ist das lange ſ durch s ersetzt. Ansonsten fusst die Fassung auf dem konstituierten Text der textkritischen Fassung der Handschrift.
[1] [BKA IV/2 244] [DKV IV 312] [SE:1993 II 729] [Heimböckel:1999 (Reclam) 321] [MA II 810] Leipzig, d. 13t 13t (und 14t) 13t und 14. März, 1803.
Ich habe deinen]Deinen Brief vom 18t Febr. empfangen, u. und und eile ihn zu beantworten. — Vielen Dank für alle deine guten Nachrichten. Wie mag doch das kleine Ding ausſehen, das Guſtel gebohren hat? Ich denke, wie die Mäuſe, die man aus Apfelkernen ſchneidet. —
Merkels unbekannter Correspondent bin ich nicht. —
Du biſt doch immer noch die alte reiſeluſtige Ulrike! Die Mara hat anderthalb Meilen von mir geſungen (in Weimar) u. und wahrhaftig, ſie hätte in dem Kruge zu Osmanſtädt ſingen können; es iſt noch die Frage, ob ich mich gerührt hätte. Aber der Himmel behüte mich, dir]Dir dieſe Reiſeluſtigkeit zu beſpötteln. Denn das wäre, als ob Einer, der mit ſinkenden Kräften gegen [MA II 811] einen Fluß kämpfte, die Leute, die auf ſein Schreien ans Ufer ſtürzten, der Neugierde zeihen wollte. —
Das Verzeichniß]Verzeichnis der Sachen, die ich bei Carl Zenge zurückließ, kann ich nicht geben. —
Und dich]Dich begleitet auf allen Schritten Freude auf meinen [DKV IV 313] nächſten Brief? O du Vortreffliche! Und o du Unglückliche! Wann werde ich den Brief ſchreiben, der dir]Dir ſo viele Freude macht, als ich dir]Dir ſchuldig bin? —
—————
Ich weiß nicht, was ich dir]Dir über mich unausſprechlichen Men[SE:1993 II 730] ſchen ſagen ſoll. — Ich wollte ich könnte mir das Herz aus dem Leibe reißen, in dieſen Brief packen, und dir]Dir zuſchicken. — Dummer Gedanke!
Kurz, ich habe Osmanſtädt]Oßmannstedt wieder verlaſſen. Zürne nicht! Ich mußte fort, u. und ]und kann dir]Dir nicht ſagen, warum? Ich habe das Haus mit Thränen]Tränen verlaſſen, wo ich mehr Liebe gefunden habe, als die ganze Welt zuſammen aufbringen kann; außer du! — ! Aber ich mußte fort! O Himmel, was iſt das für eine Welt!
[Heimböckel:1999 (Reclam) 322]Ich brachte die erſten folgenden Tage in einem Wirthshauſe zu Weimar zu, u. und ]und wußte gar nicht, wohin ich mich wenden ſollte. Es waren recht traurige Tage! Und ich hatte eine recht große Sehnſucht nach dir, o du]Du meine Freundinn!
Endlich entſchloß ich mich nach Leipzig zu gehen. Ich weiß wahrhaftig kaum anzugeben, warum? — warum? Kurz, ich bin hier.
—————
[2] [BKA IV/2 247]Ich nehme hier Unterricht in der Declamation]Deklamation bei einem gewiſſen Kerndörffer. Ich lerne meine eigne Tragödie bei ihm declamiren. Sie müßte, gut declamirt, eine beſſere Wirkung thun, als ſchlecht vorgeſtellt. Sie würde mit vollkommner Declamation]Deklamation vorgetragen, eine ganz ungewöhnliche Wirkung thun. Als ich ſie dem alten Wieland mit großem Feuer vorlas, war es mir gelungen, ihn ſo zu entflammen, daß mir, über ſeine innerlichen Bewegungen, vor Freude die Sprache vergieng, u. und ]und ich zu ſeinen Füßen niederſtürzte, ſeine Hände mit heißen Küſſen überſtrömend.
—————
Vorgeſtern faßte ich ein Herz, u. und ]und gieng]ging zu Hindenburg. Da war große Freude. „Nun, wie ſteht’s]stehts in Paris um die Mathema[MA II 812] tik?“ — Eine alberne Antwort von meiner Seite, u. und ]und ein trauriger Blick zur Erde von der ſeinigen. — „So ſind Sie [DKV IV 314] bloß ſo herum-gereiſet? — herum-gereiſet?“ — ]herum gereiset?« — Ja, herum gereiſet. — Er ſchüttelte wehmüthig]wehmütig den Kopf. Endlich erhorchte er von mir, daß ich doch an etwas arbeite. „Woran arbeiten Sie denn? Nun! Kann ich es denn nicht wiſſen? Sie brachten dieſen Winter bei Wieland zu; gewiß! gewiß! gewiß!“ ]gewiß!« — Und nun fiel ich ihm um den Hals, u. und ]und herzte u. und ]und küßte ihn ſo lange, bis er lachend mit mir überein kam: der Menſch müſſe das Talent anbauen, das er in ſich vorherrſchend fühle.
[Heimböckel:1999 (Reclam) 323]Ob ich nicht auch mit Wünſchen ſo fertig werden könnte? Und Huth? Und Hüllmann? & & & & & ]etc. etc. etc. etc. etc.
—————
[SE:1993 II 731]Hindenburg erzählte mir, du]Du Du habeſt von der Gräfinn Gräfin ]Gräfin Genlis einen Ruf als Erzieherinn]Erzieherin in ihr Inſtitut zu Paris erhalten. Was verſtehſt du davon? Ich, nichts.
—————
Wieland hat Osmanſtädt]Oßmannstedt verkauft, u. und ]und zieht auf 1t ]1. Mai nach Weimar. Der 3t ]3. Mai wird zu ſeiner Ehre mit einem großen Feſte gefeiert werden. Ich bin eingeladen; u. und und ]und Alles, was ſüß iſt, lockt mich. Was ſoll ich thun?
[3] [BKA IV/2 248]Wenn ihr]Ihr mich in Ruhe ein Paar]paar Monate bei euch]Euch arbeiten laſſen wolltet, ohne mich mit Angſt, was aus mir werden werde, raſend zu machen, ſo würde ich — ja, ich würde!
—————
Leſet doch einmal im 34]34. oder 36t ]36. Blat]Blatt des Freimüthigen]»Freimüthigen« den Aufſatz: Erſcheinung eines neuen Dichters. Und ich ſchwöre euch, daß ich noch viel mehr von mir weiß, als der alberne Kauz, der Kotzebue. Aber ich muß Zeit haben, Zeit muß ich haben — O ihr]Ihr Erÿnnien Erynnien ]Erinnyen mit eurer]Eurer Liebe!
—————
Frage aber mit Behutſamkeit nach dieſem Blatte, damit der litterariſche]litararische Spürhund, der Merkel, nicht rieche, wer der neue Dichter ſei? Es darf es überhaupt niemand als etwa meine allernächſten Verwandten erfahren; u. und ]und auch unter dieſen nur die verſchwiegenen. — Auch thut]tut mir den Gefallen u. und ]und leſet das Buch nicht. Ich bitte euch]Euch darum. Kurz, thut]tut es nicht. Hört ihr?
[Heimböckel:1999 (Reclam) 324]Und nun küſſe in meinem Namen jeden Finger meiner [DKV IV 315] ewig [MA II 813] verehrungswürdigen Tante! Und, wie ſie, den Orgelpfeifen gleich, ſtehen, küſſe ſie Alle]alle von der Oberſte oberste bis zur Letzten, letzten, der kleinen Maus aus dem Apfelkern geſchnitzt! Ein einziges Wort von euch, und ehe ihrs]Ihrs euch]Euch verſeht, wälze ich mich vor Freud in der Mittelſtube. Adieu! Adieu! Adieu! O du]Du meine Allertheuerſte!
Leipzig, d.]den 14t ]14. März 1803 ]1803 Heinrich.