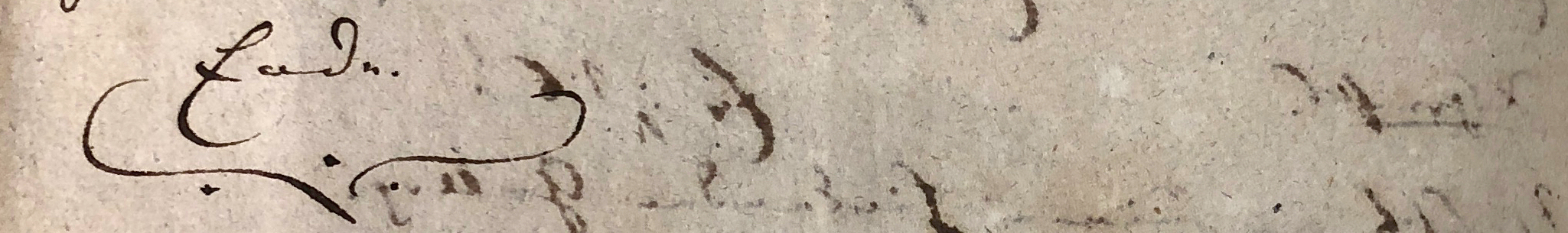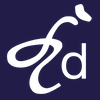Der zerbrochne Krug, ein Lustspiel [Handschrift]
nach Handschrift.
Die textkritische Fassung Handschrift zeigt die diplomatische, nicht emendierte Wiedergabe der Handschrift. Der originale Zeilenfall ist beibehalten. Die Fassung wird auf Smartphones wegen der Zeilenlänge nicht angezeigt.
In der Fassung Konstituierter Text ohne originalen Zeilenfall wird der Zeilenfall mit einem Schrägstrich / angezeigt, die Zeile wird aber nicht umbrochen. Alle Emendationen sind ausgeführt und im Anhang einzeln verzeichnet. Ansonsten fusst die Fassung auf dem konstituierten Text der textkritischen Fassung der Handschrift.
In der Fassung Konstituierter Text ohne langes ſ ist das lange ſ durch s ersetzt. Ansonsten fusst die Fassung auf dem konstituierten Text der textkritischen Fassung der Handschrift.
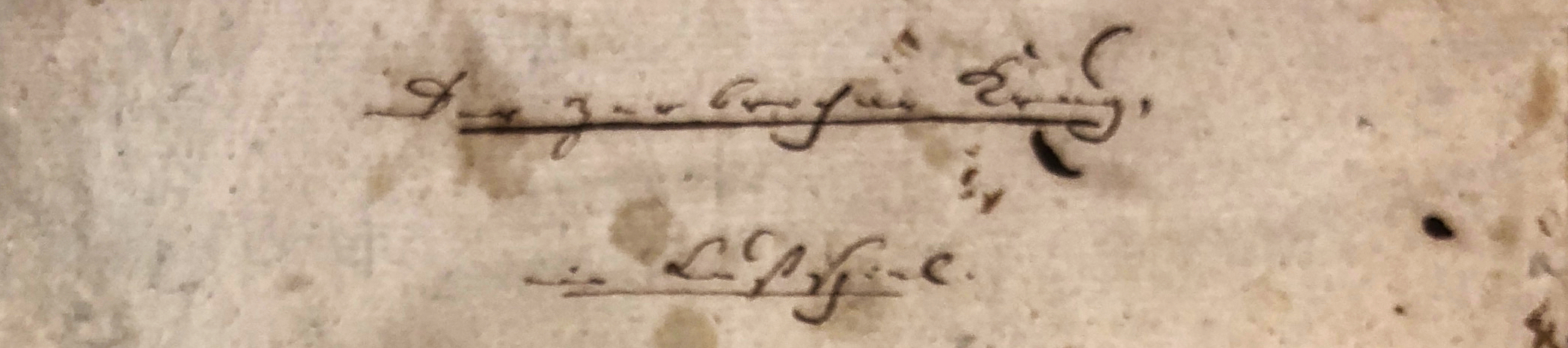
ein Luſtſpiel,
[Leerseite]
Vorrede.
Dieſem Luſtſpiel liegt wahrſcheinlich ein hiſto⸗
riſches
Factum, worüber ich jedoch keine nähere Aus⸗
kunft habe
auffinden können, zum Grunde. Ich nahm
die Veranlaſſung
dazu aus einem Kupferſtich, den ich
vor mehreren Jahren
in der Schweiz ſah. Man bemerkteIm Autograph ist das abschließende ›e‹
in ›bemerkte‹ nicht mehr erkennbar. Der gesamte rechte
Blattrand ist etwas verblasst, wesentlich durch Verschleiß
und Alterung. Im Faksimile-Druck von 1941 sind dagegen die
Buchstaben am rechten Rand noch deutlich
lesbar.
darauf — zuerſt einen Richter, der
gravitätiſch auf dem
Richterſtuhl ſaß: vor ihm ſtand eine
alte Frau, die
einen zerbrochenen Krug hielt, ſie ſchien
das Unrecht,
das ihm widerfahren war, zu demonſtriren:
Beklagter,
ein junger Bauerkerl, den der Richter, als
überwieſen,
andonnerte, vertheidigte ſich noch, aber
ſchwach: ein
Mädchen, das wahrſcheinlich in dieſer Sache
gezeugt hatte
(denn wer weiß, bei welcher Gelegenheit das
Delictum
geſchehen war) ſpielte ſich, in der Mitte
zwiſchen Mutter
und Bräutigam, an der Schürze; wer ein
falſches
Zeugniß abgelegt hätte, könnte nicht
zerknirſchter daſtehn:
und der Gerichtsſchreiber ſah (er hatte vielleicht kurz
vorher das Mädchen angeſehen) jetzt den Richter
mistrau⸗
iſch zur Seite an, wie Kreon, bei
einer ähnlichen Gele⸗
genheit, den Ödip
.
,
als die Frage war, wer den
Lajus erſchlagen?
.
Darunter ſtand: der
zerbrochene
Krug. — Das Original war, wenn ich
nicht irre, von
einem niederländiſchen Meiſter.
Perſonen.
+ Walter, Gerichtsrath. Adam, Dorfrichter. Licht, Schreiber. Frau Marthe Rull. + Eve, ihre Tochter. + Veit Tümpel, ein Bauer. Ruprecht, ſein Sohn. Frau Brigitte. + Ein Bedienter., Büttel, Mägde &.Die Handlung ſpielt in einem niederländiſchen
Dorfe bei Utrecht.
Scene: die Gerichtsſtube
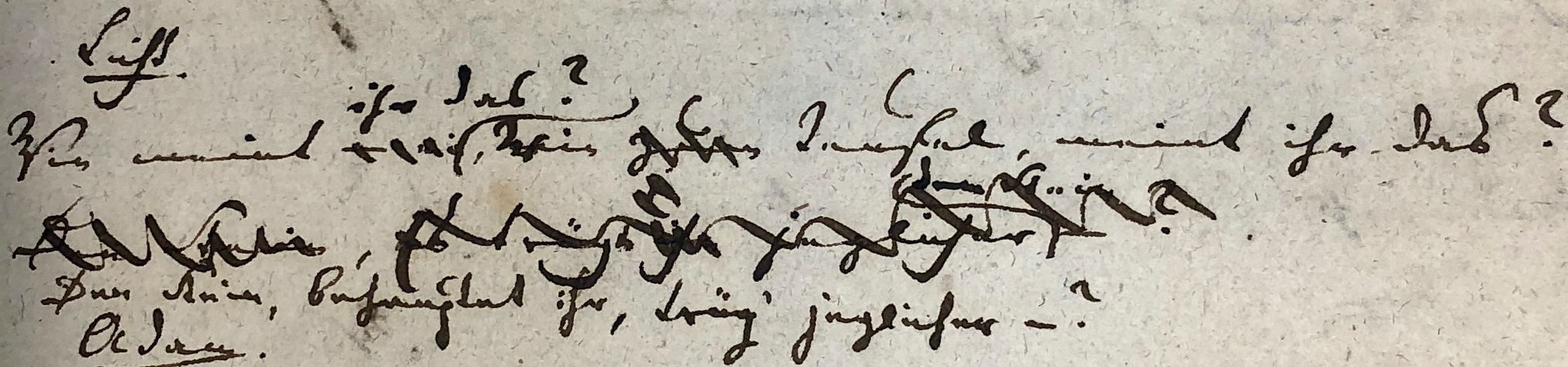 Wie meint — ei,
ihr das?
w
Wie zum Teufel, meint ihr das?
Die BKA ordnet
die Korrekturen in Vers (7-1) und 7 der
Phöbus-Überarbeitung zu. Dem ist zuzustimmen für die
Einfügung: ›Den Stein, behauptet ihr, trüg’ jeglicher —?‹.
Alle anderen Korrekturen wurden dagegen mit hoher
Wahrscheinlichkeit schon in 1806 ausgeführt. Dies läßt
sich u. a. an deren noch stark geneigter Schriftlage
deutlich erkennen, z. B. im Vergleich von ›ihr‹ (Vers 7-1)
und ›ihr‹ in Vers 7, ebenso an mehreren Stellen in den
Grundstrichen der Buchstaben ›S‹ und ›t‹.
Wie meint —
ei,
wie zum Teufel, meint ihr das?
Wie meint ihr
das?
Wie Teufel, meint ihr das?
Wie meint ihr das? Wie
Teufel, meint ihr das?
[ ]
Den Stein,
eEs trüg’ed
ihn jeglicher den Stein
—?
Den
Stein, behauptet ihr, trüg’ jeglicher
—?
Den Stein,
es trüg’
ihn jeglicher —?
Es trüge
d
jeglicher —?
Es trüge jeglicher den
Stein —?
Den Stein,
behauptet ihr, trüg’ jeglicher —?
Den Stein, behauptet ihr,
trüg jeglicher — ?
Nein, ſagt mir, Freund!
Den Stein truͤg’ jeglicher —?
Adam.
Zum Fallen, ja, in ſich.
Zum Fallen, ja, in
ſich.
Ja, in ſich ſelbſt!
Licht
/: ihn ſcharf
in’s Auge faſſend :/
Verflucht das!
Adam.
Was?
Was?
Was beliebt?
Licht.
Ihr ſtam̄t von einem
lockern
lockern
Ältervater,
Der ſo beim Anbeginn der Dinge fiel,
Und wegen ſeines Falls berühmt geworden;
Ihr ſeid doch nicht —?
Jetzt wäret ihr
—?
Ihr ſeid doch
nicht —?
Jetzt wäret ihr —?
Jetzt wär’t ihr —?
Ihr ſeid doch nicht
—?
Adam.
Was?
Was?
Nun?
Licht.
Gleichfalls —?
6.
Adam.
Ob ich —? Ich
glaube —!
Ob ich —? Ich glaube
—?
Hier bin ich hingefallen, ſag’ ich euch.
Licht.
Unbildlich hingeſchlagen?
Adam.
Ja, unbildlich.
Es mag ein ſchlechtes Bild geweſen ſein.
Licht.
Wie meint — ei,
ihr das?
w
Wie zum Teufel, meint ihr das?
Die BKA ordnet
die Korrekturen in Vers (7-1) und 7 der
Phöbus-Überarbeitung zu. Dem ist zuzustimmen für die
Einfügung: ›Den Stein, behauptet ihr, trüg’ jeglicher —?‹.
Alle anderen Korrekturen wurden dagegen mit hoher
Wahrscheinlichkeit schon in 1806 ausgeführt. Dies läßt
sich u. a. an deren noch stark geneigter Schriftlage
deutlich erkennen, z. B. im Vergleich von ›ihr‹ (Vers 7-1)
und ›ihr‹ in Vers 7, ebenso an mehreren Stellen in den
Grundstrichen der Buchstaben ›S‹ und ›t‹.
Wie meint —
ei,
wie zum Teufel, meint ihr das?
Wie meint ihr
das?
Wie Teufel, meint ihr das?
Wie meint ihr das? Wie
Teufel, meint ihr das?
[ ]
Den Stein,
eEs trüg’ed
ihn jeglicher den Stein
—?
Den
Stein, behauptet ihr, trüg’ jeglicher
—?
Den Stein,
es trüg’
ihn jeglicher —?
Es trüge
d
jeglicher —?
Es trüge jeglicher den
Stein —?
Den Stein,
behauptet ihr, trüg’ jeglicher —?
Den Stein, behauptet ihr,
trüg jeglicher — ?
Nein, ſagt mir, Freund!
Den Stein truͤg’ jeglicher —?
Adam.
Zum Fallen, ja, in ſich.
Zum Fallen, ja, in
ſich.
Ja, in ſich ſelbſt!
Licht
/: ihn ſcharf
in’s Auge faſſend :/
Verflucht das!
Adam.
Was?
Was?
Was beliebt?
Licht.
Ihr ſtam̄t von einem
lockern
lockern
Ältervater,
Der ſo beim Anbeginn der Dinge fiel,
Und wegen ſeines Falls berühmt geworden;
Ihr ſeid doch nicht —?
Jetzt wäret ihr
—?
Ihr ſeid doch
nicht —?
Jetzt wäret ihr —?
Jetzt wär’t ihr —?
Ihr ſeid doch nicht
—?
Adam.
Was?
Was?
Nun?
Licht.
Gleichfalls —?
6.
Adam.
Ob ich —? Ich
glaube —!
Ob ich —? Ich glaube
—?
Hier bin ich hingefallen, ſag’ ich euch.
Licht.
Unbildlich hingeſchlagen?
Adam.
Ja, unbildlich.
Es mag ein ſchlechtes Bild geweſen ſein.
Licht.
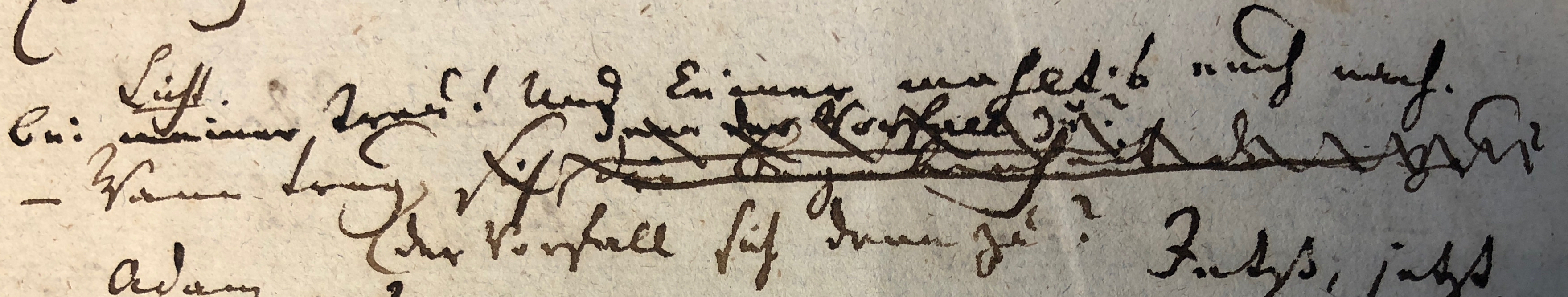 Bei meiner Treu! Und keiner
mahlt’s euch nach.
[ ]
Bei
meiner Treu! Und keiner mahlt’s euch
nach.
Bei meiner Treu! Und
keiner malt’s euch nach.
[ ]
— Wann trug
ſich
die Begebenheit denn zu?
denn der Vorfall zu?
[Streichung nicht
transkribiert.]
der Vorfall ſich denn
zu?
— Wann trug ſich
die Begebenheit denn zu?
— Wann trug ſich
denn der Vorfall
zu?
— Wann trug der Vorfall ſich denn zu?
— Wann trug der Vorfall
ſich denn zu?
— Wann trug ſich die
Begebenheit denn zu?
Adam
Bei meiner Treu! Und keiner
mahlt’s euch nach.
[ ]
Bei
meiner Treu! Und keiner mahlt’s euch
nach.
Bei meiner Treu! Und
keiner malt’s euch nach.
[ ]
— Wann trug
ſich
die Begebenheit denn zu?
denn der Vorfall zu?
[Streichung nicht
transkribiert.]
der Vorfall ſich denn
zu?
— Wann trug ſich
die Begebenheit denn zu?
— Wann trug ſich
denn der Vorfall
zu?
— Wann trug der Vorfall ſich denn zu?
— Wann trug der Vorfall
ſich denn zu?
— Wann trug ſich die
Begebenheit denn zu?
Adam
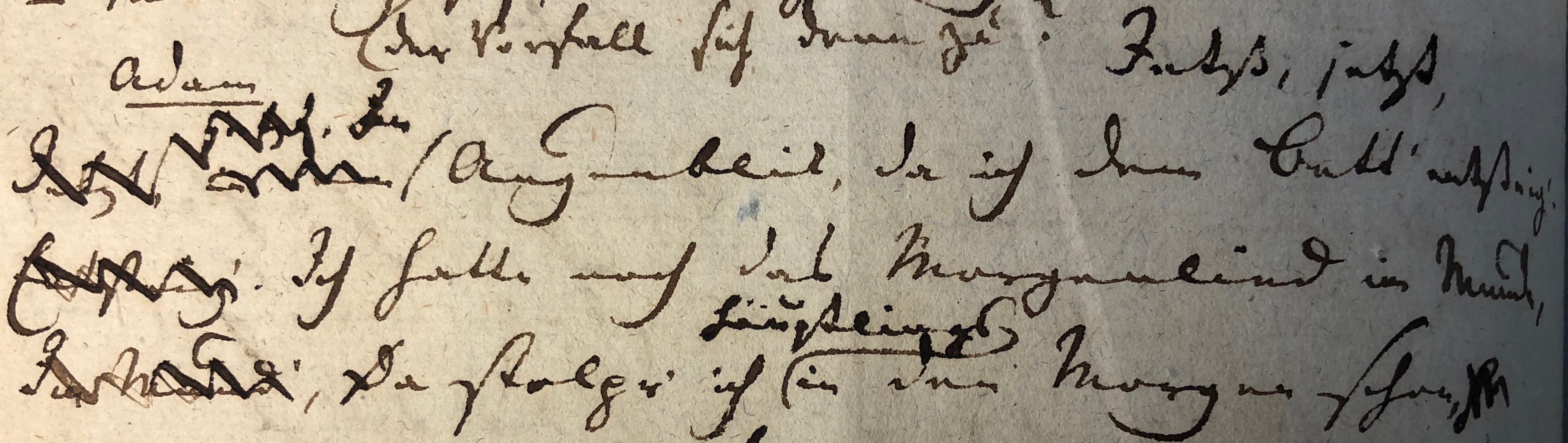 Jetzt,
jetzt,
Kleist
hat die Verse 16 bis 19 für den Phöbus 1808 überarbeitet.
Die Korrekturen dieser Verse sind im Zusammenhang (jeweils
ɑ bzw. β) zu lesen, da sie sich teilweise wechselseitig
bedingen.
[ ]
Jetzt, jetzt,
Jetzt, jetzt,
[ ]
Jetzt,jetzt, iIm
in dem Augenblick, da ich
dem Bett’ entſteig’.
Jetzt, in
dem Augenblick, da ich dem Bett’
Jetzt, jetzt,
im Augenblick, da ich dem Bett’
Im Augenblick, da
ich dem Bett’ entſteig’.
Im Augenblick, da ich dem
Bett’ entſteig’.
Jetzt, in dem Augenblick,
da ich dem Bett’
Entſteig’. Ich hatte noch das Morgenlied
im
Munde,
Entſteig’.
Ich hatte noch das Morgenlied
Ich hatte noch das
Morgenlied im Munde,
Ich hatte noch das
Morgenlied im Munde,
Entſteig’. Ich hatte noch
das Morgenlied
Im
Mund’,
dDa ſtolpr’ ich häuptlings in den Morgen ſchon, häKleist hat am
Zeilenende zwei Buchstaben gestrichen. Eindeutig
lesbar ist ein ›h‹, danach ein punktierter
Buchstabe, möglicherweise ein begonnenes ›ä‹. Dies
könnte bedeuten, dass Kleist das im Vers
eingefügte ›häuptlings‹ zunächst ans Versende
setzen wollte (Vers-Variante b). BKA liest ›hi‹.
Bei dieser Lesart entfällt Variante
b.
Im Mund’,
da ſtolpr’ ich in den Morgen ſchon,
Da ſtolpr’ ich in den
Morgen ſchon, hä
Da ſtolpr’ ich
häuptlings in den Morgen ſchon,
Da stolpr’ ich häuptlings
in den Morgen schon,
Im Mund’, da ſtolpr’ ich
in den Morgen ſchon,
Und eh’ ich noch den Lauf des Tags
beginne,
Renkt unſer Herrgott mir den Fuß ſchon aus.
Renkt mir der Kuckuck
hier den Fuſs schon aus.
Renkt unſer Herrgott mir
den Fuß ſchon aus.
Licht
Und wohl
den Linken obenein noch?
Und wohl den Linken
obenein noch?
Und wohl den linken
obenein?
Adam
Was?
Was?
Den linken?
Licht.
Hier, den geſetzten?
Fuß, den
würdigen,
Hier, den
geſetzten?
Hier, den geſetzten
Fuß, den würdigen,
Hier, den gesetzten Fuſs,
den würdigen,
Hier, den geſetzten?
Der ohnhin ſchwer den Weg der
Sünde wandelt?
[ ]
Der ohnhin
ſchwer den Weg der Sünde wandelt?
Der ohnhin schwer den
Weg der Sünde wandelt?
[ ]
Adam
Dieſen!
Dieſen!
[ ]
Freilich!
Licht.
Allgerechter!
Allgerechter!
[ ]
Allgerechter!
Der ohnhin ſchwer den Weg der Sünde
wandelt.
Der ohnhin ſchwer
den Weg der Sünde wandelt.
[ ]
Der ohnhin ſchwer den Weg
der Suͤnde wandelt.
Adam.
Der
Fuß! Was!Ach! Schwer! Warum?
Der Fuß!
Was! Schwer! Warum?
Ach! Schwer!
Warum?
Ach! Schwer! Warum?
Der Fuß! Was! Schwer!
Warum?
Licht.
Der Klumpfuß?
Adam.
Klumpfuß!
Was!
Klumpfuß!
Klumpfuß! Was!
Klumpfuſs! Was?
Klumpfuß!
Ein Fuß iſt, wie der andere, ein Klumpen.
7.
Licht.
Erlaubt! Da
Verzeiht,!
dDa
thut ihr eurem Rechten Unrecht.
Erlaubt!
Da thut ihr eurem Rechten Unrecht.
Verzeiht,
da thut ihr eurem Rechten
Unrecht.
Verzeiht!
Da thut ihr eurem Rechten
Unrecht.
Verzeiht! Da thut ihr
eurem Rechten Unrecht.
Erlaubt! Da thut ihr
eurem rechten Unrecht.
Der Rechte kann ſich dieſer — Wucht nicht
rühmen,
Und wagt ſich eh’r auf’s Schlüpfrige.
Adam.
Ach was!
Die
Ach!
Poſſen!
Ach
was!
Die Poſſen!
Ach! Poſſen!
Ach! Possen!
Ach, was!
Wo ſich der Eine
hinwagt, folgt der Andre. —
Wo ſich der Eine
hinwagt, folgt der Andre.
Wo ſich der Eine
hinwagt, folgt der Andre. —
Wo sich der Eine hinwagt,
folgt der Andre. —
Wo ſich der Eine hinwagt,
folgt der Andre.
Licht.
Und was hat das Geſicht euch ſo verrenkt?
Adam.
Mir das Geſicht?
Licht.
Wie? Davon wißt ihr nichts?
Adam.
Ich müßt’ ein Lügner ſein — wie ſieht’s denn
aus?
Licht.
Wie’s ausſieht?
Adam.
Ja, Gevatterchen.
Licht.
Abſcheulich!
Adam.
Erklärt euch deutlicher.
Licht.
Geſchunden iſt’s,
Ein Gräul zu ſehn. Ein Stück fehlt von der
Wange,
Wie groß? Nicht ohne Waage kann ich’s
ſchätzen.
Adam
Den Teufel auch!
Den Teufel auch.
Den Teufel auch!
Licht.
/:
bringt
hohlt
einen Spiegel :/In E:
›Licht (bringt einen Spiegel).‹
Hier! Überzeuget
So überzeugt
euch ſelbſt.
Hier!
Überzeuget euch ſelbſt.
So überzeugt euch
ſelbſt.
Hier. Überzeugt euch
selbst.
Hier! Ueberzeugt euch
ſelbſt!
Ein Schaaf, das eingehetzt von Hunden
ſich
Ein Schaaf, das,
eingehetzt von Hunden, sich
Ein Schaaf, das,
eingehetzt von Hunden, ſich
Durch Dornen drängt, läßt nicht mehr Wolle
ſitzen,
Als ihr, Gott weiß wo? Fleiſch habt ſitzen
laſſen.
8.
Adam
Hm! Ja! S’iſtInteressant ist Kleists Apostrophierung von ›Es
ist‹, die sich in dieser Form durchgängig in seinen
Dramen-Handschriften findet. Statt das ›E‹ zu
apostrophieren, wie es der Setzer regelgerecht auch in
der Phöbus-Fassung umsetzt, zieht Kleist in seiner
Schreibung ›Es ist‹ zu einem einsilbigen Laut, einem
umgangssprachlichen ›S’ist‹ zusammen. Insofern ist es
auch konsequent, dass er in der Handschrift häufig
keinen Leerschritt einfügt, um die Einsilbigkeit zu
betonen. Dieses wird (zumindest vom Setzer) im
Erstdruck nicht nachvollzogen, sondern hier wird
wieder ein Leerschritt eingefügt: ›S’ iſt‹. Phonetisch
führen alle drei typographischen Lösungen ›S’iſt‹, ›’s
ist‹, ›S’ iſt‹ zum gleichen Laut. wahr.
Unlieblich ſieht es aus.
Hm! Ja: ’s ist wahr.
Unlieblich sieht es aus.
Hm! Ja! S’ iſt wahr.
Unlieblich ſieht es aus.
Die Naſ’ hat auch gelitten.
Licht
Und das Auge.
Adam.
Das Auge nicht, Gevatter.
Licht.
Jetzt,
jetzt,
Kleist
hat die Verse 16 bis 19 für den Phöbus 1808 überarbeitet.
Die Korrekturen dieser Verse sind im Zusammenhang (jeweils
ɑ bzw. β) zu lesen, da sie sich teilweise wechselseitig
bedingen.
[ ]
Jetzt, jetzt,
Jetzt, jetzt,
[ ]
Jetzt,jetzt, iIm
in dem Augenblick, da ich
dem Bett’ entſteig’.
Jetzt, in
dem Augenblick, da ich dem Bett’
Jetzt, jetzt,
im Augenblick, da ich dem Bett’
Im Augenblick, da
ich dem Bett’ entſteig’.
Im Augenblick, da ich dem
Bett’ entſteig’.
Jetzt, in dem Augenblick,
da ich dem Bett’
Entſteig’. Ich hatte noch das Morgenlied
im
Munde,
Entſteig’.
Ich hatte noch das Morgenlied
Ich hatte noch das
Morgenlied im Munde,
Ich hatte noch das
Morgenlied im Munde,
Entſteig’. Ich hatte noch
das Morgenlied
Im
Mund’,
dDa ſtolpr’ ich häuptlings in den Morgen ſchon, häKleist hat am
Zeilenende zwei Buchstaben gestrichen. Eindeutig
lesbar ist ein ›h‹, danach ein punktierter
Buchstabe, möglicherweise ein begonnenes ›ä‹. Dies
könnte bedeuten, dass Kleist das im Vers
eingefügte ›häuptlings‹ zunächst ans Versende
setzen wollte (Vers-Variante b). BKA liest ›hi‹.
Bei dieser Lesart entfällt Variante
b.
Im Mund’,
da ſtolpr’ ich in den Morgen ſchon,
Da ſtolpr’ ich in den
Morgen ſchon, hä
Da ſtolpr’ ich
häuptlings in den Morgen ſchon,
Da stolpr’ ich häuptlings
in den Morgen schon,
Im Mund’, da ſtolpr’ ich
in den Morgen ſchon,
Und eh’ ich noch den Lauf des Tags
beginne,
Renkt unſer Herrgott mir den Fuß ſchon aus.
Renkt mir der Kuckuck
hier den Fuſs schon aus.
Renkt unſer Herrgott mir
den Fuß ſchon aus.
Licht
Und wohl
den Linken obenein noch?
Und wohl den Linken
obenein noch?
Und wohl den linken
obenein?
Adam
Was?
Was?
Den linken?
Licht.
Hier, den geſetzten?
Fuß, den
würdigen,
Hier, den
geſetzten?
Hier, den geſetzten
Fuß, den würdigen,
Hier, den gesetzten Fuſs,
den würdigen,
Hier, den geſetzten?
Der ohnhin ſchwer den Weg der
Sünde wandelt?
[ ]
Der ohnhin
ſchwer den Weg der Sünde wandelt?
Der ohnhin schwer den
Weg der Sünde wandelt?
[ ]
Adam
Dieſen!
Dieſen!
[ ]
Freilich!
Licht.
Allgerechter!
Allgerechter!
[ ]
Allgerechter!
Der ohnhin ſchwer den Weg der Sünde
wandelt.
Der ohnhin ſchwer
den Weg der Sünde wandelt.
[ ]
Der ohnhin ſchwer den Weg
der Suͤnde wandelt.
Adam.
Der
Fuß! Was!Ach! Schwer! Warum?
Der Fuß!
Was! Schwer! Warum?
Ach! Schwer!
Warum?
Ach! Schwer! Warum?
Der Fuß! Was! Schwer!
Warum?
Licht.
Der Klumpfuß?
Adam.
Klumpfuß!
Was!
Klumpfuß!
Klumpfuß! Was!
Klumpfuſs! Was?
Klumpfuß!
Ein Fuß iſt, wie der andere, ein Klumpen.
7.
Licht.
Erlaubt! Da
Verzeiht,!
dDa
thut ihr eurem Rechten Unrecht.
Erlaubt!
Da thut ihr eurem Rechten Unrecht.
Verzeiht,
da thut ihr eurem Rechten
Unrecht.
Verzeiht!
Da thut ihr eurem Rechten
Unrecht.
Verzeiht! Da thut ihr
eurem Rechten Unrecht.
Erlaubt! Da thut ihr
eurem rechten Unrecht.
Der Rechte kann ſich dieſer — Wucht nicht
rühmen,
Und wagt ſich eh’r auf’s Schlüpfrige.
Adam.
Ach was!
Die
Ach!
Poſſen!
Ach
was!
Die Poſſen!
Ach! Poſſen!
Ach! Possen!
Ach, was!
Wo ſich der Eine
hinwagt, folgt der Andre. —
Wo ſich der Eine
hinwagt, folgt der Andre.
Wo ſich der Eine
hinwagt, folgt der Andre. —
Wo sich der Eine hinwagt,
folgt der Andre. —
Wo ſich der Eine hinwagt,
folgt der Andre.
Licht.
Und was hat das Geſicht euch ſo verrenkt?
Adam.
Mir das Geſicht?
Licht.
Wie? Davon wißt ihr nichts?
Adam.
Ich müßt’ ein Lügner ſein — wie ſieht’s denn
aus?
Licht.
Wie’s ausſieht?
Adam.
Ja, Gevatterchen.
Licht.
Abſcheulich!
Adam.
Erklärt euch deutlicher.
Licht.
Geſchunden iſt’s,
Ein Gräul zu ſehn. Ein Stück fehlt von der
Wange,
Wie groß? Nicht ohne Waage kann ich’s
ſchätzen.
Adam
Den Teufel auch!
Den Teufel auch.
Den Teufel auch!
Licht.
/:
bringt
hohlt
einen Spiegel :/In E:
›Licht (bringt einen Spiegel).‹
Hier! Überzeuget
So überzeugt
euch ſelbſt.
Hier!
Überzeuget euch ſelbſt.
So überzeugt euch
ſelbſt.
Hier. Überzeugt euch
selbst.
Hier! Ueberzeugt euch
ſelbſt!
Ein Schaaf, das eingehetzt von Hunden
ſich
Ein Schaaf, das,
eingehetzt von Hunden, sich
Ein Schaaf, das,
eingehetzt von Hunden, ſich
Durch Dornen drängt, läßt nicht mehr Wolle
ſitzen,
Als ihr, Gott weiß wo? Fleiſch habt ſitzen
laſſen.
8.
Adam
Hm! Ja! S’iſtInteressant ist Kleists Apostrophierung von ›Es
ist‹, die sich in dieser Form durchgängig in seinen
Dramen-Handschriften findet. Statt das ›E‹ zu
apostrophieren, wie es der Setzer regelgerecht auch in
der Phöbus-Fassung umsetzt, zieht Kleist in seiner
Schreibung ›Es ist‹ zu einem einsilbigen Laut, einem
umgangssprachlichen ›S’ist‹ zusammen. Insofern ist es
auch konsequent, dass er in der Handschrift häufig
keinen Leerschritt einfügt, um die Einsilbigkeit zu
betonen. Dieses wird (zumindest vom Setzer) im
Erstdruck nicht nachvollzogen, sondern hier wird
wieder ein Leerschritt eingefügt: ›S’ iſt‹. Phonetisch
führen alle drei typographischen Lösungen ›S’iſt‹, ›’s
ist‹, ›S’ iſt‹ zum gleichen Laut. wahr.
Unlieblich ſieht es aus.
Hm! Ja: ’s ist wahr.
Unlieblich sieht es aus.
Hm! Ja! S’ iſt wahr.
Unlieblich ſieht es aus.
Die Naſ’ hat auch gelitten.
Licht
Und das Auge.
Adam.
Das Auge nicht, Gevatter.
Licht.
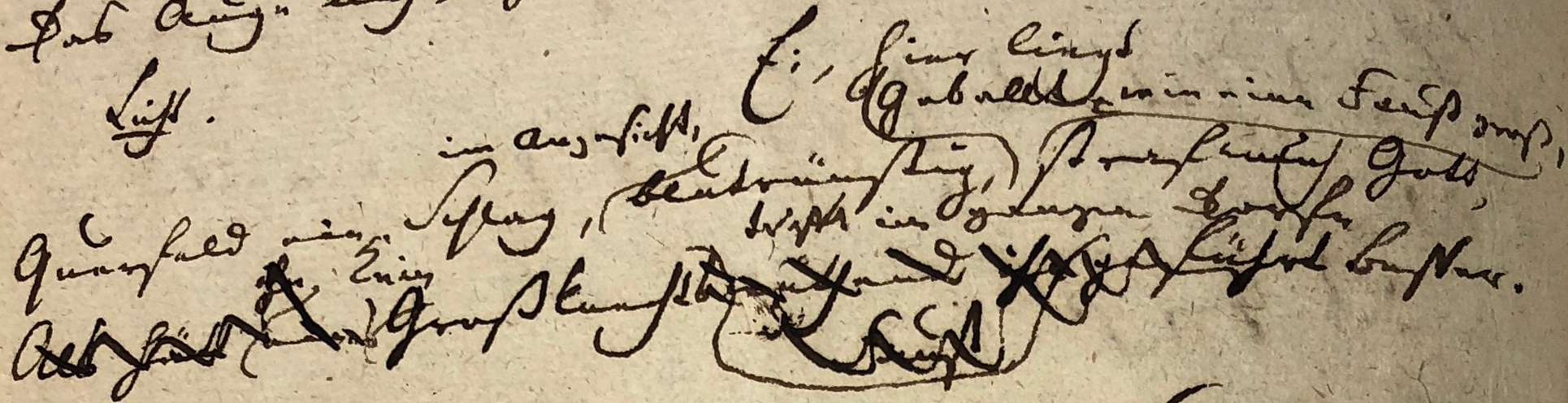 Ei, hier liegt
Querfeld ein Schlag, im
Angeſicht, blutrünſtig, Geballt, wie eine Fauſt groß,
ſtrafe
ſtrafDas an ›straf‹ angehängte e geht nahtlos in
das folgende ›mich‹ über und ist leicht zu
übersehen.
mich Gott,
Querfeld ein
Schlag, blutrünſtig, ſtrafe mich Gott,
Querfeld ein Schlag, im
Angeſicht, blutrünſtig,
Ei, hier liegt
Querfeld ein Schlag, im
Angeſicht, blutrünſtig, Geballt, wie eine Fauſt groß,
ſtrafe
ſtrafDas an ›straf‹ angehängte e geht nahtlos in
das folgende ›mich‹ über und ist leicht zu
übersehen.
mich Gott,
Querfeld ein
Schlag, blutrünſtig, ſtrafe mich Gott,
Querfeld ein Schlag, im
Angeſicht, blutrünſtig,Geballt, wie eine Fauſt groß, ſtrafe mich Gott,In der Phöbusüberarbeitung ändert Kleist die ursprünglichen zwei Verse, die im Erstdruck übernommen werden, in drei modifizierte Verse. Der Teilvers ›ſtrafe mich Gott,‹ wird Teil des folgenden, neu eingefügten Verses. Dass Kleist auch am Ende noch unzufrieden war, zeigt die erneute Korrektur für die Phöbusfassung: ›strafe mich Gott‹ wird geändert in ›hol’s der Henker‹. Querfeld ein Schlag, im Angesicht, blutrünstig,
Geballt, wie eine Faust groſs, hol’s der Henker, Querfeld ein Schlag, blutruͤnſtig, ſtraf mich Gott, Als hätt’ ihn eines Kein Großknechts Fauſtwüthend ihnEs ist nicht eindeutig, ob ›[wüthend ihn]‹ zusammen oder getrennt gestrichen wurde: ›[wüthend] [ihn]‹. geführt. trifft im ganzen Dorfe beſſer. Als hätt’ ein Großknecht wüthend ihn geführt. Als hätt’ ihn ein Großknecht wüthend geführt.Variante b entsteht, wenn ›wüthend ihn‹ nicht in einem Arbeitsgang, sondern getrennt voneinander gestrichen worden ist. Als hätt’ ihn eines Großknechts Fauſt geführt. Kein Großknecht trifft im ganzen Dorfe beſſer. Kein Groſsknecht trifft im ganzen Dorfe besser. Als haͤtt’ ein Großknecht wuͤthend ihn gefuͤhrt. Adam. Das iſt der Augenknochen. — Ja, nun ſeht, Das Alles hatt’ ich nicht einmal geſpürt. Licht. Ja, ja,! ſSo geht’s im Feuer des Gefechtes. Ja, ja, ſo geht’s im Feuer des Gefechtes. Ja, ja! So geht’s im Feuer des Gefechtes. Ja, ja. So geht’s im Feuer des Gefechtes. Ja, ja! So geht’s im Feuer des Gefechts. Adam
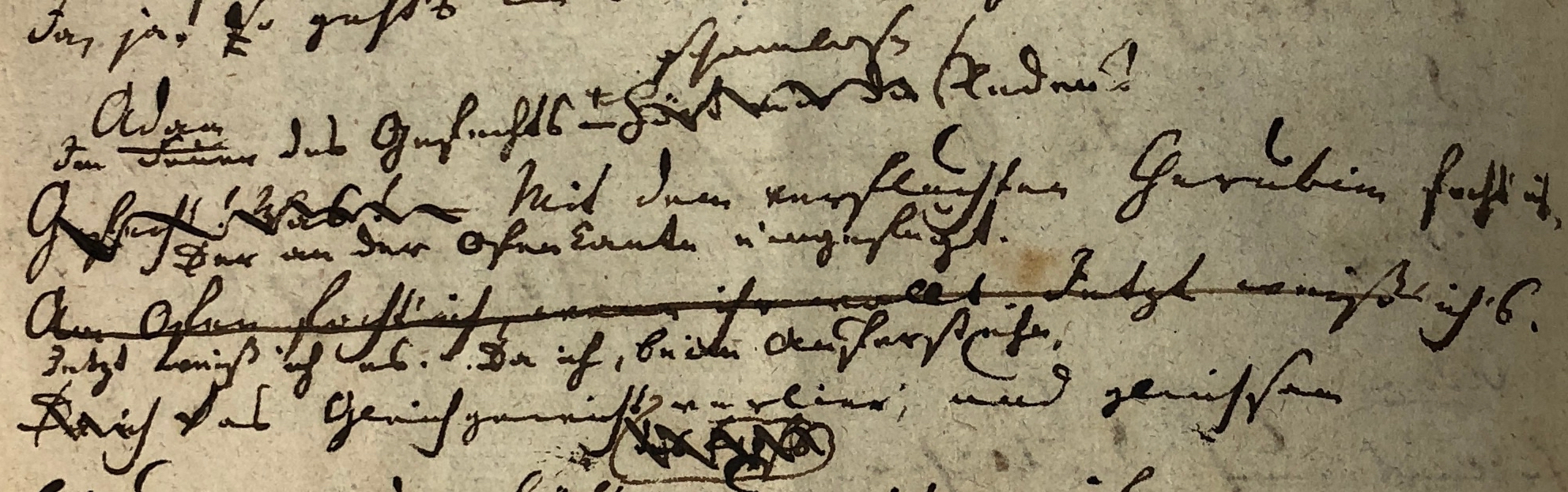 Im Feuer des
Gefechts! —
Hört
mir
nur [vgl. Anm. 50 p]
nur [vgl. Anm. 50
p]
BKA und HAM lesen jeweils ›nur‹,
nicht ›mir‹. Dabei ist der erste Buchstabe
eindeutig als ›m‹ identifizierbar, danach
folgt der typische Abstand, den Kleist vor
der Minuskel ›i‹ einhält und auch selbiges
ist deutlich als ›i‹ und nicht als ›u‹ zu
lesen (zumal ein nach oben offene Bogen über
der Minuskel ›u‹ fehlt). Auch der i-Punkt ist
erkennbar. die Sſchamloſe
Reden!
[ ]
Im Feuer des Gefechts!
Hört mir die Reden!
Im Feuer des
Gefechts!
Schamloſe Reden!
Im Feuer des Gefechts —
ſchamloſe Reden!
Im Feuer des Gefecht’s
— schamlose Reden!
[ ]
Gefecht! Was! — Mit dem
verfluchten Cherubim focht’ ich,
Gefecht! Was!
— Mit dem verfluchten Cherubim
Mit dem verfluchten Cherubim
focht’ ich,
Mit dem verfluchten
Bockgesicht focht’ ich,
Gefecht! Was! — Mit dem
verfluchten Ziegenbock,
Am Ofen focht’ ich, wenn ihr
wollt. Jetzt weiß’ ich’s.
Der an der
Ofenkante eingefugt.
Am Ofen focht’
ich, wenn ihr wollt. Jetzt weiß’ ich’s.Das Versende
›ich’s.‹ ist in Kleists Durchstreichung nicht
enthalten (inhaltlich aber
intendiert).
Der an der Ofenkante
eingefugt.
Der an der Ofenkante
eingefugt.
Am Ofen focht’ ich, wenn
ihr wollt. Jetzt weiß’ ich’s.
Jetzt weiß ich es. Da ich, beim
Auferſtehn,
[ ]
Jetzt weiß ich es. Da
ich, beim Auferſtehn,
Jetzt weiſs ich es. Da
ich, beim Auferstehn,
[ ]
Da ich
dDas Gleichgewicht
des
Kopfs verlier’, und gleichſam
Da ich
das Gleichgewicht verlier’, und
gleichſam
Das Gleichgewicht
des Kopfs verlier’, und
gleichſam
Das Gleichgewicht verlier’,
und gleichſam
Das Gleichgewicht
verlier’ und gleichsam wie
Da ich das Gleichgewicht
verlier, und gleichſam
Ertrunken in den Lüften um mich greife,
Faſſ’ ich — zuerſt die
Hoſen, die ich geſtern Abend
Faſſ’ ich die Hoſen,
die ich geſtern Abend
Faſſ’ ich — zuerſt
die Hoſen, die ich geſtern
Fass’ ich — zuerst die
Hosen, die ich gestern
Faſſ’ ich die Hoſen, die
ich geſtern Abend
Durchnäßt an das Geſtell des Ofens hieng.
Nun faſſ’ ich ſie, verſteht ihr, denke
mich,
Ich Thor, daran zu halten, und nun reißt
Im Feuer des
Gefechts! —
Hört
mir
nur [vgl. Anm. 50 p]
nur [vgl. Anm. 50
p]
BKA und HAM lesen jeweils ›nur‹,
nicht ›mir‹. Dabei ist der erste Buchstabe
eindeutig als ›m‹ identifizierbar, danach
folgt der typische Abstand, den Kleist vor
der Minuskel ›i‹ einhält und auch selbiges
ist deutlich als ›i‹ und nicht als ›u‹ zu
lesen (zumal ein nach oben offene Bogen über
der Minuskel ›u‹ fehlt). Auch der i-Punkt ist
erkennbar. die Sſchamloſe
Reden!
[ ]
Im Feuer des Gefechts!
Hört mir die Reden!
Im Feuer des
Gefechts!
Schamloſe Reden!
Im Feuer des Gefechts —
ſchamloſe Reden!
Im Feuer des Gefecht’s
— schamlose Reden!
[ ]
Gefecht! Was! — Mit dem
verfluchten Cherubim focht’ ich,
Gefecht! Was!
— Mit dem verfluchten Cherubim
Mit dem verfluchten Cherubim
focht’ ich,
Mit dem verfluchten
Bockgesicht focht’ ich,
Gefecht! Was! — Mit dem
verfluchten Ziegenbock,
Am Ofen focht’ ich, wenn ihr
wollt. Jetzt weiß’ ich’s.
Der an der
Ofenkante eingefugt.
Am Ofen focht’
ich, wenn ihr wollt. Jetzt weiß’ ich’s.Das Versende
›ich’s.‹ ist in Kleists Durchstreichung nicht
enthalten (inhaltlich aber
intendiert).
Der an der Ofenkante
eingefugt.
Der an der Ofenkante
eingefugt.
Am Ofen focht’ ich, wenn
ihr wollt. Jetzt weiß’ ich’s.
Jetzt weiß ich es. Da ich, beim
Auferſtehn,
[ ]
Jetzt weiß ich es. Da
ich, beim Auferſtehn,
Jetzt weiſs ich es. Da
ich, beim Auferstehn,
[ ]
Da ich
dDas Gleichgewicht
des
Kopfs verlier’, und gleichſam
Da ich
das Gleichgewicht verlier’, und
gleichſam
Das Gleichgewicht
des Kopfs verlier’, und
gleichſam
Das Gleichgewicht verlier’,
und gleichſam
Das Gleichgewicht
verlier’ und gleichsam wie
Da ich das Gleichgewicht
verlier, und gleichſam
Ertrunken in den Lüften um mich greife,
Faſſ’ ich — zuerſt die
Hoſen, die ich geſtern Abend
Faſſ’ ich die Hoſen,
die ich geſtern Abend
Faſſ’ ich — zuerſt
die Hoſen, die ich geſtern
Fass’ ich — zuerst die
Hosen, die ich gestern
Faſſ’ ich die Hoſen, die
ich geſtern Abend
Durchnäßt an das Geſtell des Ofens hieng.
Nun faſſ’ ich ſie, verſteht ihr, denke
mich,
Ich Thor, daran zu halten, und nun reißt
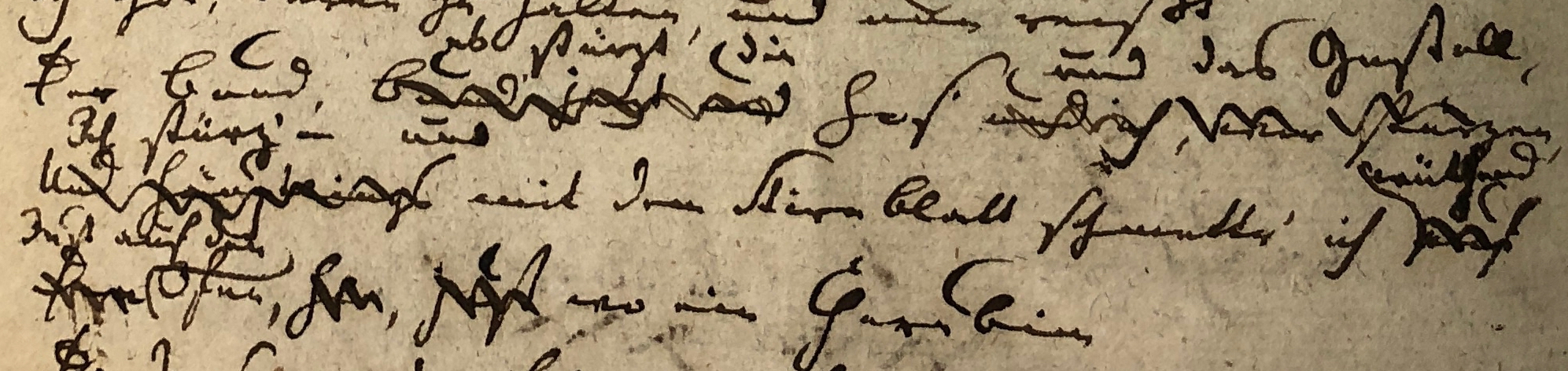 Der Bund, Bund’ jetzt und
es ſtürztBKA
und Hamacher lesen jeweils ›stürzt’‹. Hier
wird jedoch das gelesene Apostroph mit dem
Komma des vorlaufenden Verses hinter ›zu
halten‹ verwechselt und damit doppelt gelesen
als Komma in Vers 57 und als Apostroph in Vers
58. die Hoſ’ und ich, wir ſtürzen,
und das
Geſtell,
Der Bund, Bund’
jetzt und Hoſ’ und ich, wir
ſtürzen,
Der Bund, es ſtürzt
die Hoſ’ und das Geſtell,
Der Bund, es stürzt die
Hos’ und das Gestell,
Der Bund; Bund jetzt und
Hoſ’ und ich, wir ſtuͤrzen,
Und häuptlingsIch ſtürz’ — und mit dem
Stirnblatt ſchmettr’ ich auf
wüthend
Und
häuptlings mit dem Stirnblatt ſchmettr’ ich
auf
Ich ſtürz’ — und
mit dem Stirnblatt ſchmettr’ ich
wüthend
Ich stürz’ — und mit dem
Stirnblatt schmettr’ ich wütheDer Setzer hatte hier
offensichtlich Probleme mit der Überlänge des
Verses. Statt die Wortabstände zu verkleinern,
wurden (in der Eile?) die Buchstaben ›nd‹ einfach
weggelassen.
Und Haͤuptlings mit dem
Stirnblatt ſchmettr’ ich auf
DenJuſt auf den Ofen,
hin, juſt wo ein
Cherubim
Den Ofen
hin, juſt wo ein Cherubim
Juſt auf den
Ofen, wo ein Cherubim
Just auf dem Ofen, wo ein
Ziegenbock
Den Ofen hin, juſt wo ein
ZiegenbockDie Übernahme des
›Ziegenbock‹-Motivs aus der Phöbus-Bearbeitung in
den Erstdruck ist einer der Hinweise, dass die
finale Überarbeitung für den Erstdruck nach der
Überarbeitung für den Phöbus erfolgte.
Die Naſe an der Ecke vorgeſtreckt.
Licht
/: lacht :/
Gut, gut.
Adam
Verdam̄t,!ſag’
ich!
Verdam̄t!
Verdam̄t,
ſag’ ich!
Verdammt, sag ich!
Verdammt!
Licht
Laßt’s gut ſein.
[ ]
Laßt’s gut ſein.
Laſst's gut sein,
Vetter.
[ ]
9.
Adam.
Was?
[ ]
Was?
[ ]
[ ]
Licht.
/: fortlachend
:/
Der Bund, Bund’ jetzt und
es ſtürztBKA
und Hamacher lesen jeweils ›stürzt’‹. Hier
wird jedoch das gelesene Apostroph mit dem
Komma des vorlaufenden Verses hinter ›zu
halten‹ verwechselt und damit doppelt gelesen
als Komma in Vers 57 und als Apostroph in Vers
58. die Hoſ’ und ich, wir ſtürzen,
und das
Geſtell,
Der Bund, Bund’
jetzt und Hoſ’ und ich, wir
ſtürzen,
Der Bund, es ſtürzt
die Hoſ’ und das Geſtell,
Der Bund, es stürzt die
Hos’ und das Gestell,
Der Bund; Bund jetzt und
Hoſ’ und ich, wir ſtuͤrzen,
Und häuptlingsIch ſtürz’ — und mit dem
Stirnblatt ſchmettr’ ich auf
wüthend
Und
häuptlings mit dem Stirnblatt ſchmettr’ ich
auf
Ich ſtürz’ — und
mit dem Stirnblatt ſchmettr’ ich
wüthend
Ich stürz’ — und mit dem
Stirnblatt schmettr’ ich wütheDer Setzer hatte hier
offensichtlich Probleme mit der Überlänge des
Verses. Statt die Wortabstände zu verkleinern,
wurden (in der Eile?) die Buchstaben ›nd‹ einfach
weggelassen.
Und Haͤuptlings mit dem
Stirnblatt ſchmettr’ ich auf
DenJuſt auf den Ofen,
hin, juſt wo ein
Cherubim
Den Ofen
hin, juſt wo ein Cherubim
Juſt auf den
Ofen, wo ein Cherubim
Just auf dem Ofen, wo ein
Ziegenbock
Den Ofen hin, juſt wo ein
ZiegenbockDie Übernahme des
›Ziegenbock‹-Motivs aus der Phöbus-Bearbeitung in
den Erstdruck ist einer der Hinweise, dass die
finale Überarbeitung für den Erstdruck nach der
Überarbeitung für den Phöbus erfolgte.
Die Naſe an der Ecke vorgeſtreckt.
Licht
/: lacht :/
Gut, gut.
Adam
Verdam̄t,!ſag’
ich!
Verdam̄t!
Verdam̄t,
ſag’ ich!
Verdammt, sag ich!
Verdammt!
Licht
Laßt’s gut ſein.
[ ]
Laßt’s gut ſein.
Laſst's gut sein,
Vetter.
[ ]
9.
Adam.
Was?
[ ]
Was?
[ ]
[ ]
Licht.
/: fortlachend
:/
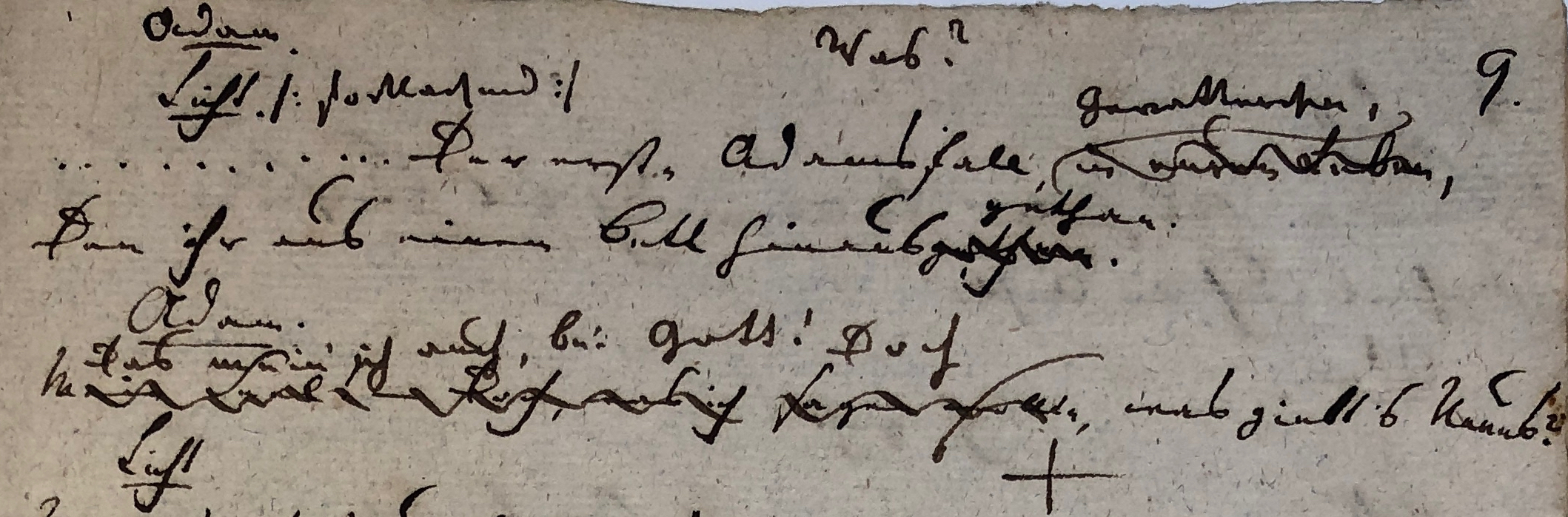 ...........Kleist fügt zur
Auffüllung der Zeile Punkte ein, um zu
signalisieren, dass der ursprüngliche Teilvers
in einen vollständigen geändert
wurde. Der erſte Adamsfall, in
eurem Leben,
Gevatterchen,
Der erſte
Adamsfall,
........... Der
erſte Adamsfall, in eurem
Leben,
........... Der erſte
Adamsfall, Gevatterchen,
[ ]
Der erſte
Adamsfall,
Den ihr aus einem Bett
hinausgethan. gethan.
Den ihr aus einem Bett
hinausgethan.
Den ihr aus einem
Bett hinaus gethan.
[ ]
Den ihr aus einem Bett
hinaus gethan.
Adam.
Mein Seel! — Doch, was ich ſagen
wollte,Das mein’ ich auch, bei Gott! Doch was
giebt’s Neues?
Mein Seel! —
Doch, was ich ſagen wollte, was giebt’s
Neues?
Das mein’ ich auch, bei
Gott! Doch was giebt’s Neues?
Ich muſs es wohl. — Doch
was ich sagen wollte,Für das Phöbus-Fragment
hat Kleist die folgenden Verse einer weiteren
Überarbeitung unterzogen. Sie lauten dort in der
finalen Fassung: ›Was giebt es Neues! | Licht. Ia,
sieh da! hätt’ ich’s | Doch bald vergessen. |
Adam. Nun? | Licht. Macht euch gefaſst, | Auf
unerwarteten Besuch aus Utrecht. | Adam. Nun? Und
von wem? | Licht. Rath Walter kömmt. | Adam
(erschrocken) Wer kömmt? | Licht. Der Herr
Gerichtsrath Walter kömmt aus Utrecht. | Adam. Was
sagt ihr! | U. s. w.‹
Mein Seel! — Doch, was
ich ſagen wollte, was giebts Neues?
Licht
Ja, was es Neues giebt! Der Henker
hohl’s,
Hätt’ ich’s doch bald vergeſſen.
Adam.
Nun?
Licht.
Macht euch bereit auf unerwarteten
Beſuch aus Utrecht.
Adam.
So?
Licht.
Der Herr Gerichtsrath kömt.
Adam.
Wer kömt?
Licht.
Der Herr Gerichtsrath Walter kom̄t, aus Utrecht.
Er iſt in B
Reviſions-Bereiſung auf den Ämtern,
Und heut noch trifft er bei uns ein.
Adam.
Noch heut! Seid ihr bei Troſte?
Noch heut! Seid ihr bei
Troſte?
Noch heut! Seid ihr bei
Troſt?
Noch heut! Seid ihr bei
Troſt?
Licht.
So wahr ich lebe.
Er war in Holla, auf dem Gränzdorf,
geſtern,
Hat das Juſtizamt dort ſchon revidirt,
Hat das Juſtizamt dort
ſchon revidirt,
Hat das Juſtizamt dort
ſchon revidirt.
Ein Bauer ſah zur Fahrt nach Huiſum ſchon
Die Vorſpannpferde vor den Wagen
ſchirren.
Adam.
Heut noch, er, der Gerichtsrath, her, aus
Utrecht!
Zur Reviſion, der wackre Mann, der ſelbſt
Sein Schäfchen ſchiert, dergleichen Fratzen
haßt.
Nach Huiſum kom̄en, und
uns cujoniren!
9.
Licht.
Kam er bis Holla, kom̄t er
auch bis Huiſum.
Nehmt euch in Acht.
Adam.
Ach, geht!
Licht.
Ich ſag’ es euch.
Adam
Geht mir mit eurem Mährchen, ſag’ ich
euch.
Licht.
WeDas gestrichene ›We‹ ist einer der Hinweise, dass
Kleist dieses Manuskript von einer nicht
überlieferten Vorlage abschreibt. Hierbei ist er
versehentlich schon in den folgenden Vers (›Wer
weiß ...‹) gesprungen, korrigiert sich aber
sofort. Der Bauer hat ihn ſelbſt
geſehn, zum Henker.
Adam
Wer weiß, wen der
triefäug’ge Schuft geſehn.
Wer weiß, wen der
triefaͤugige Schuft geſehn.
Die Kerle unterſcheiden ein Geſicht
Von einerm
kahlen Hinterglatze nicht.
Hinterkopf nicht, wenn er
kahl iſt.
Von einer
kahlen Hinterglatze nicht.
Von einem
Hinterkopf nicht, wenn er kahl iſt.
Von einem Hinterkopf
nicht, wenn er kahl iſt.
Setzt einen Huth dreieckig auf mein Rohr,
Hängt ihm den Mantel um, zwei Stiefeln
drunter,
So hält ſo’n Schubiak ihn für wen ihr
wollt.
Licht.
Wohlan, ſo zweifelt fort,
in’s Teufels Namen,
Wohlan ſo zweifelt fort,
ins Teufels Namen,
Bis er zur Thür hier eintrit.
Adam.
Er, eintreten! —
Ohn’ uns ein Wort vorher geſteckt zu
haben.
Licht.
Der Unverſtand! Als ob’s der vorige
Reviſor noch der Rath
Wachholder wäre!
Reviſor noch, der Rath
Wachholder, waͤre!
Es iſt Rath Walter jetzt, der revidirt.
Adam
Wenn gleich, Rath Walter!
Geht, laßt mich zufrieden.
Wenn gleich Rath Walter!
Geht, laßt mich zufrieden.
Der Mann hat ſeinen Amtseid ja
geſchworen,
...........Kleist fügt zur
Auffüllung der Zeile Punkte ein, um zu
signalisieren, dass der ursprüngliche Teilvers
in einen vollständigen geändert
wurde. Der erſte Adamsfall, in
eurem Leben,
Gevatterchen,
Der erſte
Adamsfall,
........... Der
erſte Adamsfall, in eurem
Leben,
........... Der erſte
Adamsfall, Gevatterchen,
[ ]
Der erſte
Adamsfall,
Den ihr aus einem Bett
hinausgethan. gethan.
Den ihr aus einem Bett
hinausgethan.
Den ihr aus einem
Bett hinaus gethan.
[ ]
Den ihr aus einem Bett
hinaus gethan.
Adam.
Mein Seel! — Doch, was ich ſagen
wollte,Das mein’ ich auch, bei Gott! Doch was
giebt’s Neues?
Mein Seel! —
Doch, was ich ſagen wollte, was giebt’s
Neues?
Das mein’ ich auch, bei
Gott! Doch was giebt’s Neues?
Ich muſs es wohl. — Doch
was ich sagen wollte,Für das Phöbus-Fragment
hat Kleist die folgenden Verse einer weiteren
Überarbeitung unterzogen. Sie lauten dort in der
finalen Fassung: ›Was giebt es Neues! | Licht. Ia,
sieh da! hätt’ ich’s | Doch bald vergessen. |
Adam. Nun? | Licht. Macht euch gefaſst, | Auf
unerwarteten Besuch aus Utrecht. | Adam. Nun? Und
von wem? | Licht. Rath Walter kömmt. | Adam
(erschrocken) Wer kömmt? | Licht. Der Herr
Gerichtsrath Walter kömmt aus Utrecht. | Adam. Was
sagt ihr! | U. s. w.‹
Mein Seel! — Doch, was
ich ſagen wollte, was giebts Neues?
Licht
Ja, was es Neues giebt! Der Henker
hohl’s,
Hätt’ ich’s doch bald vergeſſen.
Adam.
Nun?
Licht.
Macht euch bereit auf unerwarteten
Beſuch aus Utrecht.
Adam.
So?
Licht.
Der Herr Gerichtsrath kömt.
Adam.
Wer kömt?
Licht.
Der Herr Gerichtsrath Walter kom̄t, aus Utrecht.
Er iſt in B
Reviſions-Bereiſung auf den Ämtern,
Und heut noch trifft er bei uns ein.
Adam.
Noch heut! Seid ihr bei Troſte?
Noch heut! Seid ihr bei
Troſte?
Noch heut! Seid ihr bei
Troſt?
Noch heut! Seid ihr bei
Troſt?
Licht.
So wahr ich lebe.
Er war in Holla, auf dem Gränzdorf,
geſtern,
Hat das Juſtizamt dort ſchon revidirt,
Hat das Juſtizamt dort
ſchon revidirt,
Hat das Juſtizamt dort
ſchon revidirt.
Ein Bauer ſah zur Fahrt nach Huiſum ſchon
Die Vorſpannpferde vor den Wagen
ſchirren.
Adam.
Heut noch, er, der Gerichtsrath, her, aus
Utrecht!
Zur Reviſion, der wackre Mann, der ſelbſt
Sein Schäfchen ſchiert, dergleichen Fratzen
haßt.
Nach Huiſum kom̄en, und
uns cujoniren!
9.
Licht.
Kam er bis Holla, kom̄t er
auch bis Huiſum.
Nehmt euch in Acht.
Adam.
Ach, geht!
Licht.
Ich ſag’ es euch.
Adam
Geht mir mit eurem Mährchen, ſag’ ich
euch.
Licht.
WeDas gestrichene ›We‹ ist einer der Hinweise, dass
Kleist dieses Manuskript von einer nicht
überlieferten Vorlage abschreibt. Hierbei ist er
versehentlich schon in den folgenden Vers (›Wer
weiß ...‹) gesprungen, korrigiert sich aber
sofort. Der Bauer hat ihn ſelbſt
geſehn, zum Henker.
Adam
Wer weiß, wen der
triefäug’ge Schuft geſehn.
Wer weiß, wen der
triefaͤugige Schuft geſehn.
Die Kerle unterſcheiden ein Geſicht
Von einerm
kahlen Hinterglatze nicht.
Hinterkopf nicht, wenn er
kahl iſt.
Von einer
kahlen Hinterglatze nicht.
Von einem
Hinterkopf nicht, wenn er kahl iſt.
Von einem Hinterkopf
nicht, wenn er kahl iſt.
Setzt einen Huth dreieckig auf mein Rohr,
Hängt ihm den Mantel um, zwei Stiefeln
drunter,
So hält ſo’n Schubiak ihn für wen ihr
wollt.
Licht.
Wohlan, ſo zweifelt fort,
in’s Teufels Namen,
Wohlan ſo zweifelt fort,
ins Teufels Namen,
Bis er zur Thür hier eintrit.
Adam.
Er, eintreten! —
Ohn’ uns ein Wort vorher geſteckt zu
haben.
Licht.
Der Unverſtand! Als ob’s der vorige
Reviſor noch der Rath
Wachholder wäre!
Reviſor noch, der Rath
Wachholder, waͤre!
Es iſt Rath Walter jetzt, der revidirt.
Adam
Wenn gleich, Rath Walter!
Geht, laßt mich zufrieden.
Wenn gleich Rath Walter!
Geht, laßt mich zufrieden.
Der Mann hat ſeinen Amtseid ja
geſchworen,
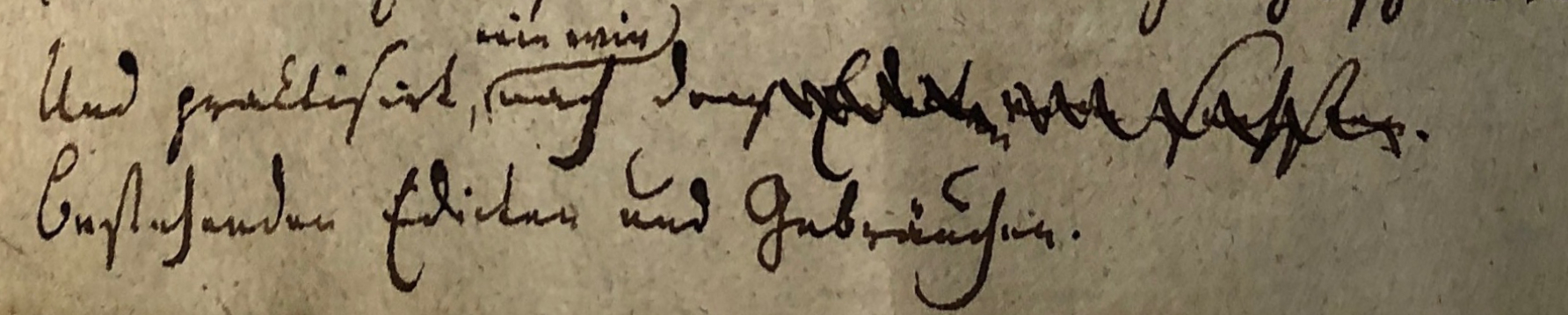 Und praktiſirt,BKA liest Komma hinter
›praktisirt‹ nicht als nachträglich
eingefügt. wie wir nach demn
Edicten
vom ſechſten.
Und praktiſirt nach
dem Edict vom ſechſten.
Und praktiſirt nach
den Edicten.
Und
praktiſirt,
wie wir nach den
Edicten.In Vers 99 ist der
genetische Prozeß nicht eindeutig entscheidbar,
insbesondere wann Kleist die Wörter ›wie wir‹
eingefügt hat. Möglich wäre eine Variante c.
Wahrscheinlicher ist, daß Kleist ›wie wir‹ erst im
Kontext des hinzugefügten Vers 100 eingesetzt hat,
da es Adams tradierte Rechtspraxis unterstreichen
würde. Auch die Schriftmerkmale (u. a. Schriftlage
von Einschub und Vers 100) sprechen dafür. In
diesem Fall würde Variante c entfallen.
Und praktiſirt, wie wir
nach den
Und praktiſirt, wie wir,
nach den
Beſtehenden Edicten und
Gebräuchen.
10.
Licht.
Nun, ich verſichr’ euch, der Gerichtsrath
Walter,
Nun, ich verſichr’
euch, der Gerichtsrath Walter,
Nun, ich verſichr’
euch, der Gerichtsrath Walter
Nun ich verſichr’ euch,
der Gerichtsrath Walter
Erſchien in Holla unvermuthet geſtern,
Viſ’tirte Caſſen und Regiſtraturen,
Und ſuſpendirte Richter dort und
Schreiber,
Warum? ich weiß nicht, ab officio.
Adam.
Den Teufel auch? Hat das der Bauer
geſagt?
Licht.
Dies, und noch mehr —
Adam.
So?
Licht.
Wenn ihr’s wiſſen wollt.
Denn in der Frühe,
heut ſucht man den Richter,
Dem man in ſeinem Hauſ’ Arreſt gegeben,
Und findet hinten in der Scheuer ihn
Am Sparren hoch des Daches aufgehangen.
Licht Adam.
Und praktiſirt,BKA liest Komma hinter
›praktisirt‹ nicht als nachträglich
eingefügt. wie wir nach demn
Edicten
vom ſechſten.
Und praktiſirt nach
dem Edict vom ſechſten.
Und praktiſirt nach
den Edicten.
Und
praktiſirt,
wie wir nach den
Edicten.In Vers 99 ist der
genetische Prozeß nicht eindeutig entscheidbar,
insbesondere wann Kleist die Wörter ›wie wir‹
eingefügt hat. Möglich wäre eine Variante c.
Wahrscheinlicher ist, daß Kleist ›wie wir‹ erst im
Kontext des hinzugefügten Vers 100 eingesetzt hat,
da es Adams tradierte Rechtspraxis unterstreichen
würde. Auch die Schriftmerkmale (u. a. Schriftlage
von Einschub und Vers 100) sprechen dafür. In
diesem Fall würde Variante c entfallen.
Und praktiſirt, wie wir
nach den
Und praktiſirt, wie wir,
nach den
Beſtehenden Edicten und
Gebräuchen.
10.
Licht.
Nun, ich verſichr’ euch, der Gerichtsrath
Walter,
Nun, ich verſichr’
euch, der Gerichtsrath Walter,
Nun, ich verſichr’
euch, der Gerichtsrath Walter
Nun ich verſichr’ euch,
der Gerichtsrath Walter
Erſchien in Holla unvermuthet geſtern,
Viſ’tirte Caſſen und Regiſtraturen,
Und ſuſpendirte Richter dort und
Schreiber,
Warum? ich weiß nicht, ab officio.
Adam.
Den Teufel auch? Hat das der Bauer
geſagt?
Licht.
Dies, und noch mehr —
Adam.
So?
Licht.
Wenn ihr’s wiſſen wollt.
Denn in der Frühe,
heut ſucht man den Richter,
Dem man in ſeinem Hauſ’ Arreſt gegeben,
Und findet hinten in der Scheuer ihn
Am Sparren hoch des Daches aufgehangen.
Licht Adam.
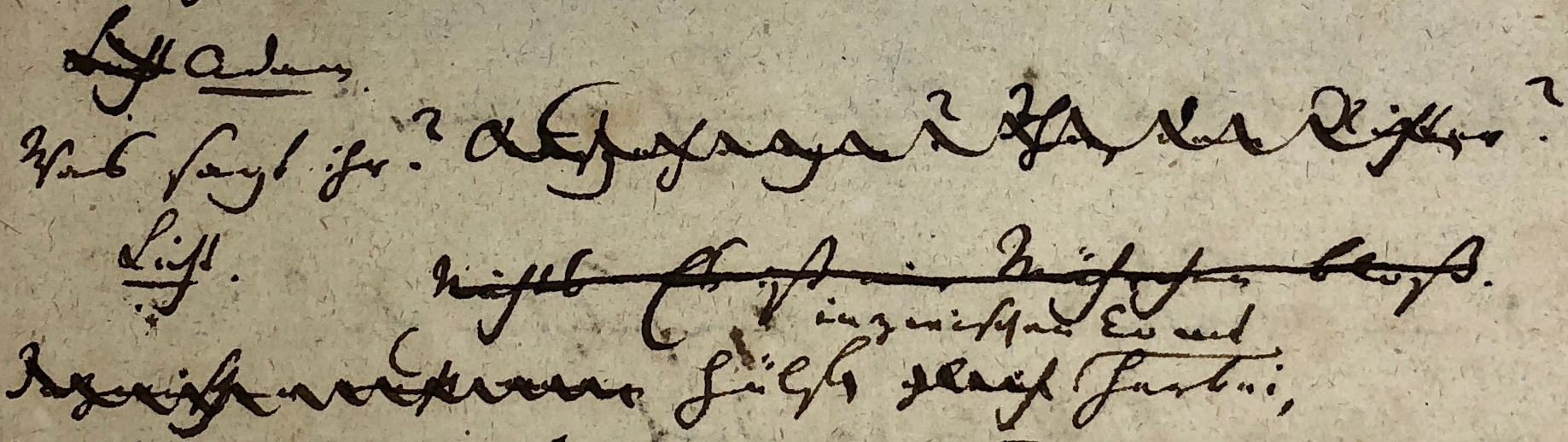 Was ſagt ihr?Kleist kürzt hier in zwei
Korrekturgängen die Verse 112-1 und 112 zu einem
einzigen zusammen. In der Grundschicht
(Textstand ɑ) ist Vers 112-1 als Antilabe
konstruiert, klar erkennbar an der Einrückung von
Lichts Erwiderung ›Nichts …‹. In einer ersten
Änderung löst Kleist die Antilabe auf und ergänzt
Adams ›Was ſagt ihr?‹ zu einem Vollvers (Textstand
β). Lichts Anteil an Vers 112-1 wird vollständig
gestrichen, durch eine gerade Linie. Vers 112
bleibt unverändert. In einem späteren Arbeitsgang
(Textstand ɣ) streicht Kleist die Ergänzung in
112-1 wieder (mit wellenförmiger Linie) und ändert
im gleichen Arbeitsgang Vers 112 (durch zwei
Streichungen und zwei Ergänzungen), so dass mit
den verbleibenden acht Silben wieder eine Antilabe
entsteht. Diese Fassung entspricht auch der
Fassung des Erstdrucks. — Für die Diskussion um
ein Stemma von Kleists Krug ist diese Korrektur
wichtig. Die Herausgeber der BKA wollen zumindest
nicht ausschließen, dass Kleist die Korrekturen in
dieser Handschrift, die sich im Erstdruck
wiederfinden, aus einer anderen Handschrift X
übertragen habe. Der hier vorliegende, zweifache
und zeitlich getrennte Arbeitsvorgang würden der
Annahme einer weiteren Handschrift X
widersprechen, da hier nicht übertragen sondern
Lösungen erst probiert werden (Vgl. auch Zeller,
KJb xxx).
Aufgehangen? Ihn,
den Richter?
Was ſagt ihr?
Was ſagt ihr?
Aufgehangen? Ihn, den
Richter?
Was ſagt ihr?
Was ſagt ihr?
Licht.
Nichts. Es ist ein Mährchen bloß.
Nichts — Es ist ein
Mährchen bloß.
[ ]
[ ]
Inzwiſchen ruft man Hülfe
gleichinzwiſchen komt
herbei,
Inzwiſchen ruft
man Hülfe
gleich herbei,
Hülf
inzwiſchen komt herbei,
Huͤlf’ inzwiſchen kommt
herbei,
Man löſ’t ihn ab, und reibt ihn, und begießt
ihn,
Ins nackte Leben bringt man ihn zurück.
Adam
So? Bringt man ihn?
Licht.
Doch jetzo wird
verſiegelt
Doch jetzo wird
verſiegelt,
In ſeinem Haus, vereidet und
verſchloſſen,
Es iſt, als wär’ er eine
Leiche ſchon,
Es iſt, als waͤr er eine
Leiche ſchon,
Und auch ſein Richteramt iſt ſchon
beerbt.
Adam.
Ei, Henker, ſeht! — Ein liederlicher Hund
war’s —
11.
Sonſt eine ehrliche Haut, ſo wahr ich
lebe,
Ein Kerl, mit dem ſich’s gut zuſam̄en war;
Doch grauſam ſ
liederlich, das muß ich ſagen.
Wenn der Gerichtsrath heut in Holla war,
So gieng’s ihm ſchlecht, dem armen Kauz, das
glaub’ ich.
Licht.
Und dieſer Vorfall einzig, ſprach der
Bauer,
Sei Schuld, daß der Gerichtsrath noch nicht
hier;
Zu Mittag treff’ er doch
unfehlbar ein.
Zu Mittag treff’ er doch
ohnfehlbar ein.
Adam
Zu Mittag, gut, Gevatter.
Jetzt gilt’s Freundſchafft.
Zu Mittag! Gut,
Gevatter! Jetzt gilt’s Freundſchaft.
Ihr wißt, wie ſich zwei Hände waſchen
können.
Ihr wollt auch gern, ich weiß, Dorfrichter
werden,
Und ihr verdient’s, bei Gott, ſo gut wie
Einer.
Doch heut iſt noch nicht die
Gelegenheit,
Heut laßt ihr noch den Kelch
vorübergehn.
Licht
Dorfrichter, ich! Was denkt ihr auch von
mir?
Adam.
Ihr ſeid ein Freund von wohlgeſetzter
Rede,
Und euren Cicero habt ihr ſtudirt
Trotz Einem auf der Schul’ in Amſterdam.
Drückt euren Ehrgeiz heut hinunter, hört’
ihr?
Es werden wohl ſich Fälle noch ergeben,
Wo ihr mit eurer Kunſt euch zeigen
könnt.
Licht
Wir zwei Gevatterleute! Geht mir fort.
Adam
Zu ſeiner Zeit, ihr wißt’s, ſchwieg auch der
große
Demoſthenes. Folgt hierin ſeinem Muſter.
Und bin ich König nicht von Macedonien,
Kann ich auf meine Art doch dankbar
ſein.
12.
Licht.
Geht mir mit eurem Argwohn, ſag’ ich
euch.
Hab’ ich jemals —?
Hab ich jemals —?
Adam.
Seht, ich, ich, für mein Theil,
Dem großen Griechen folg’ ich auch. Es
ließe
Von Depoſitionen ſich und Zinſen
Zuletzt auch eine Rede ausarbeiten:
Wer wollte ſolche Perioden drehn?
Licht.
Nun, alſo!
Adam.
Von ſolchem Vorwurf bin ich
rein,
Der Henker hol’s! Und Alles, was es
gilt,
Ein Schwank iſt’s etwa, der zur Nacht
gebohren,
Des Tags vorwitz’gen Lichtſtrahl ſcheut.
Licht.
Ich weiß.
Adam.
Mein Seel! Es iſt kein Grund, warum ein
Richter,
Wenn er nicht auf dem Richtſtuhl ſitzt,
Soll gravitätiſch, wie ein Eisbär, ſein.
Licht.
Das ſag ich auch.
Adam.
Nun denn, ſo kom̄t, Gevatter.
Folgt mir ein wenig zur
Regiſtratur.
Folgt mir ein wenig zur
Regiſtratur;
Die Actenſtöße ſetz’ ich auf, denn die
Die liegen wie der Thurm zu Babylon.
Ein Bedienter
/: trit auf :/Hier ist
nachträglich, wohl von Kleist selbst, ein Querstrich
eingefügt worden zur Kennzeichnung des Beginns einer
neuen Szene (›Zweiter Auftritt‹ im
Erstdruck).
Der Bediente.
Gott helf, Herr Richter! Der Gerichtsrath
Walter
Läßt ſeinen Gruß vermelden, gleich wird er
hier ſein.
Adam
Ei, du gerechter Him̄el!
Iſt er mit Holla
Schon fertig?
11.
Der Bediente
Ja, er iſt in Huiſum ſchon.
Adam
He! Liſe! Grete!
He! Lieſe! Grete!
Licht.
Ruhig, ruhig jetzt.
Adam.
Gevatterchen!
Licht.
Laßt euren Dank
vermelden.
Laßt euern Dank
vermelden.
Der Bediente.
Und morgen reiſen wir nach Huſſahe.
Adam.
Was
thu
thu’ Das
Apostroph ist auch in einer Vergrößerung
nicht erkennbar, verbirgt sich aber
möglicherweise hinter dem Bogen über der
Minuskel ›u‹. Im Erstdruck ohne
Apostroph.
thu’ Das Apostroph ist auch in
einer Vergrößerung nicht erkennbar, verbirgt
sich aber möglicherweise hinter dem Bogen
über der Minuskel ›u‹.
BKA und Hamacher lesen jeweils ›thu’‹. Das
Apostroph ist auch in einer Vergrößerung nicht
erkennbar, verbirgt sich aber möglicherweise hinter
dem Bogen über der Minuskel ›u‹. Im Erstdruck ohne
Apostroph. ich jetzt? Was laſſ’ ich?
Was thu ich jetzt? Was
laſſ’ ich?
Was thu ich jetzt? Was laß
ich?In E hier eingefügt: ›Er greift nach
ſeinen Kleidern.‹.
Eine Magd
/: trit auf :/
Die Magd
Hier bin ich, Herr.
Licht.
Wollt ihr die Hoſen anziehn? Seid ihr
toll?
Zweite Magd
/: trit auf :/
Zweite Magd
Hier bin ich, Herr Dorfrichter.
Licht.
Nehmt den Rock.
Adam.In E ist
hinter ›Adam.‹ als Regieanweisung noch ›(ſieht ſich
um).‹ hinzugefügt.
Wer? Der Gerichtsrath?
Licht.
Ach, die Magd iſt es.
Adam
Die Bäffchen! Mantel! Kragen!
Die erſte Magd
Erſt die Weſte!
Adam.
Was? — Rock aus! Hurtig!
12.
Licht
/: zum Bedienten :/
Der Herr Gerichtsrath werden
Hier ſehr willkom̄en
ſein. Wir ſind ſogleich
Bereit ihn zu empfangen. Sagt ihm das.
Adam.
Den Teufel auch! Der Richter Adam läßt
ſich
Entſchuldigen.
Licht.
Entſchuldigen!
Adam.
Entſchuld’gen.
Iſt er ſchon unterwegs etwa?
Der Bediente.
Was ſagt ihr?Kleist kürzt hier in zwei
Korrekturgängen die Verse 112-1 und 112 zu einem
einzigen zusammen. In der Grundschicht
(Textstand ɑ) ist Vers 112-1 als Antilabe
konstruiert, klar erkennbar an der Einrückung von
Lichts Erwiderung ›Nichts …‹. In einer ersten
Änderung löst Kleist die Antilabe auf und ergänzt
Adams ›Was ſagt ihr?‹ zu einem Vollvers (Textstand
β). Lichts Anteil an Vers 112-1 wird vollständig
gestrichen, durch eine gerade Linie. Vers 112
bleibt unverändert. In einem späteren Arbeitsgang
(Textstand ɣ) streicht Kleist die Ergänzung in
112-1 wieder (mit wellenförmiger Linie) und ändert
im gleichen Arbeitsgang Vers 112 (durch zwei
Streichungen und zwei Ergänzungen), so dass mit
den verbleibenden acht Silben wieder eine Antilabe
entsteht. Diese Fassung entspricht auch der
Fassung des Erstdrucks. — Für die Diskussion um
ein Stemma von Kleists Krug ist diese Korrektur
wichtig. Die Herausgeber der BKA wollen zumindest
nicht ausschließen, dass Kleist die Korrekturen in
dieser Handschrift, die sich im Erstdruck
wiederfinden, aus einer anderen Handschrift X
übertragen habe. Der hier vorliegende, zweifache
und zeitlich getrennte Arbeitsvorgang würden der
Annahme einer weiteren Handschrift X
widersprechen, da hier nicht übertragen sondern
Lösungen erst probiert werden (Vgl. auch Zeller,
KJb xxx).
Aufgehangen? Ihn,
den Richter?
Was ſagt ihr?
Was ſagt ihr?
Aufgehangen? Ihn, den
Richter?
Was ſagt ihr?
Was ſagt ihr?
Licht.
Nichts. Es ist ein Mährchen bloß.
Nichts — Es ist ein
Mährchen bloß.
[ ]
[ ]
Inzwiſchen ruft man Hülfe
gleichinzwiſchen komt
herbei,
Inzwiſchen ruft
man Hülfe
gleich herbei,
Hülf
inzwiſchen komt herbei,
Huͤlf’ inzwiſchen kommt
herbei,
Man löſ’t ihn ab, und reibt ihn, und begießt
ihn,
Ins nackte Leben bringt man ihn zurück.
Adam
So? Bringt man ihn?
Licht.
Doch jetzo wird
verſiegelt
Doch jetzo wird
verſiegelt,
In ſeinem Haus, vereidet und
verſchloſſen,
Es iſt, als wär’ er eine
Leiche ſchon,
Es iſt, als waͤr er eine
Leiche ſchon,
Und auch ſein Richteramt iſt ſchon
beerbt.
Adam.
Ei, Henker, ſeht! — Ein liederlicher Hund
war’s —
11.
Sonſt eine ehrliche Haut, ſo wahr ich
lebe,
Ein Kerl, mit dem ſich’s gut zuſam̄en war;
Doch grauſam ſ
liederlich, das muß ich ſagen.
Wenn der Gerichtsrath heut in Holla war,
So gieng’s ihm ſchlecht, dem armen Kauz, das
glaub’ ich.
Licht.
Und dieſer Vorfall einzig, ſprach der
Bauer,
Sei Schuld, daß der Gerichtsrath noch nicht
hier;
Zu Mittag treff’ er doch
unfehlbar ein.
Zu Mittag treff’ er doch
ohnfehlbar ein.
Adam
Zu Mittag, gut, Gevatter.
Jetzt gilt’s Freundſchafft.
Zu Mittag! Gut,
Gevatter! Jetzt gilt’s Freundſchaft.
Ihr wißt, wie ſich zwei Hände waſchen
können.
Ihr wollt auch gern, ich weiß, Dorfrichter
werden,
Und ihr verdient’s, bei Gott, ſo gut wie
Einer.
Doch heut iſt noch nicht die
Gelegenheit,
Heut laßt ihr noch den Kelch
vorübergehn.
Licht
Dorfrichter, ich! Was denkt ihr auch von
mir?
Adam.
Ihr ſeid ein Freund von wohlgeſetzter
Rede,
Und euren Cicero habt ihr ſtudirt
Trotz Einem auf der Schul’ in Amſterdam.
Drückt euren Ehrgeiz heut hinunter, hört’
ihr?
Es werden wohl ſich Fälle noch ergeben,
Wo ihr mit eurer Kunſt euch zeigen
könnt.
Licht
Wir zwei Gevatterleute! Geht mir fort.
Adam
Zu ſeiner Zeit, ihr wißt’s, ſchwieg auch der
große
Demoſthenes. Folgt hierin ſeinem Muſter.
Und bin ich König nicht von Macedonien,
Kann ich auf meine Art doch dankbar
ſein.
12.
Licht.
Geht mir mit eurem Argwohn, ſag’ ich
euch.
Hab’ ich jemals —?
Hab ich jemals —?
Adam.
Seht, ich, ich, für mein Theil,
Dem großen Griechen folg’ ich auch. Es
ließe
Von Depoſitionen ſich und Zinſen
Zuletzt auch eine Rede ausarbeiten:
Wer wollte ſolche Perioden drehn?
Licht.
Nun, alſo!
Adam.
Von ſolchem Vorwurf bin ich
rein,
Der Henker hol’s! Und Alles, was es
gilt,
Ein Schwank iſt’s etwa, der zur Nacht
gebohren,
Des Tags vorwitz’gen Lichtſtrahl ſcheut.
Licht.
Ich weiß.
Adam.
Mein Seel! Es iſt kein Grund, warum ein
Richter,
Wenn er nicht auf dem Richtſtuhl ſitzt,
Soll gravitätiſch, wie ein Eisbär, ſein.
Licht.
Das ſag ich auch.
Adam.
Nun denn, ſo kom̄t, Gevatter.
Folgt mir ein wenig zur
Regiſtratur.
Folgt mir ein wenig zur
Regiſtratur;
Die Actenſtöße ſetz’ ich auf, denn die
Die liegen wie der Thurm zu Babylon.
Ein Bedienter
/: trit auf :/Hier ist
nachträglich, wohl von Kleist selbst, ein Querstrich
eingefügt worden zur Kennzeichnung des Beginns einer
neuen Szene (›Zweiter Auftritt‹ im
Erstdruck).
Der Bediente.
Gott helf, Herr Richter! Der Gerichtsrath
Walter
Läßt ſeinen Gruß vermelden, gleich wird er
hier ſein.
Adam
Ei, du gerechter Him̄el!
Iſt er mit Holla
Schon fertig?
11.
Der Bediente
Ja, er iſt in Huiſum ſchon.
Adam
He! Liſe! Grete!
He! Lieſe! Grete!
Licht.
Ruhig, ruhig jetzt.
Adam.
Gevatterchen!
Licht.
Laßt euren Dank
vermelden.
Laßt euern Dank
vermelden.
Der Bediente.
Und morgen reiſen wir nach Huſſahe.
Adam.
Was
thu
thu’ Das
Apostroph ist auch in einer Vergrößerung
nicht erkennbar, verbirgt sich aber
möglicherweise hinter dem Bogen über der
Minuskel ›u‹. Im Erstdruck ohne
Apostroph.
thu’ Das Apostroph ist auch in
einer Vergrößerung nicht erkennbar, verbirgt
sich aber möglicherweise hinter dem Bogen
über der Minuskel ›u‹.
BKA und Hamacher lesen jeweils ›thu’‹. Das
Apostroph ist auch in einer Vergrößerung nicht
erkennbar, verbirgt sich aber möglicherweise hinter
dem Bogen über der Minuskel ›u‹. Im Erstdruck ohne
Apostroph. ich jetzt? Was laſſ’ ich?
Was thu ich jetzt? Was
laſſ’ ich?
Was thu ich jetzt? Was laß
ich?In E hier eingefügt: ›Er greift nach
ſeinen Kleidern.‹.
Eine Magd
/: trit auf :/
Die Magd
Hier bin ich, Herr.
Licht.
Wollt ihr die Hoſen anziehn? Seid ihr
toll?
Zweite Magd
/: trit auf :/
Zweite Magd
Hier bin ich, Herr Dorfrichter.
Licht.
Nehmt den Rock.
Adam.In E ist
hinter ›Adam.‹ als Regieanweisung noch ›(ſieht ſich
um).‹ hinzugefügt.
Wer? Der Gerichtsrath?
Licht.
Ach, die Magd iſt es.
Adam
Die Bäffchen! Mantel! Kragen!
Die erſte Magd
Erſt die Weſte!
Adam.
Was? — Rock aus! Hurtig!
12.
Licht
/: zum Bedienten :/
Der Herr Gerichtsrath werden
Hier ſehr willkom̄en
ſein. Wir ſind ſogleich
Bereit ihn zu empfangen. Sagt ihm das.
Adam.
Den Teufel auch! Der Richter Adam läßt
ſich
Entſchuldigen.
Licht.
Entſchuldigen!
Adam.
Entſchuld’gen.
Iſt er ſchon unterwegs etwa?
Der Bediente.
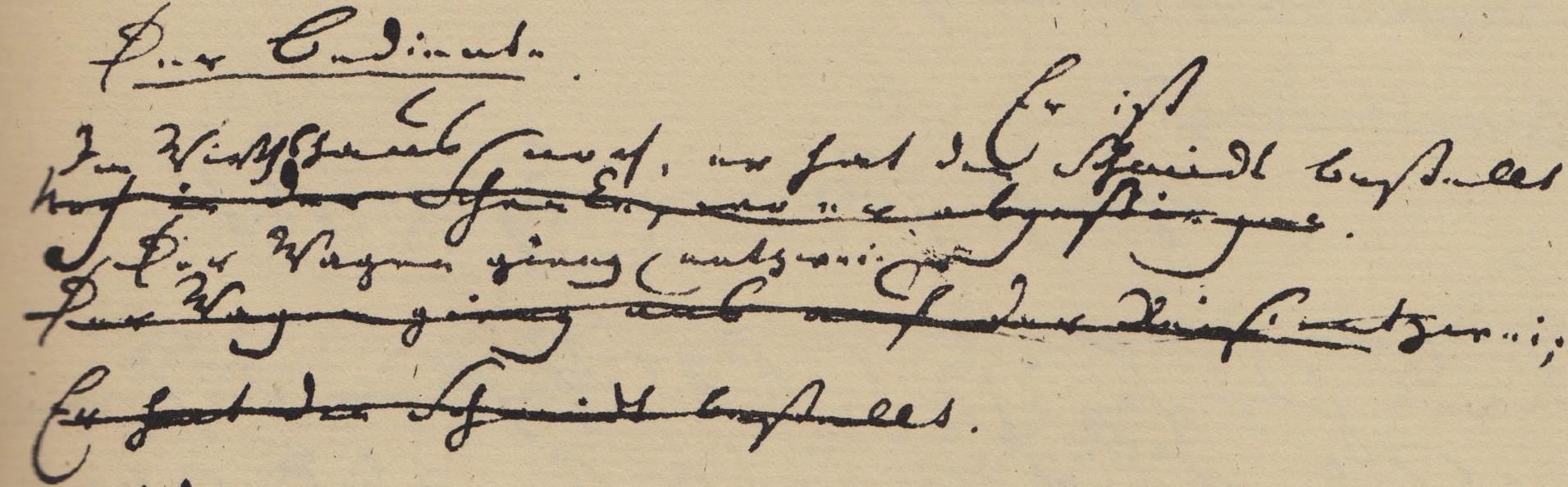 Er iſt
Noch in der Schenke, wo er
abgeſtiegen.
Im Wirthshaus noch,
er hat den Schmidt beſtellt
Noch in der Schenke, wo
er abgeſtiegen.
Im Wirthshaus
noch, er hat den Schmidt beſtellt
Im Wirthshaus noch. Er
hat den Schmidt beſtellt;
Der Wagen gieng uns auf der Reiſ’
entzwei;
Der Wagen gieng
entzwei.
Der Wagen
gieng uns auf der Reiſ’ entzwei;
Der Wagen
gieng entzwei.
Der Wagen ging
entzwei.
Er hat den Schmidt
beſtellt.
Er hat den Schmidt
beſtellt.
[ ]
[ ]
Adam
Gut. Mein Empfehl.
Der Schmidt iſt faul. Ich ließe mich
entſchuld’gen.
Ich hätte Hals und Beine faſt gebrochen,
Schaut ſelbſt, ſ’iſt ein
Spektakel, wie ich ausſeh:
Schaut ſelbſt, s’ iſt
ein Spektakel, wie ich ausſeh;
Und jeder Schreck purgirt
mich von Natur;
Und jeder Schreck
purgirt mich von Natur.
Ich wäre krank.
Adies.
Adies Ein
abschließender Punkt verbirgt sich unter der
letzten Durchstreichung (die ohne einen
vorhandenen Punkt auch gar keinen Sinn
hätte).
Adies Ein abschließender Punkt
verbirgt sich unter der letzten
Durchstreichung (die ohne einen vorhandenen
Punkt auch gar keinen Sinn
hätte).
Licht.
Seid ihr bei Sinnen? —
Der Herr Gerichtsrath wär ſehr angenehm.
— Wollt ihr?
Adam.
Zum Henker!
Licht.
Was?
Adam.
Der Teufel ſoll mich holen,
Iſt’s nicht ſo gut, als
hätt’ ich ſchon ein Pulver?
Iſt’s nicht ſo gut, als
haͤtt’ ich ſchon ein Pulver!
Licht.
Das fehlt noch, daß ihr auf den Weg ihm
leuchtet.
13.
Adam.
Margrethe! He! Der Sack
voll Knochen! Lieſe!
Margrethe! he! Der Sack
voll Knochen! Lieſe!
Die beiden Mägde
Hier ſind wir ja. Was wollt ihr?
Adam.
Fort! ſag’ ich.
Kuhkähſe, Schinken,
Butter, Würſte, Flaſchen
Kuhkaͤſe, Schinken,
Butter, Wuͤrſte, Flaſchen,
Aus der Regiſtratur geſchafft! Und flink!
—
Du nicht. Die Andere. — Maulaffe! Du ja!
— Gott’s Blitz, Margrethe! Lieſe ſoll, die
Kuhmagd,
In die Regiſtratur.
Die erſte Magd
/: abIn E wird ›ab‹ ergänzt zu
›(Die erſte Magd geht ab.)‹ :/
Die zweite Magd
Sprecht, ſoll man
euch verſtehn.
Sprecht, ſoll man euch
verſtehn!
Adam
Halt’s Maul jetzt, ſag’ ich —! Fort! Schaff
mir die Perücke!
Marſch! Aus dem KleiderBücherſchrank! Geſchwind! Pack dich!
Marſch! Aus dem
Kleiderſchrank! Geſchwind! Pack
dich!
Marſch! Aus dem
Bücherſchrank! Geſchwind! Pack
dich!
Marſch! Aus dem
Buͤcherſchrank! Geſchwind! Pack dich!
Die zweite Magd
/: ab :/
Licht
/: zum Bedienten :/
Es iſt dem Herrn Gerichtsrath, will ich
hoffen,
Nichts Böſes auf der Reiſe zugeſtoßen?
Der Bediente
Je, nun! Wir ſind im Hohlweg umgeworfen.
Adam.
Peſt! Mein geſchundner Fuß! Ich krieg’ die
Stiefeln —
Licht.
Ei, du mein Him̄el!
Umgeworfen, ſagt ihr?
Doch keinen Schaden weiter —?
Der Bediente.
Nichts von Bedeutung.
Der Herr verſtaukte ſich
die Hand ein wenig.
Der Herr verſtauchte
ſich die Hand ein wenig.
Die Deichſel brach.
Adam.
Daß er den Hals gebrochen!
14.
Licht.
Die Hand verſtaukt! Ei,
Herr Gott! Kam der Schmidt ſchon?
Die Hand verſtaucht! Ei,
Herr Gott! Kam der Schmidt ſchon?
Der Bediente.
Ja, für die Deichſel.
Licht.
Was?
Adam.
Ihr meint, der Doctor?
.
Ihr meint, der
Doctor?
Ihr meint, der
Doctor.
Ihr meint, der
Doctor.
Licht
Was?
Der Bediente.
Für die Deichſel?
Adam.
Ach, was! Für die Hand.
Der Bediente.
Adies, ihr Herrn. — Ich glaub’, die Kerls
ſind toll.
/: ab :/
Licht
Den Schmidt meint’ ich.
Adam.
Ihr gebt euch bloß, Gevatter.
Licht
Wie ſo?›Wie ſo‹ wurde
in Kleists Zeit häufig getrennt geschrieben. So auch
übernommen im Erstdruck. In Handschrift ein
erkennbarer, aber eher kleiner Abstand.
Adam.
Ihr ſeid verlegen.
Licht.
Er iſt
Noch in der Schenke, wo er
abgeſtiegen.
Im Wirthshaus noch,
er hat den Schmidt beſtellt
Noch in der Schenke, wo
er abgeſtiegen.
Im Wirthshaus
noch, er hat den Schmidt beſtellt
Im Wirthshaus noch. Er
hat den Schmidt beſtellt;
Der Wagen gieng uns auf der Reiſ’
entzwei;
Der Wagen gieng
entzwei.
Der Wagen
gieng uns auf der Reiſ’ entzwei;
Der Wagen
gieng entzwei.
Der Wagen ging
entzwei.
Er hat den Schmidt
beſtellt.
Er hat den Schmidt
beſtellt.
[ ]
[ ]
Adam
Gut. Mein Empfehl.
Der Schmidt iſt faul. Ich ließe mich
entſchuld’gen.
Ich hätte Hals und Beine faſt gebrochen,
Schaut ſelbſt, ſ’iſt ein
Spektakel, wie ich ausſeh:
Schaut ſelbſt, s’ iſt
ein Spektakel, wie ich ausſeh;
Und jeder Schreck purgirt
mich von Natur;
Und jeder Schreck
purgirt mich von Natur.
Ich wäre krank.
Adies.
Adies Ein
abschließender Punkt verbirgt sich unter der
letzten Durchstreichung (die ohne einen
vorhandenen Punkt auch gar keinen Sinn
hätte).
Adies Ein abschließender Punkt
verbirgt sich unter der letzten
Durchstreichung (die ohne einen vorhandenen
Punkt auch gar keinen Sinn
hätte).
Licht.
Seid ihr bei Sinnen? —
Der Herr Gerichtsrath wär ſehr angenehm.
— Wollt ihr?
Adam.
Zum Henker!
Licht.
Was?
Adam.
Der Teufel ſoll mich holen,
Iſt’s nicht ſo gut, als
hätt’ ich ſchon ein Pulver?
Iſt’s nicht ſo gut, als
haͤtt’ ich ſchon ein Pulver!
Licht.
Das fehlt noch, daß ihr auf den Weg ihm
leuchtet.
13.
Adam.
Margrethe! He! Der Sack
voll Knochen! Lieſe!
Margrethe! he! Der Sack
voll Knochen! Lieſe!
Die beiden Mägde
Hier ſind wir ja. Was wollt ihr?
Adam.
Fort! ſag’ ich.
Kuhkähſe, Schinken,
Butter, Würſte, Flaſchen
Kuhkaͤſe, Schinken,
Butter, Wuͤrſte, Flaſchen,
Aus der Regiſtratur geſchafft! Und flink!
—
Du nicht. Die Andere. — Maulaffe! Du ja!
— Gott’s Blitz, Margrethe! Lieſe ſoll, die
Kuhmagd,
In die Regiſtratur.
Die erſte Magd
/: abIn E wird ›ab‹ ergänzt zu
›(Die erſte Magd geht ab.)‹ :/
Die zweite Magd
Sprecht, ſoll man
euch verſtehn.
Sprecht, ſoll man euch
verſtehn!
Adam
Halt’s Maul jetzt, ſag’ ich —! Fort! Schaff
mir die Perücke!
Marſch! Aus dem KleiderBücherſchrank! Geſchwind! Pack dich!
Marſch! Aus dem
Kleiderſchrank! Geſchwind! Pack
dich!
Marſch! Aus dem
Bücherſchrank! Geſchwind! Pack
dich!
Marſch! Aus dem
Buͤcherſchrank! Geſchwind! Pack dich!
Die zweite Magd
/: ab :/
Licht
/: zum Bedienten :/
Es iſt dem Herrn Gerichtsrath, will ich
hoffen,
Nichts Böſes auf der Reiſe zugeſtoßen?
Der Bediente
Je, nun! Wir ſind im Hohlweg umgeworfen.
Adam.
Peſt! Mein geſchundner Fuß! Ich krieg’ die
Stiefeln —
Licht.
Ei, du mein Him̄el!
Umgeworfen, ſagt ihr?
Doch keinen Schaden weiter —?
Der Bediente.
Nichts von Bedeutung.
Der Herr verſtaukte ſich
die Hand ein wenig.
Der Herr verſtauchte
ſich die Hand ein wenig.
Die Deichſel brach.
Adam.
Daß er den Hals gebrochen!
14.
Licht.
Die Hand verſtaukt! Ei,
Herr Gott! Kam der Schmidt ſchon?
Die Hand verſtaucht! Ei,
Herr Gott! Kam der Schmidt ſchon?
Der Bediente.
Ja, für die Deichſel.
Licht.
Was?
Adam.
Ihr meint, der Doctor?
.
Ihr meint, der
Doctor?
Ihr meint, der
Doctor.
Ihr meint, der
Doctor.
Licht
Was?
Der Bediente.
Für die Deichſel?
Adam.
Ach, was! Für die Hand.
Der Bediente.
Adies, ihr Herrn. — Ich glaub’, die Kerls
ſind toll.
/: ab :/
Licht
Den Schmidt meint’ ich.
Adam.
Ihr gebt euch bloß, Gevatter.
Licht
Wie ſo?›Wie ſo‹ wurde
in Kleists Zeit häufig getrennt geschrieben. So auch
übernommen im Erstdruck. In Handschrift ein
erkennbarer, aber eher kleiner Abstand.
Adam.
Ihr ſeid verlegen.
Licht.
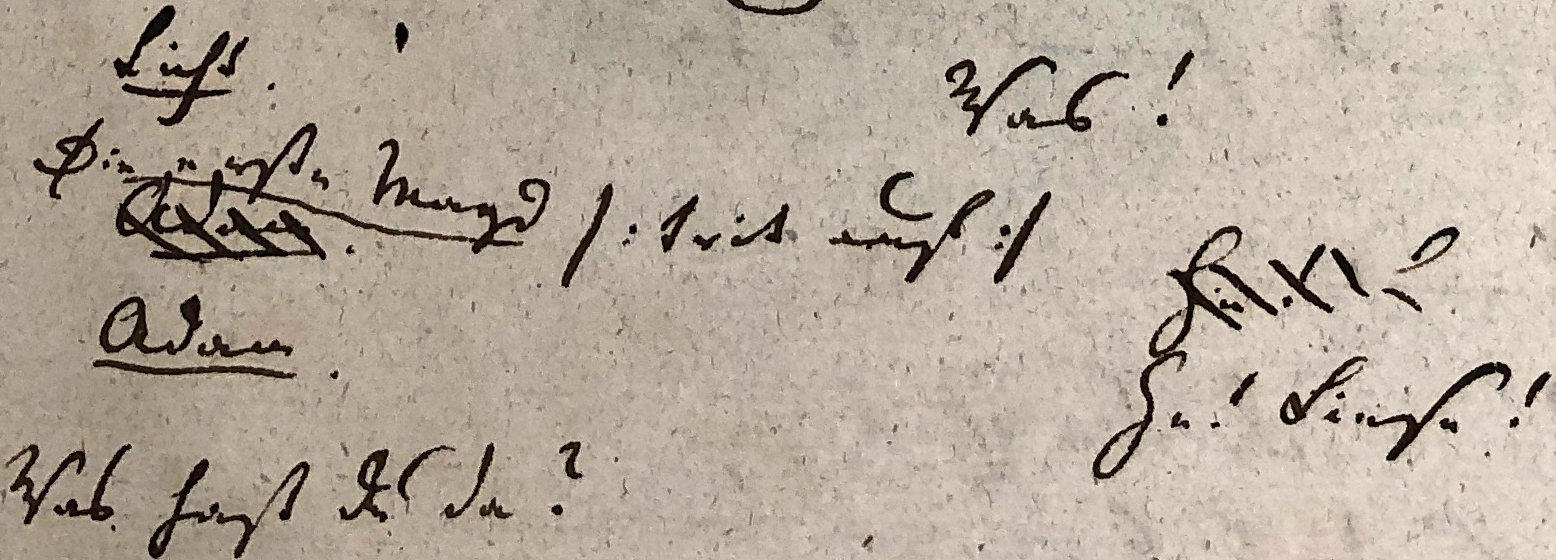 Was!
Die erſte
Magd
/: trit auf :/Sofortkorrektur. Kleist hatte offensichtlich bei der
Reinschrift die Regieanweisung
ausgelassen.
Adam.
He! L
Adam.
He! Lieſe!
Was haſt du da?
Erſte Magd.
Braunſchweiger
Würſt’, Herr Richter.
Braunſchweiger Wurſt,
Herr Richter.
Adam.
Das ſind Pupillenacten.
Licht.
Ich, verlegen!
15.
Adam.
Die kom̄en wieder zur
Regiſtratur.
Erſte Magd.
Die Würſte?
Adam.
Würſte! Was! Der Einſchlag
hier.
Licht.
Es war ein Misverſtändniß.
Die zweite Magd
/: trit auf :/
Zweite Magd.
Im Bücherſchrank,
Herr Richter, find’ ich
die Perücke nicht.
Herr Richter, find ich
die Peruͤcke nicht.
Adam.
Warum nicht?
Zweite Magd.
Hm! Weil ihr —
Adam.
Nun?
Zweite Magd.
Geſtern Abend
Glock eilf —
Zweite
Magd.Der Punkt hinter der
gestrichenen Sequenz ›Zweite Magd‹ ist nicht
eindeutig verifizierbar. (BKA und Recl:Hamacher
lesen ihn.)
Adam
Nun? Werd’ ich’s hören?
Nun? Werd ich’s
hoͤren?
Zweite Magd
Ei, ihr kamt ja,
Beſinnt euch, ohne die
Perück’ in’s Haus.
Beſinnt euch, ohne die
Peruͤck’ ins Haus.
Adam
Ich, ohne die Perücke?
Zweite Magd.
In der That.
Da iſt die Lieſe, die’s bezeugen kann.
Und eure andr’ iſt beim Perückenmacher.
Adam.
Ich wär’ —?
16.
Erſte Magd.
Ja, meiner Treu,
Herr Richter Adam.
Ja, meiner Treu, Herr
Richter Adam!
Kahlköpfig wart ihr, als
ihr wiederkamt,
Kahlkoͤpfig wart ihr,
als ihr wiederkamt;
Ihr ſpracht, ihr wärt gefallen, wißt ihr
nicht?
Das Blut mußt’ ich euch
noch vom Kopfe
waſchen.Ab hier schreibt Kleist mit neuer (oder neu
beschnittener) Feder.
Das Blut mußt ich euch
noch vom Kopfe waſchen.
Adam.
Die Unverſchämte!
Erſte Magd.
Ich will nicht ehrlich ſein.
Adam.
Halt’s Maul, ſag’ ich, es iſt kein wahres
Wort.
Licht.
Habt ihr die Wund’ denn geſtern
ſchon —?
Habt ihr die Wund’ ſeit
geſtern ſchon?
Adam.
Nein heut.
Die Wunde heut und geſtern die Perücke.
Ich trug ſie weißgepudert
auf dem Kopfe,
Ich trug ſie weiß
gepudert auf dem Kopfe,
Und nahm ſie mit dem Huth, auf Ehre,
bloß,
Als ich ins Haus trat, aus Verſehen h ab.
Was die gewaſchen hat, das weiß ich
nicht.
— Scheer dich zum Satan, wo du
hingehörſt!
In die Regiſtratur!
Erſte Magd /: ab
:/
Geh, Margarethe!
Gevatter Küſter ſoll mir
ſeine borgen.
Gevatter Kuͤſter ſoll
mir ſeine borgen;
In meine hätt’ die Katze heute Morgen
Gejungt, das Schwein! Sie läge
eingeſäuet
Mir unterm Bette da, ich weiß nun ſchon.
Licht.
Die Katze? Was? Seid ihr —?
Adam.
So wahr ich lebe.
Fünf Junge, gelb und
ſchwarz, und Ein’ iſt weiß.
Fuͤnf Junge, gelb und
ſchwarz, und eins iſt weiß.
Die Schwarzen will ich in
der Vecht erſäufen.
Was ſoll man machen? Wollt ihr eine
haben?
17.
Licht.
In die Perücke?
Adam.
Der Teufel ſoll mich holen.
Ich hatte die Perücke aufgehängt,
Auf einen Stuhl, da ich zu Bette gieng,
Den Stuhl berühr’ ich in der Nacht, ſie
fällt —
Licht.
Drauf nimt die Katze ſie ins Maul —
Adam.
Mein Seel —
Licht.
Und trägt ſie unter’s
Bett’ und jungt darin.
Und traͤgt ſie unter’s
Bett und jungt darin.
Adam
In’s Maul? Nein —
Licht.
Nicht? Wie ſonſt?
Adam.
Die Katz’? Ach, was!
Licht.
Nicht? Oder ihr vielleicht?
Adam.
In’s Maul! Ich glaube —!
Ich ſtieß ſie mit dem Fuße heut
hinunter,
Als ich es ſah.
Licht.
Gut, gut.
Adam.
Canaillen, die!
Die balzen ſich und jungen, wo ein Platz
iſt.
Zweite Magd
/: kichernd :/
So ſoll ich hingehn?
Adam.
Ja, und meinen Gruß
An Muhme Schwarzgewand, die Küſterinn.
Ich ſchickt’ ihr die Perücke unverſehrt
18.
Noch heut zurück — ihm
brauch’ſt du nichts zu ſagen.
Noch heut zuruͤck — ihm
brauchſt du nichts zu ſagen.
Verſtehſt du mich?
Zweite Magd.
Ich werd’ es ſchon beſtellen.
/: ab :/
Adam.
Mir ahndet heut nichts Guts, Gevatter
Licht.
Licht.
Warum?
Adam.
Es geht bunt Alles über Ecke
mir.
Iſt nicht auch heut Gerichtstag?
Licht.
Allerdings.
Die Kläger ſtehen vor der Thüre ſchon.
Adam.
— Mir träumt’, es hätt’ ein Kläger mich
ergriffen,
Und ſchleppte vor den Richtſtuhl mich; und
ich,
Ich ſäße gleichwohl auf
den Richtſtuhl dort,
Ich ſaͤße gleichwohl auf
dem Richtſtuhl dort,
Und ſchält’ und hunzt’ und ſchlingelte mich
herunter,
Und judicirt’ den Hals ins Eiſen mir.
Licht.
Wie? Ihr euch ſelbſt?
Adam.
So wahr ich ehrlich bin.
Drauf wurden beide wir zu Eins, und
flohn,
Und mußten in den Fichten übernachten.
Licht.
Nun? Und der Traum meint ihr?
Adam.
Der Teufel hol’s.
Wenn’s auch der Traum nicht iſt, ein
Schabernack,
Sei’s, wie es woll’, iſt
wider mich im Werk.
Sei’s, wie es woll’, iſt
wider mich im Werk!
Licht.
Die läpp’ſche Furcht! Gebt
ihr nur vorſchriftsmäßig
Die laͤpp’ſche Furcht!
Gebt ihr nur vorſchriftsmaͤßig,
19.
Wenn der Gerichtsrath gegenwärtig iſt,Kleist hat
hier offensichtlich zu Beginn der neuen Seite bei
der Abschrift eine Zeile ausgelassen und sie
nachträglich am obereren Seitenrand
ergänzt.
Recht den Partheien auf
dem Richterſtuhl,
Recht den Partheien auf
dem Richterſtuhle,
Damit der Traum vom ausgehunzten Richter
Auf andre Art nicht in Erfüllung geht.
Der
Gerichtsrath Walter
/: trit auf :/
Walter.
Gott grüß euch, Richter Adam.
Adam.
Was!
Die erſte
Magd
/: trit auf :/Sofortkorrektur. Kleist hatte offensichtlich bei der
Reinschrift die Regieanweisung
ausgelassen.
Adam.
He! L
Adam.
He! Lieſe!
Was haſt du da?
Erſte Magd.
Braunſchweiger
Würſt’, Herr Richter.
Braunſchweiger Wurſt,
Herr Richter.
Adam.
Das ſind Pupillenacten.
Licht.
Ich, verlegen!
15.
Adam.
Die kom̄en wieder zur
Regiſtratur.
Erſte Magd.
Die Würſte?
Adam.
Würſte! Was! Der Einſchlag
hier.
Licht.
Es war ein Misverſtändniß.
Die zweite Magd
/: trit auf :/
Zweite Magd.
Im Bücherſchrank,
Herr Richter, find’ ich
die Perücke nicht.
Herr Richter, find ich
die Peruͤcke nicht.
Adam.
Warum nicht?
Zweite Magd.
Hm! Weil ihr —
Adam.
Nun?
Zweite Magd.
Geſtern Abend
Glock eilf —
Zweite
Magd.Der Punkt hinter der
gestrichenen Sequenz ›Zweite Magd‹ ist nicht
eindeutig verifizierbar. (BKA und Recl:Hamacher
lesen ihn.)
Adam
Nun? Werd’ ich’s hören?
Nun? Werd ich’s
hoͤren?
Zweite Magd
Ei, ihr kamt ja,
Beſinnt euch, ohne die
Perück’ in’s Haus.
Beſinnt euch, ohne die
Peruͤck’ ins Haus.
Adam
Ich, ohne die Perücke?
Zweite Magd.
In der That.
Da iſt die Lieſe, die’s bezeugen kann.
Und eure andr’ iſt beim Perückenmacher.
Adam.
Ich wär’ —?
16.
Erſte Magd.
Ja, meiner Treu,
Herr Richter Adam.
Ja, meiner Treu, Herr
Richter Adam!
Kahlköpfig wart ihr, als
ihr wiederkamt,
Kahlkoͤpfig wart ihr,
als ihr wiederkamt;
Ihr ſpracht, ihr wärt gefallen, wißt ihr
nicht?
Das Blut mußt’ ich euch
noch vom Kopfe
waſchen.Ab hier schreibt Kleist mit neuer (oder neu
beschnittener) Feder.
Das Blut mußt ich euch
noch vom Kopfe waſchen.
Adam.
Die Unverſchämte!
Erſte Magd.
Ich will nicht ehrlich ſein.
Adam.
Halt’s Maul, ſag’ ich, es iſt kein wahres
Wort.
Licht.
Habt ihr die Wund’ denn geſtern
ſchon —?
Habt ihr die Wund’ ſeit
geſtern ſchon?
Adam.
Nein heut.
Die Wunde heut und geſtern die Perücke.
Ich trug ſie weißgepudert
auf dem Kopfe,
Ich trug ſie weiß
gepudert auf dem Kopfe,
Und nahm ſie mit dem Huth, auf Ehre,
bloß,
Als ich ins Haus trat, aus Verſehen h ab.
Was die gewaſchen hat, das weiß ich
nicht.
— Scheer dich zum Satan, wo du
hingehörſt!
In die Regiſtratur!
Erſte Magd /: ab
:/
Geh, Margarethe!
Gevatter Küſter ſoll mir
ſeine borgen.
Gevatter Kuͤſter ſoll
mir ſeine borgen;
In meine hätt’ die Katze heute Morgen
Gejungt, das Schwein! Sie läge
eingeſäuet
Mir unterm Bette da, ich weiß nun ſchon.
Licht.
Die Katze? Was? Seid ihr —?
Adam.
So wahr ich lebe.
Fünf Junge, gelb und
ſchwarz, und Ein’ iſt weiß.
Fuͤnf Junge, gelb und
ſchwarz, und eins iſt weiß.
Die Schwarzen will ich in
der Vecht erſäufen.
Was ſoll man machen? Wollt ihr eine
haben?
17.
Licht.
In die Perücke?
Adam.
Der Teufel ſoll mich holen.
Ich hatte die Perücke aufgehängt,
Auf einen Stuhl, da ich zu Bette gieng,
Den Stuhl berühr’ ich in der Nacht, ſie
fällt —
Licht.
Drauf nimt die Katze ſie ins Maul —
Adam.
Mein Seel —
Licht.
Und trägt ſie unter’s
Bett’ und jungt darin.
Und traͤgt ſie unter’s
Bett und jungt darin.
Adam
In’s Maul? Nein —
Licht.
Nicht? Wie ſonſt?
Adam.
Die Katz’? Ach, was!
Licht.
Nicht? Oder ihr vielleicht?
Adam.
In’s Maul! Ich glaube —!
Ich ſtieß ſie mit dem Fuße heut
hinunter,
Als ich es ſah.
Licht.
Gut, gut.
Adam.
Canaillen, die!
Die balzen ſich und jungen, wo ein Platz
iſt.
Zweite Magd
/: kichernd :/
So ſoll ich hingehn?
Adam.
Ja, und meinen Gruß
An Muhme Schwarzgewand, die Küſterinn.
Ich ſchickt’ ihr die Perücke unverſehrt
18.
Noch heut zurück — ihm
brauch’ſt du nichts zu ſagen.
Noch heut zuruͤck — ihm
brauchſt du nichts zu ſagen.
Verſtehſt du mich?
Zweite Magd.
Ich werd’ es ſchon beſtellen.
/: ab :/
Adam.
Mir ahndet heut nichts Guts, Gevatter
Licht.
Licht.
Warum?
Adam.
Es geht bunt Alles über Ecke
mir.
Iſt nicht auch heut Gerichtstag?
Licht.
Allerdings.
Die Kläger ſtehen vor der Thüre ſchon.
Adam.
— Mir träumt’, es hätt’ ein Kläger mich
ergriffen,
Und ſchleppte vor den Richtſtuhl mich; und
ich,
Ich ſäße gleichwohl auf
den Richtſtuhl dort,
Ich ſaͤße gleichwohl auf
dem Richtſtuhl dort,
Und ſchält’ und hunzt’ und ſchlingelte mich
herunter,
Und judicirt’ den Hals ins Eiſen mir.
Licht.
Wie? Ihr euch ſelbſt?
Adam.
So wahr ich ehrlich bin.
Drauf wurden beide wir zu Eins, und
flohn,
Und mußten in den Fichten übernachten.
Licht.
Nun? Und der Traum meint ihr?
Adam.
Der Teufel hol’s.
Wenn’s auch der Traum nicht iſt, ein
Schabernack,
Sei’s, wie es woll’, iſt
wider mich im Werk.
Sei’s, wie es woll’, iſt
wider mich im Werk!
Licht.
Die läpp’ſche Furcht! Gebt
ihr nur vorſchriftsmäßig
Die laͤpp’ſche Furcht!
Gebt ihr nur vorſchriftsmaͤßig,
19.
Wenn der Gerichtsrath gegenwärtig iſt,Kleist hat
hier offensichtlich zu Beginn der neuen Seite bei
der Abschrift eine Zeile ausgelassen und sie
nachträglich am obereren Seitenrand
ergänzt.
Recht den Partheien auf
dem Richterſtuhl,
Recht den Partheien auf
dem Richterſtuhle,
Damit der Traum vom ausgehunzten Richter
Auf andre Art nicht in Erfüllung geht.
Der
Gerichtsrath Walter
/: trit auf :/
Walter.
Gott grüß euch, Richter Adam.
Adam.
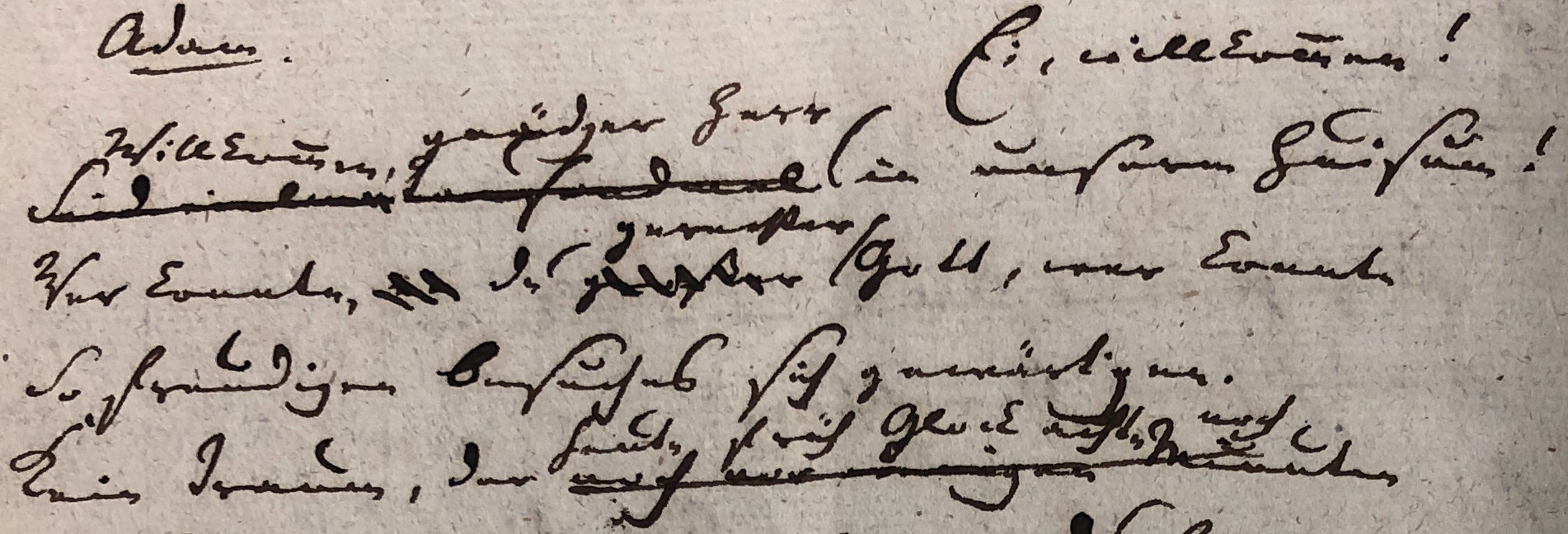 Ei, willkom̄en!
Seid vielma
Willkom̄en
Ttauſendmal
gnädger Herr in unſerm
Huiſum!Die Textgenese von Vers 286
ist nicht mit letzter Sicherheit zu bestimmen, obwohl
die Textänderungen zunächst eindeutig scheinen. Vom
graphischen Befund her haben wir es vermeintlich mit
zwei Streichungen zu tun, der Streichung von ›Seid
vielma‹ und der von ›tauſendmal‹. Auch die Ergänzungen
von ›Willkom̄en,‹ und ›gnädger Herr‹ sind in zwei
Arbeitsgängen vorgenommen, da sie nicht auf einer
gemeinsamen Grundlinie stehen. Hieraus ließe sich
folgern, dass Kleist zunächst mit Variante a beginnt,
sie aber abbricht und streicht und mit ›Willkom̄en,
tauſendmal‹ neu ansetzt und wie in Variante 286c
fortsetzt. Allerdings bleiben bei dieser Hypothese
zwei Fragen offen: warum schrieb Kleist nach
Streichung von ›Seid vielma‹ seine Änderung
›Willkom̄en, tauſendmal‹ nicht direkt auf der
Grundlinie weiter? und warum ist ›Willkom̄en,‹ so
platziert (schräg nach unten neigend), als solle es
nahtlos an ›tauſendmal‹ anschließen? Die letzte Frage
ist dadurch zu beantworten, dass das Wort ›tauſendmal‹
schon vor ›Willkom̄en,‹ geschrieben war, wofür weitere
Schriftmerkmale sprechen (u.a. die exakt gleiche
Grundlinie wie ›Seid vielma‹, gleiche Strichstärke,
gleicher Raumbedarf). Daraus würde folgen, dass ›Seid
vielma‹ nicht in einem Zug gestrichen wurde, sondern
zunächst nur ›vielma‹ im Rahmen einer Sofortkorrektur
durch ›tauſendmal‹ ersetzt wurde. Erst später ist dann
auch ›Seid‹ gestrichen worden. Als Ergebnis erhalten
wir zunächst Variante b: ›Seid tauſendmal in unſerm
Huiſum!‹, die mit dem vorgeschalteten ›Ei,
willkom̄en!‹ aus Vers 285 auch Sinn macht.
Seid vielma
Ttauſendmal
Willkom̄en
tauſendmal in unſerm Huiſum!
Willkom̄en gnädger
Herr in unſerm Huiſum!
Willkommen, gnaͤd’ger
Herr, in unſerm Huiſum!
Wer konnte, ei du großer
gerechter Gott, wer konnte
Wer konnte, ei du
großer Gott, wer konnte
Wer konnte, du
gerechter Gott, wer konnte
Wer konnte, du gerechter
Gott, wer konnte
So freudigen Beſuches ſich gewärt’gen.
Kein Traum, der noch vor
wenigen Minuten
heute früh Glock achte noch
Kein Traum, der noch vor
wenigen Minuten
Kein Traum, der
heute früh Glock achte noch
Kein Traum, der heute
fruͤh Glock achte noch
Zu ſolchem Glücke ſich verſteigen
durfte.
Walter.
Ich kom̄’ ein wenig ſchnell, ich weiß, und muß
Ich komm ein wenig
ſchnell, ich weiß; und muß
Auf dieſer Reiſ’, in unſrer Staaten
Dienſt,
Zufrieden ſein, wenn meine Wirthe mich
Mit wohlgemeintem Abſchiedsgruß
entlaſſen.
Inzwiſchen ich, was meinen Gruß
betrifft,
Ich mein’s von Herzen gut, ſchon wenn ich
kom̄e.
Das Obertribunal in Utrecht will
Die Rechtspfleg’ auf dem platten Land
verbeſſern,
Die mangelhaft von mancher Seite
ſcheint,
Und ſtrenge Weiſung hat
der Misbrauch zu erwarten:
Und ſtrenge Weiſung hat
der Mißbrauch zu erwarten.
Doch mein
Geſchäfft auf dieſer Reiſ’ iſt noch
Ein ſtrenges nicht, ſehn ſoll ich bloß,
nicht ſtrafen,
Und find’ ich gleich nicht
Alles, wie es ſoll,
Und find ich gleich
nicht Alles, wie es ſoll,
Ich freue mich, wenn es erträglich iſt.
Adam.
Fürwahr, ſo edle Denkart muß man loben.
Ew. Gnaden werden hie und da, nicht zweifl’
ich,
20.
Den alten Brauch im Recht
zu tadeln wiſſen,
Den alten Brauch im
Recht zu tadeln wiſſen;
Und wenn er in den Niederlanden gleich
Seit Kaiſer Karl dem fünften ſchon
beſteht:
Was läßt ſich in Gedanken nicht
erfinden?
Die Welt, ſagt unſer Sprichwort, wird ſtets
klüger,
Und Alles lieſ’t,
ich
weiß,BKA liest Ergänzung als
Sofortkorrektur. Die Schriftmerkmale sprechen eher
dafür, dass die Ergänzung zeitgleich mit anderen
Änderungen auf dieser Seite (20) vorgenommen
wurde. den Puffendorf:
Und Alles lieſ’t den
Puffendorff:
Und Alles
lieſ’t,
ich weiß, den Puffendorff:
Und Alles lieſ’t, ich
weiß, den Puffendorff;
Doch Huiſum iſt ein kleiner Theil der
Welt,
Auf den nicht mehr, nicht minder, als ſein
Theil nur
Kann von der allgemeinen Klugheit kom̄en.
Ei, willkom̄en!
Seid vielma
Willkom̄en
Ttauſendmal
gnädger Herr in unſerm
Huiſum!Die Textgenese von Vers 286
ist nicht mit letzter Sicherheit zu bestimmen, obwohl
die Textänderungen zunächst eindeutig scheinen. Vom
graphischen Befund her haben wir es vermeintlich mit
zwei Streichungen zu tun, der Streichung von ›Seid
vielma‹ und der von ›tauſendmal‹. Auch die Ergänzungen
von ›Willkom̄en,‹ und ›gnädger Herr‹ sind in zwei
Arbeitsgängen vorgenommen, da sie nicht auf einer
gemeinsamen Grundlinie stehen. Hieraus ließe sich
folgern, dass Kleist zunächst mit Variante a beginnt,
sie aber abbricht und streicht und mit ›Willkom̄en,
tauſendmal‹ neu ansetzt und wie in Variante 286c
fortsetzt. Allerdings bleiben bei dieser Hypothese
zwei Fragen offen: warum schrieb Kleist nach
Streichung von ›Seid vielma‹ seine Änderung
›Willkom̄en, tauſendmal‹ nicht direkt auf der
Grundlinie weiter? und warum ist ›Willkom̄en,‹ so
platziert (schräg nach unten neigend), als solle es
nahtlos an ›tauſendmal‹ anschließen? Die letzte Frage
ist dadurch zu beantworten, dass das Wort ›tauſendmal‹
schon vor ›Willkom̄en,‹ geschrieben war, wofür weitere
Schriftmerkmale sprechen (u.a. die exakt gleiche
Grundlinie wie ›Seid vielma‹, gleiche Strichstärke,
gleicher Raumbedarf). Daraus würde folgen, dass ›Seid
vielma‹ nicht in einem Zug gestrichen wurde, sondern
zunächst nur ›vielma‹ im Rahmen einer Sofortkorrektur
durch ›tauſendmal‹ ersetzt wurde. Erst später ist dann
auch ›Seid‹ gestrichen worden. Als Ergebnis erhalten
wir zunächst Variante b: ›Seid tauſendmal in unſerm
Huiſum!‹, die mit dem vorgeschalteten ›Ei,
willkom̄en!‹ aus Vers 285 auch Sinn macht.
Seid vielma
Ttauſendmal
Willkom̄en
tauſendmal in unſerm Huiſum!
Willkom̄en gnädger
Herr in unſerm Huiſum!
Willkommen, gnaͤd’ger
Herr, in unſerm Huiſum!
Wer konnte, ei du großer
gerechter Gott, wer konnte
Wer konnte, ei du
großer Gott, wer konnte
Wer konnte, du
gerechter Gott, wer konnte
Wer konnte, du gerechter
Gott, wer konnte
So freudigen Beſuches ſich gewärt’gen.
Kein Traum, der noch vor
wenigen Minuten
heute früh Glock achte noch
Kein Traum, der noch vor
wenigen Minuten
Kein Traum, der
heute früh Glock achte noch
Kein Traum, der heute
fruͤh Glock achte noch
Zu ſolchem Glücke ſich verſteigen
durfte.
Walter.
Ich kom̄’ ein wenig ſchnell, ich weiß, und muß
Ich komm ein wenig
ſchnell, ich weiß; und muß
Auf dieſer Reiſ’, in unſrer Staaten
Dienſt,
Zufrieden ſein, wenn meine Wirthe mich
Mit wohlgemeintem Abſchiedsgruß
entlaſſen.
Inzwiſchen ich, was meinen Gruß
betrifft,
Ich mein’s von Herzen gut, ſchon wenn ich
kom̄e.
Das Obertribunal in Utrecht will
Die Rechtspfleg’ auf dem platten Land
verbeſſern,
Die mangelhaft von mancher Seite
ſcheint,
Und ſtrenge Weiſung hat
der Misbrauch zu erwarten:
Und ſtrenge Weiſung hat
der Mißbrauch zu erwarten.
Doch mein
Geſchäfft auf dieſer Reiſ’ iſt noch
Ein ſtrenges nicht, ſehn ſoll ich bloß,
nicht ſtrafen,
Und find’ ich gleich nicht
Alles, wie es ſoll,
Und find ich gleich
nicht Alles, wie es ſoll,
Ich freue mich, wenn es erträglich iſt.
Adam.
Fürwahr, ſo edle Denkart muß man loben.
Ew. Gnaden werden hie und da, nicht zweifl’
ich,
20.
Den alten Brauch im Recht
zu tadeln wiſſen,
Den alten Brauch im
Recht zu tadeln wiſſen;
Und wenn er in den Niederlanden gleich
Seit Kaiſer Karl dem fünften ſchon
beſteht:
Was läßt ſich in Gedanken nicht
erfinden?
Die Welt, ſagt unſer Sprichwort, wird ſtets
klüger,
Und Alles lieſ’t,
ich
weiß,BKA liest Ergänzung als
Sofortkorrektur. Die Schriftmerkmale sprechen eher
dafür, dass die Ergänzung zeitgleich mit anderen
Änderungen auf dieser Seite (20) vorgenommen
wurde. den Puffendorf:
Und Alles lieſ’t den
Puffendorff:
Und Alles
lieſ’t,
ich weiß, den Puffendorff:
Und Alles lieſ’t, ich
weiß, den Puffendorff;
Doch Huiſum iſt ein kleiner Theil der
Welt,
Auf den nicht mehr, nicht minder, als ſein
Theil nur
Kann von der allgemeinen Klugheit kom̄en.
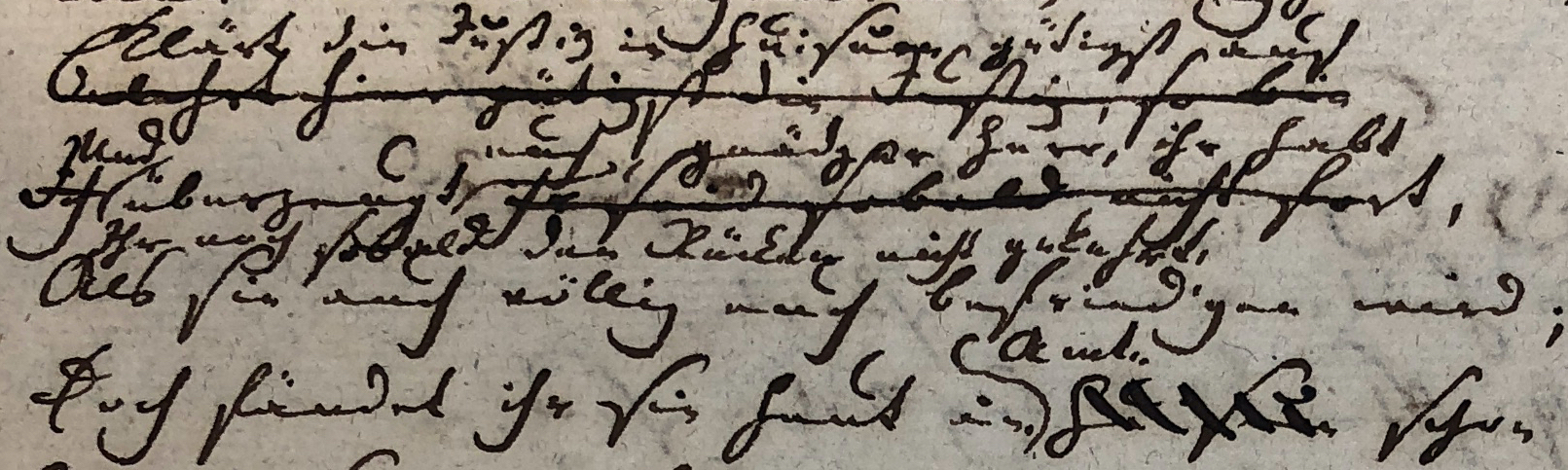 Belehrt hier gütigſt die Juſtiz, ſo binKlärt die
Juſtiz in Huiſum gütigſt auf
Belehrt hier gütigſt
die Juſtiz, ſo bin
Klärt die
Juſtiz in Huiſum gütigſt auf
Klaͤrt die Juſtiz in
Huiſum guͤtigſt auf,
Ich
Und überzeugt, ihr ſeid
ſobald nicht fort,
euch,
gnädger Herr, ihr habt
Ich
überzeugt, ihr ſeid ſobald nicht
fort,
Und
überzeugt euch, gnädger Herr, ihr habt
Und uͤberzeugt euch,
gnaͤd’ger Herr, ihr habt
Ihr noch ſobald
den Rücken nicht gekehrt,
[ ]
Ihr noch
ſobald den Rücken nicht gekehrt,
Ihr noch ſobald den
Ruͤcken nicht gekehrt,
Als ſie auch völlig euch befried’gen
wird;
Doch fändet ihr ſie
heut inm
Amte
Huiſum ſchon
Doch fändet ihr ſie heut
in
Huiſum ſchon
Doch fändet ihr ſie
heut im
Amte ſchon
Doch faͤndet ihr ſie
heut im Amte ſchon
Wie ihr ſie wünſcht, mein Seel, ſo wär’s ein
Wunder,
Da ſie nur dunkel weiß noch, was ihr
wollt.
Walter
Es fehlt an Vorſchriften, ganz recht.
Vielmehr
Es ſind zu viel, man wird ſie ſichten
müſſen.
Adam.
Ja, durch ein großes Sieb. Viel Spreu! Viel
Spreu!
Walter.
Das iſt dort der Herr Schreiber?
Licht.
Der Schreiber Licht,
Zu Ew.uer
hohern Gnaden Dienſten.
Pfingſten
Neun Jahre, daß ich im Juſtizamt bin.
Adam
/: bringt einen Stuhl
:/
Setzt euch.
Walter
Laßt ſein.
Adam
Ihr kom̄t von
Holla ſchon.
Walter
Zwei kleine Meilen — Woher wißt ihr das?
21.
Adam
Woher? Ew. Gnaden Diener —
Licht.
Ein Bauer ſagt’ es,
Der eben jetzt von Holla eingetroffen.
Walter
Ein Bauer?
Adam.
Aufzuwarten.
Walter.
— Ja! Es trug ſich
Dort ein ung
unangenehmer Vorfall ſein zu,
Der mir die heitre Laune ſtörte,
Die in Geſchäfften uns begleiten ſoll. —
Ihr werdet davon unterrichtet ſein?
Adam.
Wär’s wahr, geſtrenger Herr? Der Richter
Pfaul,
Weil er Arreſt in ſeinem Hauſ’ empfieng,
Verzweiflung hätt’ den Thoren
überraſcht,
Er hieng ſich auf?
Walter.
Und machte Übel ärger.
Was nur Unordnung ſchien, Verworrenheit,
Nimt jetzt den Schein an der
Veruntreuung,
Die das Geſetz, ihr wißt’s, nicht mehr
verſchont. —
Wie viele Caſſen habt ihr?
Adam.
Fünf, zu dienen.
Walter
Wie, fuünf! Ich
ſtand im Wahn — Gefüllte Caſſen?
Ich ſtand im Wahn, daß ihr
nur vier —
Adam.
Verzeiht.
Verzeiht!
Mit der Rhein-Inundations-Collecten-Caſſe?
22.
Walter.
Mit der Inundations-Collecten-Caſſe!
Doch jetzo iſt der Rhein nicht inundirt,
Und die Collecten gehn mithin nicht ein.
— Sagt doch, ihr habt ja
wohl gGerichtsrathBKA liest hier statt eines
gestrichenen ›g‹ ein gestrichenes Komma.
heut’?
— Sagt doch, ihr habt ja
wohl Gerichtstag heut?
Adam.
Ob wir —?
Walter.
Was?
Licht.
Ja, den erſten in der Woche.
Walter
Und jene Schaar von Leuten, die ich
draußen
Auf eurem Flure ſah, ſind das —?
Adam.
Das werden —
Licht.
Die Kläger ſind’s, die ſich bereits verſam̄eln.
Walter.
Gut. Dieſer Umſtand iſt mir lieb, ihr
Herren.
Laßt dieſe Leute, wenn’s beliebt,
erſcheinen.
Ich wohne dem Gerichtsgang
bei, ich ſehe,
Ich wohne dem
Gerichtsgang bei; ich ſehe
Wie er in eurem Huiſum
üblich iſt,
Wie er in eurem Huiſum
uͤblich iſt.
Wir nehmen die Regiſtratur, die Caſſen,
Nachher, wenn dieſe Sache abgethan.
Adam
Wie ihr befehlt. — Der Büttel! He!
Hanfriede!
Die zweite Magd
/: trit auf :/
Zweite Magd.
Gruß von Frau Küſterinn, Herr Richter
Adam.
Gruß von Frau
Küſterinn, Herr Richter Adam.
Gruß von Frau
Kuͤſterinn, Herr Richter Adam;
So gern ſie die Perück’ euch auch —
Adam.
Wie? Nicht?
Zweite Magd.
Sie ſagt, es wäre
Morgenpredigt heute,
Sie ſagt, es waͤre
Morgenpredigt heute;
23.
Der Küſter hätte ſelbſt die Eine auf,
Und ſeine Andre wäre unbrauchbar,
Sie ſollte heut zu dem Perückenmacher.
Adam.
Verflucht!
Zweite Magd.
Sobald der Küſter
wiederköm̄t,
BKA liest mit Wortzwischenraum:
›wieder köm̄t‹Lesart mit
oder ohne Wortzwischenraum ist nicht
entscheidbar. Allerdings ist der Abstand
zwischen ›wieder‹ und ›köm̄t‹ deutlich kleiner
als die sonstigen Wortabstände und entspricht
eher den Abständen, die Kleist innerhalb von
Wörtern macht.
liest wie BKA mit
Wortzwischenraum: ›wieder köm̄t‹
Wird ſie jedoch ſogleich euch ſeine
ſchicken.
Adam.
Auf meine Ehre, gnäd’ger Herr —
Walter.
Was giebt’s?
Adam.
Ein Zufall, ein verwünſchter, hat um
beide
Perücken mich gebracht. Und jetzt bleibt
mir
Die dritte aus, die ich mir leihen
wollte:
Ich muß kahlköpfig den Gerichtstag
halten.
Walter.
Kahlköpfig!Erneuter Federwechsel (oder neu beschnittene
Feder).
Adam.
Ja, beim ew’gen
Gott! So ſehr
Ja, beim ewigen Gott! So
ſehr
Ich ohne der Perrücke
Perücke Beiſtand auch
um
Ich ohne der Perrücke
Beiſtand auch
Ich ohne der
Perücke Beiſtand um
Ich ohne der Peruͤcke
Beiſtand um
Mein Richteranſehn auch verlegen bin.
— Ich müßt’ es auf dem Vorwerk noch
verſuchen,
Ob mir vielleicht der Pächter —?
Walter.
Auf dem Vorwerk!
Kann jemand Anders hier im Orte nicht —?
Adam.
Nein, in der That —
Walter.
Der Prediger vielleicht.
Adam
Der Prediger? Der —
Walter.
Oder Schulmeiſter
24.
Adam.
Seit der Sackzehnde abgeſchafft,
hEw
Ew.
Gnaden,
Wozu ich vor’gen Som̄er
hier im
Amte mitgewirkt,
Wozu ich vor’gen
Som̄er mitgewirkt,
Wozu ich hier im
Amte mitgewirkt,
Wozu ich hier im Amte
mitgewirkt,
Kann ich auf beider Dienſte nicht mehr
rechnen.
Walter.
Nun, Herr Dorfrichter? Nun? Und der
Gerichtstag?
Denkt Denkt ihr zu
warten, bis die Haar’ euch wachſen?
Adam.
Ja, wenn ihr mir erlaubt,
ſchick ich auf’s Vorwerk.
Ja, wenn ihr mir
erlaubt, ſchick’ ich auf’s Vorwerk.
Walter.
— Wie weit iſt’s auf das Vorwerk?
Adam.
Ei! Ein kleines
Halbſtündchen.
Walter.
Eine halbe Stunde, was!
Und Eurer Sitzung Stunde ſchlug bereits.
Macht fort,!
iIch muß
noch heute nach Huſſahe.
Macht fort,
ich muß noch heute nach
Huſſahe.
Macht fort!
Ich muß noch heut nach Huſſahe.
Macht fort! Ich muß noch
heut nach Huſſahe.
Adam.
Macht fort! Ja —
Walter.
Ei, ſo pudert euch den Kopf
ein!
Wo Teufel auch, wo ließt ihr die
Perücken?
— Helft euch ſo gut, ihr
könnt. Ich habe Eile.
— Helft euch ſo gut ihr
koͤnnt. Ich habe Eile.
Adam.
Auch das.
Der Büttel /: trit auf
:/
Der Büttel
Hier iſt der Büttel!
Adam.
Kann ich inzwiſchen
Mit einem guten Frühſtück, Wurſt aus
Braunſchweig,
Ein Gläſchen Danziger etwa —
Walter.
Danke ſehr.
25.
Adam
Ohn’ Umſtänd’.
Walter.
Dank’, ihr hört’s, hab’s ſchon
genoſſen.
Geht ihr, und nutzt die Zeit, ich brauche
ſie
In meinem Büchlein etwas mir zu merken.
Adam
Nun, wenn ihr ſo befehlt — Kom̄ Margarethe!
Walter.
— Ihr ſeid ja böſ’ verletzt, Herr Richter
Adam.
Seid ihr gefallen?
Adam.
— Hab’ einen wahren Mordſchlag
Heut früh, als ich dem Bett’ entſtieg,
gethan:
Seht, gnäd’ger Herr Gerichtsrath, einen
Schlag
Ins Zim̄er hin, ich
glaubt’ es wär’ ins Grab.
Walter.
Das thut mir leid. Es wird doch weiter
nicht
Von Folgen ſein?
Adam.
Ich denke nicht. Und auch
In meiner Pflicht ſoll’s weiter mich nicht
ſtören. —
Erlaubt!
Walter.
Geht, geht!
Adam
/: zum Büttel :/
Die Kläger rufſt du — Marſch!
Adam,
die Magd, und der Büttel /: ab :/
Frau Marthe, Eve, Veit, Tümp
Ruprecht
/: treten auf :/Hier beginnt das
Fragment B im Phöbus.
Frau Marthe.
Belehrt hier gütigſt die Juſtiz, ſo binKlärt die
Juſtiz in Huiſum gütigſt auf
Belehrt hier gütigſt
die Juſtiz, ſo bin
Klärt die
Juſtiz in Huiſum gütigſt auf
Klaͤrt die Juſtiz in
Huiſum guͤtigſt auf,
Ich
Und überzeugt, ihr ſeid
ſobald nicht fort,
euch,
gnädger Herr, ihr habt
Ich
überzeugt, ihr ſeid ſobald nicht
fort,
Und
überzeugt euch, gnädger Herr, ihr habt
Und uͤberzeugt euch,
gnaͤd’ger Herr, ihr habt
Ihr noch ſobald
den Rücken nicht gekehrt,
[ ]
Ihr noch
ſobald den Rücken nicht gekehrt,
Ihr noch ſobald den
Ruͤcken nicht gekehrt,
Als ſie auch völlig euch befried’gen
wird;
Doch fändet ihr ſie
heut inm
Amte
Huiſum ſchon
Doch fändet ihr ſie heut
in
Huiſum ſchon
Doch fändet ihr ſie
heut im
Amte ſchon
Doch faͤndet ihr ſie
heut im Amte ſchon
Wie ihr ſie wünſcht, mein Seel, ſo wär’s ein
Wunder,
Da ſie nur dunkel weiß noch, was ihr
wollt.
Walter
Es fehlt an Vorſchriften, ganz recht.
Vielmehr
Es ſind zu viel, man wird ſie ſichten
müſſen.
Adam.
Ja, durch ein großes Sieb. Viel Spreu! Viel
Spreu!
Walter.
Das iſt dort der Herr Schreiber?
Licht.
Der Schreiber Licht,
Zu Ew.uer
hohern Gnaden Dienſten.
Pfingſten
Neun Jahre, daß ich im Juſtizamt bin.
Adam
/: bringt einen Stuhl
:/
Setzt euch.
Walter
Laßt ſein.
Adam
Ihr kom̄t von
Holla ſchon.
Walter
Zwei kleine Meilen — Woher wißt ihr das?
21.
Adam
Woher? Ew. Gnaden Diener —
Licht.
Ein Bauer ſagt’ es,
Der eben jetzt von Holla eingetroffen.
Walter
Ein Bauer?
Adam.
Aufzuwarten.
Walter.
— Ja! Es trug ſich
Dort ein ung
unangenehmer Vorfall ſein zu,
Der mir die heitre Laune ſtörte,
Die in Geſchäfften uns begleiten ſoll. —
Ihr werdet davon unterrichtet ſein?
Adam.
Wär’s wahr, geſtrenger Herr? Der Richter
Pfaul,
Weil er Arreſt in ſeinem Hauſ’ empfieng,
Verzweiflung hätt’ den Thoren
überraſcht,
Er hieng ſich auf?
Walter.
Und machte Übel ärger.
Was nur Unordnung ſchien, Verworrenheit,
Nimt jetzt den Schein an der
Veruntreuung,
Die das Geſetz, ihr wißt’s, nicht mehr
verſchont. —
Wie viele Caſſen habt ihr?
Adam.
Fünf, zu dienen.
Walter
Wie, fuünf! Ich
ſtand im Wahn — Gefüllte Caſſen?
Ich ſtand im Wahn, daß ihr
nur vier —
Adam.
Verzeiht.
Verzeiht!
Mit der Rhein-Inundations-Collecten-Caſſe?
22.
Walter.
Mit der Inundations-Collecten-Caſſe!
Doch jetzo iſt der Rhein nicht inundirt,
Und die Collecten gehn mithin nicht ein.
— Sagt doch, ihr habt ja
wohl gGerichtsrathBKA liest hier statt eines
gestrichenen ›g‹ ein gestrichenes Komma.
heut’?
— Sagt doch, ihr habt ja
wohl Gerichtstag heut?
Adam.
Ob wir —?
Walter.
Was?
Licht.
Ja, den erſten in der Woche.
Walter
Und jene Schaar von Leuten, die ich
draußen
Auf eurem Flure ſah, ſind das —?
Adam.
Das werden —
Licht.
Die Kläger ſind’s, die ſich bereits verſam̄eln.
Walter.
Gut. Dieſer Umſtand iſt mir lieb, ihr
Herren.
Laßt dieſe Leute, wenn’s beliebt,
erſcheinen.
Ich wohne dem Gerichtsgang
bei, ich ſehe,
Ich wohne dem
Gerichtsgang bei; ich ſehe
Wie er in eurem Huiſum
üblich iſt,
Wie er in eurem Huiſum
uͤblich iſt.
Wir nehmen die Regiſtratur, die Caſſen,
Nachher, wenn dieſe Sache abgethan.
Adam
Wie ihr befehlt. — Der Büttel! He!
Hanfriede!
Die zweite Magd
/: trit auf :/
Zweite Magd.
Gruß von Frau Küſterinn, Herr Richter
Adam.
Gruß von Frau
Küſterinn, Herr Richter Adam.
Gruß von Frau
Kuͤſterinn, Herr Richter Adam;
So gern ſie die Perück’ euch auch —
Adam.
Wie? Nicht?
Zweite Magd.
Sie ſagt, es wäre
Morgenpredigt heute,
Sie ſagt, es waͤre
Morgenpredigt heute;
23.
Der Küſter hätte ſelbſt die Eine auf,
Und ſeine Andre wäre unbrauchbar,
Sie ſollte heut zu dem Perückenmacher.
Adam.
Verflucht!
Zweite Magd.
Sobald der Küſter
wiederköm̄t,
BKA liest mit Wortzwischenraum:
›wieder köm̄t‹Lesart mit
oder ohne Wortzwischenraum ist nicht
entscheidbar. Allerdings ist der Abstand
zwischen ›wieder‹ und ›köm̄t‹ deutlich kleiner
als die sonstigen Wortabstände und entspricht
eher den Abständen, die Kleist innerhalb von
Wörtern macht.
liest wie BKA mit
Wortzwischenraum: ›wieder köm̄t‹
Wird ſie jedoch ſogleich euch ſeine
ſchicken.
Adam.
Auf meine Ehre, gnäd’ger Herr —
Walter.
Was giebt’s?
Adam.
Ein Zufall, ein verwünſchter, hat um
beide
Perücken mich gebracht. Und jetzt bleibt
mir
Die dritte aus, die ich mir leihen
wollte:
Ich muß kahlköpfig den Gerichtstag
halten.
Walter.
Kahlköpfig!Erneuter Federwechsel (oder neu beschnittene
Feder).
Adam.
Ja, beim ew’gen
Gott! So ſehr
Ja, beim ewigen Gott! So
ſehr
Ich ohne der Perrücke
Perücke Beiſtand auch
um
Ich ohne der Perrücke
Beiſtand auch
Ich ohne der
Perücke Beiſtand um
Ich ohne der Peruͤcke
Beiſtand um
Mein Richteranſehn auch verlegen bin.
— Ich müßt’ es auf dem Vorwerk noch
verſuchen,
Ob mir vielleicht der Pächter —?
Walter.
Auf dem Vorwerk!
Kann jemand Anders hier im Orte nicht —?
Adam.
Nein, in der That —
Walter.
Der Prediger vielleicht.
Adam
Der Prediger? Der —
Walter.
Oder Schulmeiſter
24.
Adam.
Seit der Sackzehnde abgeſchafft,
hEw
Ew.
Gnaden,
Wozu ich vor’gen Som̄er
hier im
Amte mitgewirkt,
Wozu ich vor’gen
Som̄er mitgewirkt,
Wozu ich hier im
Amte mitgewirkt,
Wozu ich hier im Amte
mitgewirkt,
Kann ich auf beider Dienſte nicht mehr
rechnen.
Walter.
Nun, Herr Dorfrichter? Nun? Und der
Gerichtstag?
Denkt Denkt ihr zu
warten, bis die Haar’ euch wachſen?
Adam.
Ja, wenn ihr mir erlaubt,
ſchick ich auf’s Vorwerk.
Ja, wenn ihr mir
erlaubt, ſchick’ ich auf’s Vorwerk.
Walter.
— Wie weit iſt’s auf das Vorwerk?
Adam.
Ei! Ein kleines
Halbſtündchen.
Walter.
Eine halbe Stunde, was!
Und Eurer Sitzung Stunde ſchlug bereits.
Macht fort,!
iIch muß
noch heute nach Huſſahe.
Macht fort,
ich muß noch heute nach
Huſſahe.
Macht fort!
Ich muß noch heut nach Huſſahe.
Macht fort! Ich muß noch
heut nach Huſſahe.
Adam.
Macht fort! Ja —
Walter.
Ei, ſo pudert euch den Kopf
ein!
Wo Teufel auch, wo ließt ihr die
Perücken?
— Helft euch ſo gut, ihr
könnt. Ich habe Eile.
— Helft euch ſo gut ihr
koͤnnt. Ich habe Eile.
Adam.
Auch das.
Der Büttel /: trit auf
:/
Der Büttel
Hier iſt der Büttel!
Adam.
Kann ich inzwiſchen
Mit einem guten Frühſtück, Wurſt aus
Braunſchweig,
Ein Gläſchen Danziger etwa —
Walter.
Danke ſehr.
25.
Adam
Ohn’ Umſtänd’.
Walter.
Dank’, ihr hört’s, hab’s ſchon
genoſſen.
Geht ihr, und nutzt die Zeit, ich brauche
ſie
In meinem Büchlein etwas mir zu merken.
Adam
Nun, wenn ihr ſo befehlt — Kom̄ Margarethe!
Walter.
— Ihr ſeid ja böſ’ verletzt, Herr Richter
Adam.
Seid ihr gefallen?
Adam.
— Hab’ einen wahren Mordſchlag
Heut früh, als ich dem Bett’ entſtieg,
gethan:
Seht, gnäd’ger Herr Gerichtsrath, einen
Schlag
Ins Zim̄er hin, ich
glaubt’ es wär’ ins Grab.
Walter.
Das thut mir leid. Es wird doch weiter
nicht
Von Folgen ſein?
Adam.
Ich denke nicht. Und auch
In meiner Pflicht ſoll’s weiter mich nicht
ſtören. —
Erlaubt!
Walter.
Geht, geht!
Adam
/: zum Büttel :/
Die Kläger rufſt du — Marſch!
Adam,
die Magd, und der Büttel /: ab :/
Frau Marthe, Eve, Veit, Tümp
Ruprecht
/: treten auf :/Hier beginnt das
Fragment B im Phöbus.
Frau Marthe.
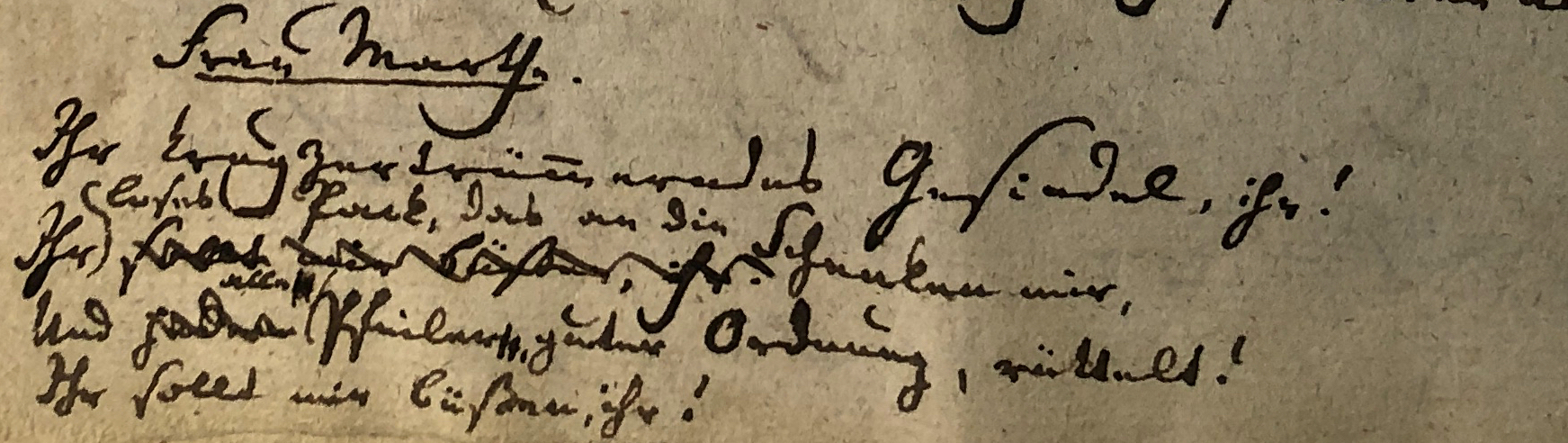 Ihr krugzertrüm̄erndes
Geſindel, ihr!
Ihr ſollt mir büßen, ihr!
loſes Pack, das an die Schenken
mir,
Ihr ſollt mir
büßen, ihr!
Ihr loſes
Pack, das an die Schenken mir,
Ihr loses Pack, das an
die Schenken mir,
Ihr ſollt mir buͤßen,
ihr!
Und jedem
allen Pfeilern, guter Ordnung,
rüttelt!
[ ]
Und jedem Pfeiler
guter Ordnung, rüttelt!
Und
allen
Pfeilern, guter Ordnung,
rüttelt!
Und alle Pfeiler, guter Ordnung,
rüttelt!Es ist nicht
entscheidbar, ob die Korrekturen in Vers 415-1
alle in einem Arbeitsgang oder mit zeitlichen
Unterbrechungen vorgenommen wurden. Insofern kann
die Variante 415-0 b / β auch schon an 415-1 b
angeschlossen haben.
Und jeden Pfeiler
guter Ordnung rüttelt!
[ ]
Ihr ſollt mir büßen,
ihr!
[ ]
Ihr ſollt mir büßen,
ihr!
Ihr sollt mir büſsen,
ihr!
[ ]
26.
Veit.
Sei ſie nur ruhig,
Frau Marth’! Es wird ſich Alles hier
entſcheiden.
Frau Marthe.
O ja. Entſcheiden. Seht doch. Den
Klugſchwätzer.
Den Krug mir, den zerbrochenen,
entſcheiden.
Wer wird mir den
geſchiednen Krug entſcheiden?
Wer wird mir den
geschied’nen Krug entscheiden?
Wer wird mir den
geſchied’nen Krug entſcheiden?
Hier wird entſchieden
werden, daß der Krug
geſchieden
Hier wird entſchieden
werden, daß der Krug
Hier wird
entſchieden werden, daß geſchieden
Hier wird entschieden
werden, daſs geschieden
Hier wird entſchieden
werden, daß geſchieden
Geſchieden
Der Krug
mir bleiben ſoll. Für ſo’n
Schiedsurtheil
Geſchieden
bleiben ſoll. Für ſo’n Schiedsurtheil
Der Krug
mir bleiben ſoll. Für ſo’n
Schiedsurtheil
Der Krug mir bleiben
soll. Für so ’n Schiedsurtheil
Der Krug mir bleiben
ſoll. Fuͤr ſo’n Schiedsurtheil
Geb’ ich noch die geſchied’nen Scherben
nicht.
Veit.
Wenn ſie ſich Recht erſtreiten kann, ſie
hört’s,
Erſetz’ ich ihn.
Frau Marthe.
Er mir den Krug erſetzen.
Wenn ich mir Recht erſtreiten kann,
erſetzen.
Setz’ er den Krug mal hin, verſuch’ er’s
mal,
Setz’ er’n mal hin auf das Geſims!
Erſetzen!
Den Krug, der kein Gebein zum Stehen
hat,
Zum Liegen hat, und
oder
hat und Sitzen hat, erſetzen!
Zum Liegen hat, und
Sitzen hat, erſetzen!
Zum Liegen hat und
Sitzen hat, erſetzen!
Zum Liegen
oder Sitzen hat,
erſetzen!
Zum Liegen hat
und Sitzen hat, erſetzen!
Zum Liegen hat und
Sitzen hat, ersetzen!
Zum Liegen oder Sitzen
hat, erſetzen!
Veit.
Sie hört’s. Was geifert
ſie? Kann man mehrthun?
Sie hört’s. Was geifert
sie? Kann man mehr thun?
Sie hoͤrt’s! Was geifert
ſie? Kann man mehr thun?
Wenn Einer ihr von uns den Krug
zerbrochen,
Soll ſie entſchädigt werden.
Frau Marthe.
Ich entſchädigt!
Als ob ein Stück von meinem Hornvieh
ſpräche.
Meint er, daß die Juſtiz ein Töpfer iſt?
Und kämen die Hochmögenden und bänden
Die Schürze vor, und trügen ihn zum
Ofen,
Die könnten ſonſt was in den Krug mir
thun,
Als ihn entſchädigen. Entſchädigen!
27.
Ruprecht.
Laß er ſie, Vater. Folg’
er mir. Der Drachen!
Laſs er sie, Vater.
Folg’ er mir. Der Drachen!
Laß er ſie, Vater. Folg’
er mir. Der Drache!
S’ iſt der zerbrochne
Krug nicht, der ſie wurmt,
’S ist der zerbrochne
Krug nicht, der sie wurmt,
S’ iſt der zerbrochne
Krug nicht, der ſie wurmt,
Die Hochzeit iſt es, die ein Loch bekom̄en,
Und mit Gewalt hier denkt ſie ſie zu
flicken.
Ich aber ſetze noch den Fuß Eins drauf:
Verflucht bin ich, wenn ich die Metze
nehme.
Frau Marthe
Ihr krugzertrüm̄erndes
Geſindel, ihr!
Ihr ſollt mir büßen, ihr!
loſes Pack, das an die Schenken
mir,
Ihr ſollt mir
büßen, ihr!
Ihr loſes
Pack, das an die Schenken mir,
Ihr loses Pack, das an
die Schenken mir,
Ihr ſollt mir buͤßen,
ihr!
Und jedem
allen Pfeilern, guter Ordnung,
rüttelt!
[ ]
Und jedem Pfeiler
guter Ordnung, rüttelt!
Und
allen
Pfeilern, guter Ordnung,
rüttelt!
Und alle Pfeiler, guter Ordnung,
rüttelt!Es ist nicht
entscheidbar, ob die Korrekturen in Vers 415-1
alle in einem Arbeitsgang oder mit zeitlichen
Unterbrechungen vorgenommen wurden. Insofern kann
die Variante 415-0 b / β auch schon an 415-1 b
angeschlossen haben.
Und jeden Pfeiler
guter Ordnung rüttelt!
[ ]
Ihr ſollt mir büßen,
ihr!
[ ]
Ihr ſollt mir büßen,
ihr!
Ihr sollt mir büſsen,
ihr!
[ ]
26.
Veit.
Sei ſie nur ruhig,
Frau Marth’! Es wird ſich Alles hier
entſcheiden.
Frau Marthe.
O ja. Entſcheiden. Seht doch. Den
Klugſchwätzer.
Den Krug mir, den zerbrochenen,
entſcheiden.
Wer wird mir den
geſchiednen Krug entſcheiden?
Wer wird mir den
geschied’nen Krug entscheiden?
Wer wird mir den
geſchied’nen Krug entſcheiden?
Hier wird entſchieden
werden, daß der Krug
geſchieden
Hier wird entſchieden
werden, daß der Krug
Hier wird
entſchieden werden, daß geſchieden
Hier wird entschieden
werden, daſs geschieden
Hier wird entſchieden
werden, daß geſchieden
Geſchieden
Der Krug
mir bleiben ſoll. Für ſo’n
Schiedsurtheil
Geſchieden
bleiben ſoll. Für ſo’n Schiedsurtheil
Der Krug
mir bleiben ſoll. Für ſo’n
Schiedsurtheil
Der Krug mir bleiben
soll. Für so ’n Schiedsurtheil
Der Krug mir bleiben
ſoll. Fuͤr ſo’n Schiedsurtheil
Geb’ ich noch die geſchied’nen Scherben
nicht.
Veit.
Wenn ſie ſich Recht erſtreiten kann, ſie
hört’s,
Erſetz’ ich ihn.
Frau Marthe.
Er mir den Krug erſetzen.
Wenn ich mir Recht erſtreiten kann,
erſetzen.
Setz’ er den Krug mal hin, verſuch’ er’s
mal,
Setz’ er’n mal hin auf das Geſims!
Erſetzen!
Den Krug, der kein Gebein zum Stehen
hat,
Zum Liegen hat, und
oder
hat und Sitzen hat, erſetzen!
Zum Liegen hat, und
Sitzen hat, erſetzen!
Zum Liegen hat und
Sitzen hat, erſetzen!
Zum Liegen
oder Sitzen hat,
erſetzen!
Zum Liegen hat
und Sitzen hat, erſetzen!
Zum Liegen hat und
Sitzen hat, ersetzen!
Zum Liegen oder Sitzen
hat, erſetzen!
Veit.
Sie hört’s. Was geifert
ſie? Kann man mehrthun?
Sie hört’s. Was geifert
sie? Kann man mehr thun?
Sie hoͤrt’s! Was geifert
ſie? Kann man mehr thun?
Wenn Einer ihr von uns den Krug
zerbrochen,
Soll ſie entſchädigt werden.
Frau Marthe.
Ich entſchädigt!
Als ob ein Stück von meinem Hornvieh
ſpräche.
Meint er, daß die Juſtiz ein Töpfer iſt?
Und kämen die Hochmögenden und bänden
Die Schürze vor, und trügen ihn zum
Ofen,
Die könnten ſonſt was in den Krug mir
thun,
Als ihn entſchädigen. Entſchädigen!
27.
Ruprecht.
Laß er ſie, Vater. Folg’
er mir. Der Drachen!
Laſs er sie, Vater.
Folg’ er mir. Der Drachen!
Laß er ſie, Vater. Folg’
er mir. Der Drache!
S’ iſt der zerbrochne
Krug nicht, der ſie wurmt,
’S ist der zerbrochne
Krug nicht, der sie wurmt,
S’ iſt der zerbrochne
Krug nicht, der ſie wurmt,
Die Hochzeit iſt es, die ein Loch bekom̄en,
Und mit Gewalt hier denkt ſie ſie zu
flicken.
Ich aber ſetze noch den Fuß Eins drauf:
Verflucht bin ich, wenn ich die Metze
nehme.
Frau Marthe
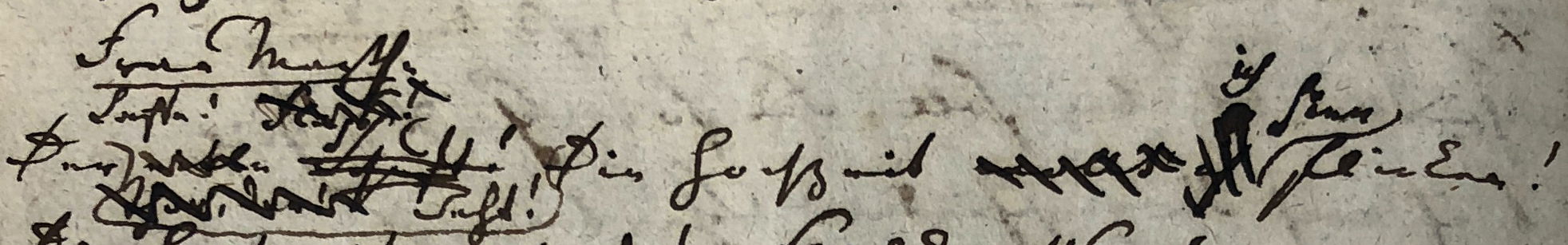 Der eitle
Laffe!Verschiedene Schriftmerkmale sprechen dafür, daß
die Korrekturen ›Laffe!‹ [u. a. aufrechte Position
von ›ff‹], ›Thor, der!‹ [senkrechte Stellung, ›h‹
mit oberer und unterer Schleife], ›Seht‹ [›h‹
ebenfalls senkrecht mit offener oberer und unterer
Schleife] zu den Korrekturen von 1808
(Phöbus-Überarbeitung) zu zählen sind. Das
oberzeilig eingefügte ›ich‹, von der BKA auch der
Phöbusüberarbeitung zugeordnet, ist eher den
Korrekturen in 1806 zuzuordnen. Hierfür sprechen
die stark liegende Schriftlage und die
linksläufige Applikation des ›h‹. (Zum Vergleich:
Vers 64 zeigt das Schriftbild von ›ich‹, wie
Kleist es üblicherweise in 1808 geschrieben hat.)
Auch alle anderen Korrekturen in diesem Vers sind
eher zeitnah zur Entstehung des Manuskripts in
1806 erfolgt. In Abweichung zur Darstellung der
BKA geht diese textgenetische Darstellung davon
aus, daß ›Thor, der! Seht!‹ in einem einzigen
Arbeitsgang eingefügt worden ist. Vgl. Günter
Dunz-Wolff, Kleists Arbeit am Vers. Zu einer neuen
Edition von Kleists Handschrift ›Der zerbrochne
Krug, ein Lustspiel.‹, KJb 2020, xxx.
Schuft!
Flaps!
Thor, der!
Seht! Die Hochzeit wollt’
ich
ich
hier flicken!
Der eitle Schuft! Die
Hochzeit wollt’ ich flicken!
Der eitle Flaps! Die
Hochzeit wollt’ ich flicken!
Der eitle
Flaps! Die Hochzeit ich hier
flicken!
Der Thor, der!
Seht! Die Hochzeit ich hier flicken!
Der Laffe! Seht! Die
Hochzeit ich hier flicken!
Der Laffe! Seht! Die
Hochzeit ich hier flicken!
Der eitle Flaps! Die
Hochzeit ich hier flicken!
Die Hochzeit, nicht des Flickdraths,
unzerbrochen,
Nicht Einen von des Kruges Scherben
werth.
Und ſtünd’ die Hochzeit blankgeſcheuert vor
mir,
Wie noch der Krug auf dem Geſimſe
geſtern,
Der eitle
Laffe!Verschiedene Schriftmerkmale sprechen dafür, daß
die Korrekturen ›Laffe!‹ [u. a. aufrechte Position
von ›ff‹], ›Thor, der!‹ [senkrechte Stellung, ›h‹
mit oberer und unterer Schleife], ›Seht‹ [›h‹
ebenfalls senkrecht mit offener oberer und unterer
Schleife] zu den Korrekturen von 1808
(Phöbus-Überarbeitung) zu zählen sind. Das
oberzeilig eingefügte ›ich‹, von der BKA auch der
Phöbusüberarbeitung zugeordnet, ist eher den
Korrekturen in 1806 zuzuordnen. Hierfür sprechen
die stark liegende Schriftlage und die
linksläufige Applikation des ›h‹. (Zum Vergleich:
Vers 64 zeigt das Schriftbild von ›ich‹, wie
Kleist es üblicherweise in 1808 geschrieben hat.)
Auch alle anderen Korrekturen in diesem Vers sind
eher zeitnah zur Entstehung des Manuskripts in
1806 erfolgt. In Abweichung zur Darstellung der
BKA geht diese textgenetische Darstellung davon
aus, daß ›Thor, der! Seht!‹ in einem einzigen
Arbeitsgang eingefügt worden ist. Vgl. Günter
Dunz-Wolff, Kleists Arbeit am Vers. Zu einer neuen
Edition von Kleists Handschrift ›Der zerbrochne
Krug, ein Lustspiel.‹, KJb 2020, xxx.
Schuft!
Flaps!
Thor, der!
Seht! Die Hochzeit wollt’
ich
ich
hier flicken!
Der eitle Schuft! Die
Hochzeit wollt’ ich flicken!
Der eitle Flaps! Die
Hochzeit wollt’ ich flicken!
Der eitle
Flaps! Die Hochzeit ich hier
flicken!
Der Thor, der!
Seht! Die Hochzeit ich hier flicken!
Der Laffe! Seht! Die
Hochzeit ich hier flicken!
Der Laffe! Seht! Die
Hochzeit ich hier flicken!
Der eitle Flaps! Die
Hochzeit ich hier flicken!
Die Hochzeit, nicht des Flickdraths,
unzerbrochen,
Nicht Einen von des Kruges Scherben
werth.
Und ſtünd’ die Hochzeit blankgeſcheuert vor
mir,
Wie noch der Krug auf dem Geſimſe
geſtern,
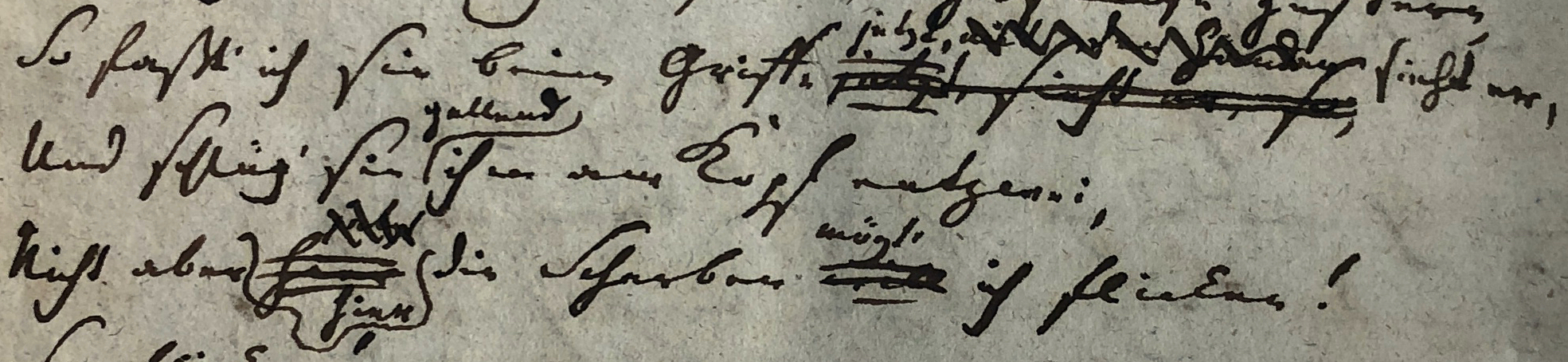 So faßt’ ich
ſie beim Griffe
jetzt,
ſieht er, ſo,
jetzt,
mit den Händen
ſieht er,Anhand der
Schriftmerkmale lassen sich in Vers 450 einzig die
Worte ›sieht er‹ den Phöbuskorrekturen zuordnen (eher
steile Schriftlage sowie senkrecht stehendes ›h‹ mit
offenen Schleifen). Auch das ›e‹ in ›Griffe‹ und das
Komma nach ›jetzt‹ dürften erst 1808 eingefügt worden
sein (Versvariante d). Die Streichungen am Versende
sind in zwei Schritten erfolgt. Zunächst streicht
Kleist das ›jetzt‹, wohl auch um eine Wiederholung im
übernächsten Vers 452 zu vermeiden, wo zunächst das
›hier‹ durch ein ›jetzt‹ ersetzt wird (Variante b).
Möglicherweise ist der Rest des Verses ›sieht er, so,‹
sofort im Anschluss gestrichen worden, so dass aus der
Grundversion direkt die Variante c entstanden wäre.
Diese entspricht der Fassung des Erstdrucks. Die
finale Variante d hat, obwohl im Rahmen der
Phöbus-Korrekturen entstanden, es nicht in die
Phöbus-Fassung geschafft. Stattdessen steht dort die
Grundversion a. — Die textgenetischen Annahmen, die in
der BKA notiert werden, sind insofern sehr fraglich,
als das ›jetzt‹ in ›jetzt, mit den Händen‹ mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht 1808, wie die BKA annimmt,
ergänzt wurde, sondern schon in 1806. Hierfür sprechen
die schräge Schriftlage, das unverschleifte ›z‹
(vergleiche ›Jetzt‹ in Vers 12, das eindeutig in 1808
eingefügt wurde) und im Kontext mit der 1806 ergänzten
und gestrichenen Sequenz ›mit den Händen‹ die
Entsprechung der Schriftgröße, der gleichen Grundlinie
und Strichbeschaffenheit. (Vgl. Günter Dunz-Wolff,
Kleists Arbeit am Vers, KJb 2020, xxx.)
So faßt’ ich ſie
beim Griff jetzt, ſieht er, ſo,
So
faßt’ ich ſie beim Griff, ſieht er, ſo,
So faßt’
ich ſie beim Griff jetzt mit den Händen
So faßt’ ich
ſie beim Griffe jetzt,
ſieht er,
So faſst’ ich
sie beim Griff jetzt, sieht er, so,
So faßt’ ich
ſie beim Griff jetzt mit den Haͤnden,
Und ſchlüg’ ſie gellend ihm am Kopf
entzwei,
Und ſchlüg’ ſie
ihm am Kopf entzwei,
Und ſchlüg’ ſie
gellend ihm am Kopf entzwei,
Und schlüg’ sie gellend
ihm am Kopf entzwei,
Und ſchluͤg’ ſie gellend
ihm am Kopf entzwei,
Nicht aber hier
jetzt
hier die Scherben will
mögt’ ich
flicken!
Nicht aber hier
die Scherben will ich flicken!
Nicht aber
jetzt die Scherben
mögt’ ich flicken!
Nicht aber
hier die Scherben mögt’ ich
flicken!
Nicht aber hier die
Scherben möcht’ ich flicken!
Nicht aber hier die
Scherben moͤcht’ ich flicken!
Sie flicken!
Eve.
Ruprecht!
Ruprecht
Fort du —!
Eve
Liebſter Ruprecht!
Ruprecht.
Mir aus den Augen!
Eve.
Ich beſchwöre dich.
Ruprecht.
Die lüderliche —! Ich mag nicht ſagen,
was.
Eve.
Laß mich ein einz’ges Wort dir heimlich —
Ruprecht.
Nichts!
28.
Eve.
— Du gehſt zum Regimente jetzt, o
Ruprecht,
Dich führt der Krieg, der Him̄el weiß, wohin.
Könnt’ ich dich von der Landmiliz
befreien,
Um eines Fehltritts, in der Angſt
gethan,
Müßt’ ich auf ewig jetzo dich
verlieren?
von dir Abſchied
nehmen?
Ruprecht.
Und ſchickten ſie mich auch zu Schiff hin,
wo
Der Pfeffer wächſt, und müßt’ ich gleich mich
mit
Den Menſchenfreſſern in der Südſee
ſchlagen,
Geh! Auf zweitauſend Meilen wird mir wohl
ſein.
Ich mag nichts von dir wiſſen. Laß mich
ſein.
Frau Marthe.Kleist bricht hier bei der
Abschrift seiner unbekannten Vorlage ab,
streicht den Dialog von Eve und Ruprecht und
schreibt die Verse direkt im Anschluß
neu.
Eve
— Du gehſt zum Regimente jetzt, o
Ruprecht,
Wer weiß, ob ich dich je wwenn du erſt
die Muskete trägſt,
Wer weiß, ob ich dich je
w
Wer weiß, wenn du
erſt die Muskete trägſt,
Wer weiß, wenn du erſt
die Muskete traͤgſt,
Ob ich dich je im
Leben wieder
wiederſehe.
Ob ich dich je im Leben
wiederſehe.
Ob ich dich je im Leben
wieder ſehe.
Ob ich dich je im Leben
wieder ſehe.
Krieg iſt’s, bedenke,
Krieg in dem
den du
ziehſt:
Krieg iſt’s, bedenke, Krieg in
dem du ziehſt:
Krieg iſt’s, bedenke,
Krieg in den du ziehſt:
Krieg iſt’s, bedenke,
Krieg, in den du ziehſt:
Willſt du mit ſolchem Grolle von mir
ſcheiden?
Ruprecht.
Groll? Nein, bewahr mich Gott, das will ich
nicht.
Gott ſchenk’ dir ſo viel Wohlergehn, als
er
So faßt’ ich
ſie beim Griffe
jetzt,
ſieht er, ſo,
jetzt,
mit den Händen
ſieht er,Anhand der
Schriftmerkmale lassen sich in Vers 450 einzig die
Worte ›sieht er‹ den Phöbuskorrekturen zuordnen (eher
steile Schriftlage sowie senkrecht stehendes ›h‹ mit
offenen Schleifen). Auch das ›e‹ in ›Griffe‹ und das
Komma nach ›jetzt‹ dürften erst 1808 eingefügt worden
sein (Versvariante d). Die Streichungen am Versende
sind in zwei Schritten erfolgt. Zunächst streicht
Kleist das ›jetzt‹, wohl auch um eine Wiederholung im
übernächsten Vers 452 zu vermeiden, wo zunächst das
›hier‹ durch ein ›jetzt‹ ersetzt wird (Variante b).
Möglicherweise ist der Rest des Verses ›sieht er, so,‹
sofort im Anschluss gestrichen worden, so dass aus der
Grundversion direkt die Variante c entstanden wäre.
Diese entspricht der Fassung des Erstdrucks. Die
finale Variante d hat, obwohl im Rahmen der
Phöbus-Korrekturen entstanden, es nicht in die
Phöbus-Fassung geschafft. Stattdessen steht dort die
Grundversion a. — Die textgenetischen Annahmen, die in
der BKA notiert werden, sind insofern sehr fraglich,
als das ›jetzt‹ in ›jetzt, mit den Händen‹ mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht 1808, wie die BKA annimmt,
ergänzt wurde, sondern schon in 1806. Hierfür sprechen
die schräge Schriftlage, das unverschleifte ›z‹
(vergleiche ›Jetzt‹ in Vers 12, das eindeutig in 1808
eingefügt wurde) und im Kontext mit der 1806 ergänzten
und gestrichenen Sequenz ›mit den Händen‹ die
Entsprechung der Schriftgröße, der gleichen Grundlinie
und Strichbeschaffenheit. (Vgl. Günter Dunz-Wolff,
Kleists Arbeit am Vers, KJb 2020, xxx.)
So faßt’ ich ſie
beim Griff jetzt, ſieht er, ſo,
So
faßt’ ich ſie beim Griff, ſieht er, ſo,
So faßt’
ich ſie beim Griff jetzt mit den Händen
So faßt’ ich
ſie beim Griffe jetzt,
ſieht er,
So faſst’ ich
sie beim Griff jetzt, sieht er, so,
So faßt’ ich
ſie beim Griff jetzt mit den Haͤnden,
Und ſchlüg’ ſie gellend ihm am Kopf
entzwei,
Und ſchlüg’ ſie
ihm am Kopf entzwei,
Und ſchlüg’ ſie
gellend ihm am Kopf entzwei,
Und schlüg’ sie gellend
ihm am Kopf entzwei,
Und ſchluͤg’ ſie gellend
ihm am Kopf entzwei,
Nicht aber hier
jetzt
hier die Scherben will
mögt’ ich
flicken!
Nicht aber hier
die Scherben will ich flicken!
Nicht aber
jetzt die Scherben
mögt’ ich flicken!
Nicht aber
hier die Scherben mögt’ ich
flicken!
Nicht aber hier die
Scherben möcht’ ich flicken!
Nicht aber hier die
Scherben moͤcht’ ich flicken!
Sie flicken!
Eve.
Ruprecht!
Ruprecht
Fort du —!
Eve
Liebſter Ruprecht!
Ruprecht.
Mir aus den Augen!
Eve.
Ich beſchwöre dich.
Ruprecht.
Die lüderliche —! Ich mag nicht ſagen,
was.
Eve.
Laß mich ein einz’ges Wort dir heimlich —
Ruprecht.
Nichts!
28.
Eve.
— Du gehſt zum Regimente jetzt, o
Ruprecht,
Dich führt der Krieg, der Him̄el weiß, wohin.
Könnt’ ich dich von der Landmiliz
befreien,
Um eines Fehltritts, in der Angſt
gethan,
Müßt’ ich auf ewig jetzo dich
verlieren?
von dir Abſchied
nehmen?
Ruprecht.
Und ſchickten ſie mich auch zu Schiff hin,
wo
Der Pfeffer wächſt, und müßt’ ich gleich mich
mit
Den Menſchenfreſſern in der Südſee
ſchlagen,
Geh! Auf zweitauſend Meilen wird mir wohl
ſein.
Ich mag nichts von dir wiſſen. Laß mich
ſein.
Frau Marthe.Kleist bricht hier bei der
Abschrift seiner unbekannten Vorlage ab,
streicht den Dialog von Eve und Ruprecht und
schreibt die Verse direkt im Anschluß
neu.
Eve
— Du gehſt zum Regimente jetzt, o
Ruprecht,
Wer weiß, ob ich dich je wwenn du erſt
die Muskete trägſt,
Wer weiß, ob ich dich je
w
Wer weiß, wenn du
erſt die Muskete trägſt,
Wer weiß, wenn du erſt
die Muskete traͤgſt,
Ob ich dich je im
Leben wieder
wiederſehe.
Ob ich dich je im Leben
wiederſehe.
Ob ich dich je im Leben
wieder ſehe.
Ob ich dich je im Leben
wieder ſehe.
Krieg iſt’s, bedenke,
Krieg in dem
den du
ziehſt:
Krieg iſt’s, bedenke, Krieg in
dem du ziehſt:
Krieg iſt’s, bedenke,
Krieg in den du ziehſt:
Krieg iſt’s, bedenke,
Krieg, in den du ziehſt:
Willſt du mit ſolchem Grolle von mir
ſcheiden?
Ruprecht.
Groll? Nein, bewahr mich Gott, das will ich
nicht.
Gott ſchenk’ dir ſo viel Wohlergehn, als
er
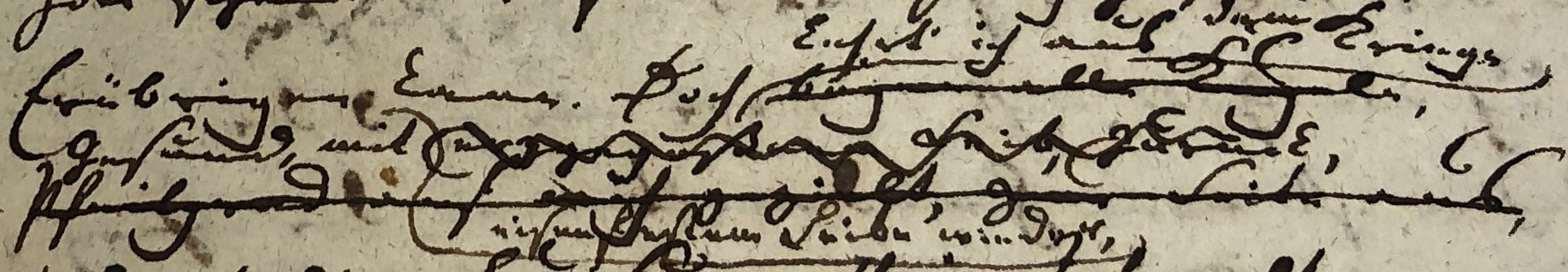 Erübrigen kann. Doch
bögen alle Kugeln,
kehrt’
ich aus dem Kriege
Erübrigen kann. Doch
bögen alle Kugeln,
Erübrigen kann.
Doch kehrt’ ich aus dem Kriege
Eruͤbrigen kann. Doch
kehrt ich aus dem Kriege
Pfeilgrad auf mich gezielt, zur Seite aus,
Geſund,
mit erzgegoßnem Leib,
zurück,
eiſenfeſtem Leibe
wieder,Schriftmerkmale
(steile Schriftlage, deutliche
Vorschwungschleife im ›L‹) und Fehlen in E
sprechen dafür, dass die Korrektur in 1808
(›Phöbus‹) durchgeführt wurde. (In BKA nicht
1808 zugeordnet.)
Pfeilgrad auf mich
gezielt, zur Seite aus,
Geſund, mit
erzgegoßnem Leib, zurück,
Geſund, mit eiſenfeſtem Leibe
wieder,
Geſund, mit erzgegoßnem
Leib zuruͤck,
Und würd’ in Huiſum achtzig Jahre alt,
So ſagt’ ich noch im Tode
zu dir: Metze!
So ſagt ich noch im Tode
zu dir: Metze!
Du wißt
willſt’s ja ſelber vor Gericht
beſchwören.
Du wißt ja ſelber vor
Gericht beſchwören.
Du willſt’s
ja ſelber vor Gericht beſchwören.
Du willſt’s ja ſelber
vor Gericht beſchwoͤren.
Frau Marthe.
/: zu Eve :/
Hinweg! Was ſagt’ ich dir? Willſt du dich
noch
Beſchimpfen
laſſen?, was?Die
fast senkrechte Schriftlage und das Fehlen der
Korrektur in E sprechen für Ausführung in
1808. Der Herr Corporal
Beſchimpfen laſſen?
Der Herr Corporal
Beſchimpfen laſſen, was? Der Herr
Corporal
Beſchimpfen laſſen? Der
Herr Corporal
Iſt was für dich, der würd’ge
Holzgebein,
Der ſeinen Stock im Militair geführt,
29.
Und nicht dort der Maulaffe, der dem
Stock
Jetzt ſeinen Rücken bieten wird. Heut
iſt
Verlobung, Hochzeit, wäre Taufe heute,
Es wär mir recht, und mein Begräbniß leid’
ich,
Wenn ich dem Hochmuth ſeinen
erſt den Kam̄ zertreten,
Wenn ich dem Hochmuth
ſeinen Kam̄ zertreten,
Wenn ich dem Hochmuth
erſt den Kam̄ zertreten,
Wenn ich dem Hochmuth
erſt den Kamm zertreten,
Der mir bis an die Krüge ſchwillet.
Eve.
Mutter!
Laßt doch den Krug! Laßt mich doch in der
Stadt verſuchen,
Ob ein geſchickter
Handwerksmann die Scherben
Ob ein geſchickter
Handwerksmann die Scherben,
Nicht wieder euch zur Luſt zuſam̄enfügt.
Und wär’s um ihn geſchehn, nehmt meine
ganze
Sparbüchſe hin, und kauft euch einen
Neuen.
Wer wollte doch um einen irdnen Krug,
Und ſtam̄t’ er von Herodes her,
Zeiten
her,
Und ſtam̄t’ er von Herodes
her,
Und ſtam̄t’ er von
Herodes Zeiten her,
Und ſtammt er von
Herodes Zeiten her,
Solch einen Aufruhr,
ſoviel Unheil ſtiften.
Solch einen Aufruhr, ſo
viel Unheil ſtiften.
Frau Marthe
Du ſprichſt, wie du’s verſtehſt. Willſt du
etwa
Die Fiedel tragen, Evchen, in der Kirche
Am nächſten Sonntag reuig Buße thun?
Dein guter Name lag in dieſem Topfe,
Und vor der Welt mit
ihm ward er zerſtoßen,
zerſchlagen,Auch
hier spricht die Schriftlage für eine Korrektur im
›Phöbus‹-Kontext in 1808.
Und vor der Welt mit ihm ward er
zerſtoßen,
Und vor der Welt mit ihm ward er
zerſchlagen,
Und vor der
Welt mit ihm ward er zerſtoßen,
Wenn auch vor Gott nicht, und vor mir und
dir.
Der Richter iſt mein Handwerksmann, der
Schergen,
Der Block iſt’s, Peitſchenhiebe, die es
braucht,
Und auf den Scheiterhaufen dasDas ›a‹
in ›das‹ ist nur unvollständig ausgeschrieben.
Geſindel,
Wenn’s unſre Ehre weiß zu brennen gilt,
Und dieſen Krug hier wieder zu
glaſieren.
Erübrigen kann. Doch
bögen alle Kugeln,
kehrt’
ich aus dem Kriege
Erübrigen kann. Doch
bögen alle Kugeln,
Erübrigen kann.
Doch kehrt’ ich aus dem Kriege
Eruͤbrigen kann. Doch
kehrt ich aus dem Kriege
Pfeilgrad auf mich gezielt, zur Seite aus,
Geſund,
mit erzgegoßnem Leib,
zurück,
eiſenfeſtem Leibe
wieder,Schriftmerkmale
(steile Schriftlage, deutliche
Vorschwungschleife im ›L‹) und Fehlen in E
sprechen dafür, dass die Korrektur in 1808
(›Phöbus‹) durchgeführt wurde. (In BKA nicht
1808 zugeordnet.)
Pfeilgrad auf mich
gezielt, zur Seite aus,
Geſund, mit
erzgegoßnem Leib, zurück,
Geſund, mit eiſenfeſtem Leibe
wieder,
Geſund, mit erzgegoßnem
Leib zuruͤck,
Und würd’ in Huiſum achtzig Jahre alt,
So ſagt’ ich noch im Tode
zu dir: Metze!
So ſagt ich noch im Tode
zu dir: Metze!
Du wißt
willſt’s ja ſelber vor Gericht
beſchwören.
Du wißt ja ſelber vor
Gericht beſchwören.
Du willſt’s
ja ſelber vor Gericht beſchwören.
Du willſt’s ja ſelber
vor Gericht beſchwoͤren.
Frau Marthe.
/: zu Eve :/
Hinweg! Was ſagt’ ich dir? Willſt du dich
noch
Beſchimpfen
laſſen?, was?Die
fast senkrechte Schriftlage und das Fehlen der
Korrektur in E sprechen für Ausführung in
1808. Der Herr Corporal
Beſchimpfen laſſen?
Der Herr Corporal
Beſchimpfen laſſen, was? Der Herr
Corporal
Beſchimpfen laſſen? Der
Herr Corporal
Iſt was für dich, der würd’ge
Holzgebein,
Der ſeinen Stock im Militair geführt,
29.
Und nicht dort der Maulaffe, der dem
Stock
Jetzt ſeinen Rücken bieten wird. Heut
iſt
Verlobung, Hochzeit, wäre Taufe heute,
Es wär mir recht, und mein Begräbniß leid’
ich,
Wenn ich dem Hochmuth ſeinen
erſt den Kam̄ zertreten,
Wenn ich dem Hochmuth
ſeinen Kam̄ zertreten,
Wenn ich dem Hochmuth
erſt den Kam̄ zertreten,
Wenn ich dem Hochmuth
erſt den Kamm zertreten,
Der mir bis an die Krüge ſchwillet.
Eve.
Mutter!
Laßt doch den Krug! Laßt mich doch in der
Stadt verſuchen,
Ob ein geſchickter
Handwerksmann die Scherben
Ob ein geſchickter
Handwerksmann die Scherben,
Nicht wieder euch zur Luſt zuſam̄enfügt.
Und wär’s um ihn geſchehn, nehmt meine
ganze
Sparbüchſe hin, und kauft euch einen
Neuen.
Wer wollte doch um einen irdnen Krug,
Und ſtam̄t’ er von Herodes her,
Zeiten
her,
Und ſtam̄t’ er von Herodes
her,
Und ſtam̄t’ er von
Herodes Zeiten her,
Und ſtammt er von
Herodes Zeiten her,
Solch einen Aufruhr,
ſoviel Unheil ſtiften.
Solch einen Aufruhr, ſo
viel Unheil ſtiften.
Frau Marthe
Du ſprichſt, wie du’s verſtehſt. Willſt du
etwa
Die Fiedel tragen, Evchen, in der Kirche
Am nächſten Sonntag reuig Buße thun?
Dein guter Name lag in dieſem Topfe,
Und vor der Welt mit
ihm ward er zerſtoßen,
zerſchlagen,Auch
hier spricht die Schriftlage für eine Korrektur im
›Phöbus‹-Kontext in 1808.
Und vor der Welt mit ihm ward er
zerſtoßen,
Und vor der Welt mit ihm ward er
zerſchlagen,
Und vor der
Welt mit ihm ward er zerſtoßen,
Wenn auch vor Gott nicht, und vor mir und
dir.
Der Richter iſt mein Handwerksmann, der
Schergen,
Der Block iſt’s, Peitſchenhiebe, die es
braucht,
Und auf den Scheiterhaufen dasDas ›a‹
in ›das‹ ist nur unvollständig ausgeschrieben.
Geſindel,
Wenn’s unſre Ehre weiß zu brennen gilt,
Und dieſen Krug hier wieder zu
glaſieren.
ᚨNachträgliche Markierung für eine Einfügung. Diese ist auf einem Zettel notiert, der auf der gegenüberliegenden Seite 30 mit Sigellack befestigt ist. Der Eintrag auf dem Zettel lautet: › ᚨ C. Fünfter Auftritt.‹ Kleists Szenengliederung war offensichtlich noch eine andere als die, die später in E zur Anwendung gekommen ist. In E beginnt hier der ›Siebente Auftritt‹. C. Fünfter Auftritt.
Adam /: im Ornat, doch ohne Perücke, trit auf :/ Adam /: für ſich :/ Ei, Evchen! — Sieh! Und der vierſchröt’ge Schlingel, dort, Ei, Evchen! — Und der vierſchröt’ge Schlingel dort, Ei, Evchen! Sieh! Und der vierſchröt’ge Schlingel, Ei, Evchen sieh! Und der vierschröt’ge Schlingel, Ei, Evchen. Sieh! Und der vierſchroͤt’ge Schlingel, 30. Der Ruprecht! Ei, was Teufel, und die Anderen — ſieh! Die ganze Sippſchaft! Der Ruprecht! Ei, was Teufel und die Anderen — Der Ruprecht! Ei, was Teufel, ſieh! Die ganze Sippſchafft! Der Ruprecht! Ei, was Teufel, sieh! Die ganze Sippschaft! Der Ruprecht! Ei, was Teufel, ſieh! die ganze Sippſchaft! — Die werden mich doch nicht bei mir verklagen? Eve. O liebſte Mutter, folgt mir, ich beſchwör’ euch, Laßt dieſem Unglückszim̄er Ort des Unheils uns entfliehen! Laßt dieſem Unglückszim̄er uns entfliehen! Laßt dieſem Ort des Unheils uns entfliehen! Laſst diesem Ort des Unheils uns entfliehn! Laßt dieſem Ungluͤckszimmer uns entfliehen! Adam Gevatter! Sagt mir doch,. wWas bringen die? Gevatter! Sagt mir doch, was bringen die? Gevatter! Sagt mir doch. Was bringen die? Gevatter! sagt mir doch. Was bringen die? Gevatter! Sagt mir doch, was bringen die? Licht. Was weiß ich? Lärm um nichts. Lappalien. Was weiß ich? Lärm um nichts. Lappalien. Was weiſs ich? Lärm um nichts. Lappalien. Was weiß ich? Laͤrm um nichts; Lappalien. Es iſt ein Krug zerbrochen worden, hör’ ich. Adam. Ein Krug! So! Ei! — Ei, wer zerbrach den Krug? Licht Wer ihn zerbrochen? Adam. Ja, Gevatterchen. Licht. Mein Seel!, Sſetzt euch: ſo werdet ihr’s erfahren. Mein Seel! Setzt euch: ſo werdet ihr’s erfahren. Mein Seel, ſetzt euch: ſo werdet ihr’s erfahren. Mein Seel, setzt euch: so werdet ihr’s erfahren. Mein Seel, ſetzt euch: ſo werdet ihr’s erfahren. Adam /: heiumlich :/ Evchen! Evchen. Evchen! Eve. /: gleichfalls :/ Geh er. Adam. Ein Wort. Eve. Ich will nichts wiſſen. Adam. Was bringt ihr mir? Eve Ich ſag’ ihm, er ſoll dgehn. Adam Evchen! Ich bitte dich! Was ſoll mir das bedeuten? Eve. Wenn er nicht gleich —! Ich ſag’s ihm, laß er mich. 31. Adam /: zu Licht :/ Gevatter, hört, mein Seel, ich halt’s nicht aus. Die Wund’ am Schienbein macht mir Übelkeiten, Die Wund’ am Schienbein macht mir Übelkeiten, Die Wund’ am Schienbein macht mir Uebelkeiten; Führt ihr die Sach’, ich will zu Bette gehn. Führt ihr die Sach; ich muſs zu Bette gehn. Fuͤhrt ihr die Sach’, ich will zu Bette gehn. Licht. Zu Bett —? Ihr wollt —? Ich glaub’, ihr ſeid verrückt. Adam. Der Henker hol’s. Ich muß mich übergeben. Licht. Ich glaub’, ihr raſ’t, im Ernſt,. ihr raſ’t. So eben kom̄t ihr — Ich glaub’, im Ernſt, ihr raſ’t. So eben kom̄t ihr — Ich glaub’, ihr raſ’t, im Ernſt. So eben kom̄t ihr — Ich glaub', ihr ras't, im Ernst. So eben kommt ihr — Ich glaub, ihr raſ’t, im Ernſt. So eben kommt ihr —? — Meinthalben,. ſSagt’s dem Herrn Gerichtsrath dort. — Meinthalben, ſagt’s dem Herrn Gerichtsrath dort. — Meinthalben. Sagt’s dem Herrn Gerichtsrath dort. Meinthalben. Sagt’s dem Herrn Gerichtsrath dort. — Meinthalben. Sagt’s dem Herrn Gerichtsrath dort. Vielleicht erlaubt er’s. nicht. — Ich weiß nicht, was euch fehlt. Vielleicht erlaubt er’s nicht. — Ich weiß nicht, was euch fehlt. Vielleicht erlaubt er’s. — Ich weiß nicht, was euch fehlt. Vielleicht erlaubt er’s. — Ich weiſs nicht, was euch fehlt. Vieleicht erlaubt er’s. — Ich weiß nicht, was euch fehlt? Adam /: wieder zu Even :/ Evchen! Ich flehe dich! Um alle Wunden! Was wollt ihr Alle hier? iſt’s, das ihr mir bringt? Was wollt ihr Alle hier? Was iſt’s, das ihr mir bringt? Was ist’s, das ihr mir bringt? Was iſt’s, das ihr mir bringt? Eve. Er wird’s ſchon hören.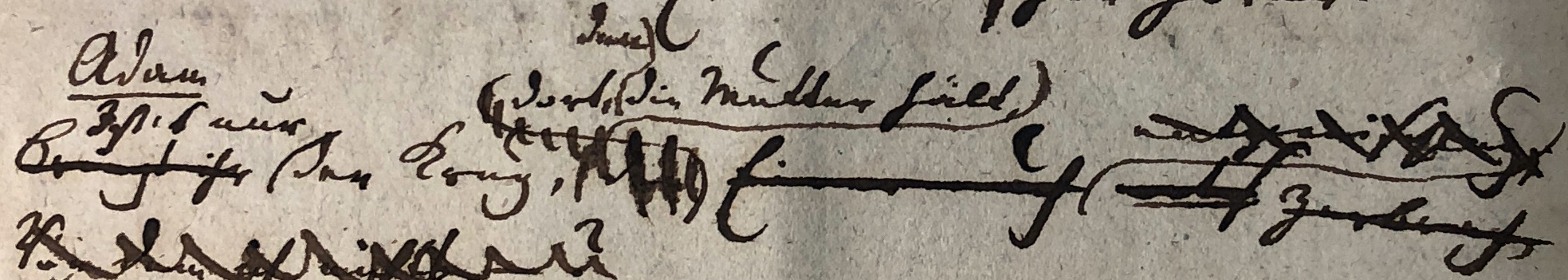 Adam
Bringt ihr
Iſt’s
nur denr Krug, den
dort,
den die
Mutter hält,
Einer euch
entſentzweiſchlug,
zerbrach,Für Hans
Zeller ist der ›genetische Prozeß‹ von Vers 523
›mehrdeutig‹, da aus seiner Sicht ›aus den graphischen
Indizien‹ nicht zu entscheiden sei, ob die ›Variante
„Ist’ ...“ vor oder nach der Variante „dort“
eingetreten ist‹ (vgl. Zeller, Zur Neuedition des
›Zerbrochnen Krugs‹ in der Brandenburger Ausgabe. In:
KJb 1996, 245f). Eine genauere Analyse der graphischen
Indizien dieses Verses zeigt allerdings, daß viele
Schriftmerkmale, wie Strichspannung und -stärke, die
Schriftlage und -ausdehnung und die Längen in der
Mittelzone (Minuskeln) der beiden Einfügungen ›Ist’s
nur‹ und ›dort die Mutter hält‹ übereinstimmen. Hinzu
kommen Ähnlichkeit der Streichungen von ›Bringt ihr‹,
›Einer euch‹ und ›zerbrach‹ (jeweils horizontale
Linie), was die Annahme einer gleichzeitigen Korrektur
unterstützt und von Zellers vier alternativen,
textgenetischen Darstellungen nur die Darstellung
zuließe, die der unseren entspräche. Ausführlich
hierzu im Anhang ›Textgenetische Problemfälle‹, hier
S. 215–220.
Bringt ihr den
Krug, den Einer euch entſentzweiſchlug,
Bringt
ihr den Krug, den Einer euch
zerbrach,
Iſt’s
nur der Krug, den
dort die Mutter hält,
Iſt’s nur der Krug, dort,
den die Mutter hält,
Ist’s nur der
Krug dort, den die Mutter hält,
Iſt’s nur der
Krug dort, den die Mutter haͤlt,
Adam
Bringt ihr
Iſt’s
nur denr Krug, den
dort,
den die
Mutter hält,
Einer euch
entſentzweiſchlug,
zerbrach,Für Hans
Zeller ist der ›genetische Prozeß‹ von Vers 523
›mehrdeutig‹, da aus seiner Sicht ›aus den graphischen
Indizien‹ nicht zu entscheiden sei, ob die ›Variante
„Ist’ ...“ vor oder nach der Variante „dort“
eingetreten ist‹ (vgl. Zeller, Zur Neuedition des
›Zerbrochnen Krugs‹ in der Brandenburger Ausgabe. In:
KJb 1996, 245f). Eine genauere Analyse der graphischen
Indizien dieses Verses zeigt allerdings, daß viele
Schriftmerkmale, wie Strichspannung und -stärke, die
Schriftlage und -ausdehnung und die Längen in der
Mittelzone (Minuskeln) der beiden Einfügungen ›Ist’s
nur‹ und ›dort die Mutter hält‹ übereinstimmen. Hinzu
kommen Ähnlichkeit der Streichungen von ›Bringt ihr‹,
›Einer euch‹ und ›zerbrach‹ (jeweils horizontale
Linie), was die Annahme einer gleichzeitigen Korrektur
unterstützt und von Zellers vier alternativen,
textgenetischen Darstellungen nur die Darstellung
zuließe, die der unseren entspräche. Ausführlich
hierzu im Anhang ›Textgenetische Problemfälle‹, hier
S. 215–220.
Bringt ihr den
Krug, den Einer euch entſentzweiſchlug,
Bringt
ihr den Krug, den Einer euch
zerbrach,
Iſt’s
nur der Krug, den
dort die Mutter hält,
Iſt’s nur der Krug, dort,
den die Mutter hält,
Ist’s nur der
Krug dort, den die Mutter hält,
Iſt’s nur der
Krug dort, den die Mutter haͤlt,
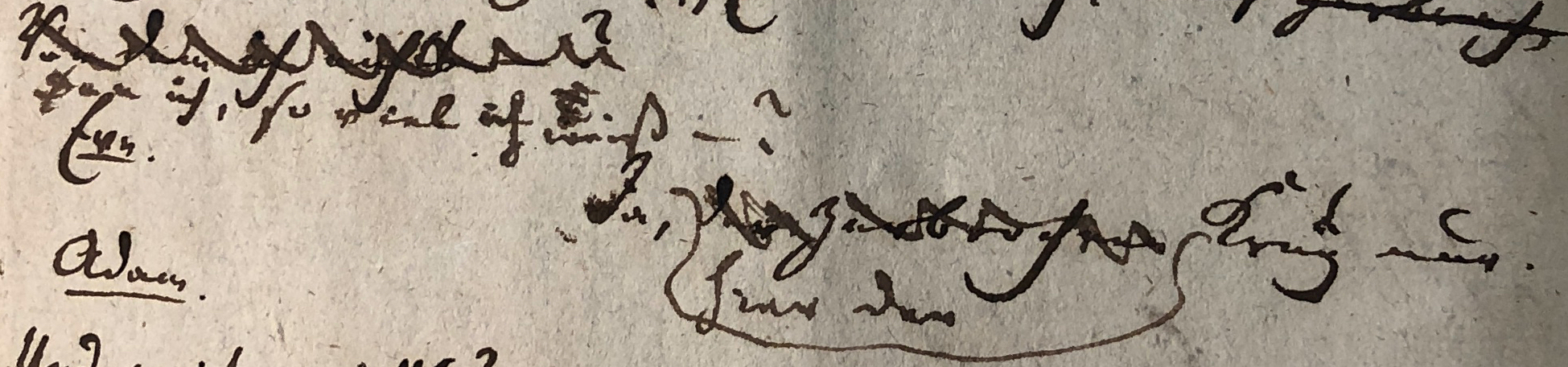 Von dem
ich nichts —?
Den ich, ſo viel —ich?
weiß
—?
Von dem ich nichts
—?
Den ich, ſo viel
—?
Den ich, ſo viel
ich
weiß —?
Den ich, so viel ich
weiſs —?
Den ich ſo viel —?
Eve.
Ja, der zerbrochene
hier der Krug
nur.
Ja, der
zerbrochene Krug nur.
Ja, hier der Krug
nur.
Ja, hier der Krug
nur.
Ja, der zerbrochne Krug
nur.
Adam.
Und weiter nichts?
Eve.
Nichts weiter.
Adam.
Nichts? Gewiß
nicht?
Nichts? Gewiſs nicht
Nichts? Gewiß
nichts?
Eve.
Ich ſag’ ihm, geh er. Laß er mich
zufrieden.
Adam.
Hör du, bei Gott, ſei klug, ich rath’ es
dir.
Eve.
Er, Unverſchämter!
32.
Adam.
In dem Atteſt ſteht
Der Name jetzt, Fracturſchrifft,
Ruprecht Tümpel.
Hier trag’ ich’s fix und
fertig in der Taſche.
Hier trag’ ichs fix und
fertig in der Tasche.
Hier trag’ ich’s fix und
fertig in der Taſche;
Hörſt du es knackern, Evchen? Sieh, das
kannſt du,
AufBei meiner
Ehr’,Treu, heut über’s Jahr dir holen,
Auf meine
Ehr’, heut über’s Jahr dir holen,
Bei meiner
Treu, heut über’s Jahr
dir holen,
Bei meiner Treu, heut
über’s Jahr dir holen,
Auf meine Ehr’, heut
uͤbers Jahr dir holen.
Dir Trauerſchürz’ und
Mieder zuzuſchneiden,
Die Trauerschürz, und
Mieder zuzuschneiden,
Dir Trauerſchuͤrz’ und
Mieder zuzuſchneiden,
Wenn’s heißt,: der Ruprecht in
Batavia
Krepirt’ — ich weiß, an welchem Fieber
nicht,
War’s gelb, war’s ſchl ſcharlach,
oder war es faul.
Walter.
Sprecht nicht mit den
Parthein, Herr Richter Adam,
Vor der Seſſion! Hier,
ſetzt euch, und befragt ſie.
Vor der Session! Hier
setzt euch, und befragt sie.
Vor der Seſſion! Hier
ſetzt euch, und befragt ſie.
Adam.
Was ſagt er? — Was befehlen Ew. Gnaden?
Walter.
Was ich befehl’? — Ich ſagte deutlich
euch,
Daß ihr nicht heimlich vor der Sitzung
ſollt
Mit den Parthein zweideut’ge Sprache
führen.
Hier iſt der Platz, der eurem Amt
gebührt,
Und öffentlich Verhör, was ich erwarte.
Adam
/: für ſich :/
Verflucht! Ich kann mich
nicht entſchließen —
Verflucht! Ich kann mich
nicht dazu entschlieſsen —
Verflucht! Ich kann mich
nicht dazu entſchließen —!
— Es klirrte etwas, da ich
Abſchied nahm:
— Es klirrte etwas, da
ich Abschied nahm:
— Es klirrte etwas, da
ich Abſchied nahm —
Licht
/: ihn aufſchreckend
:/
Herr Richter! Seid ihr —?
Adam.
Ich? Auf Ehre — ich
nicht!Möglich
ist, dass es sich hier um eine Sofortkorrektur
Kleists gehandelt hat, er also statt ›nicht‹ in
der Abschrift zunächst ›ich‹ geschrieben hat. Dann
würde die Vers-Variante b
entfallen.
Ich? Auf Ehre — ich
Ich? Auf Ehre
nicht!
Ich? Auf Ehre nicht?
Ich? Auf Ehre nicht!
Ich hatte ſie behutſam drauf gehängt,
Und müßt’ ein Ochs geweſen ſein —
Licht.
Was?
33.
Adam.
Was?
Licht.
Ich fragte —!
Ich fragte —!
Ich fragte —?
Adam
Ihr fragtet, ob ich —?
Licht.
Ob ihr taub ſeid, fragt’ ich.
Dort Sr. Gnaden haben euch gerufen.
Adam.
Ich glaubte —! Wer ruft?
Ich glaubte —! Wer
ruft?
Ich glaubte —? Wer
ruft?
Licht.
Der Herr Gerichtsrath dort.
Adam
/: für ſich :/
Ei! Hol’s der Henker auch! Zwei Fälle
giebt’s,
Mein Seel, nicht mehr, und wenn’s nicht
biegt, ſo bricht’s.
— Gleich! Gleich! Gleich! Was befehlen Ew.
Gnaden?
Soll jetzt die Procedur beginnen?
Walter.
Ihr ſeid ja ſonderbar zerſtreut. Was fehlt
euch?
Adam.
A — Auf Ehr’!
Verzeiht. Es hat ein Perlhuhn mir,
Von dem
ich nichts —?
Den ich, ſo viel —ich?
weiß
—?
Von dem ich nichts
—?
Den ich, ſo viel
—?
Den ich, ſo viel
ich
weiß —?
Den ich, so viel ich
weiſs —?
Den ich ſo viel —?
Eve.
Ja, der zerbrochene
hier der Krug
nur.
Ja, der
zerbrochene Krug nur.
Ja, hier der Krug
nur.
Ja, hier der Krug
nur.
Ja, der zerbrochne Krug
nur.
Adam.
Und weiter nichts?
Eve.
Nichts weiter.
Adam.
Nichts? Gewiß
nicht?
Nichts? Gewiſs nicht
Nichts? Gewiß
nichts?
Eve.
Ich ſag’ ihm, geh er. Laß er mich
zufrieden.
Adam.
Hör du, bei Gott, ſei klug, ich rath’ es
dir.
Eve.
Er, Unverſchämter!
32.
Adam.
In dem Atteſt ſteht
Der Name jetzt, Fracturſchrifft,
Ruprecht Tümpel.
Hier trag’ ich’s fix und
fertig in der Taſche.
Hier trag’ ichs fix und
fertig in der Tasche.
Hier trag’ ich’s fix und
fertig in der Taſche;
Hörſt du es knackern, Evchen? Sieh, das
kannſt du,
AufBei meiner
Ehr’,Treu, heut über’s Jahr dir holen,
Auf meine
Ehr’, heut über’s Jahr dir holen,
Bei meiner
Treu, heut über’s Jahr
dir holen,
Bei meiner Treu, heut
über’s Jahr dir holen,
Auf meine Ehr’, heut
uͤbers Jahr dir holen.
Dir Trauerſchürz’ und
Mieder zuzuſchneiden,
Die Trauerschürz, und
Mieder zuzuschneiden,
Dir Trauerſchuͤrz’ und
Mieder zuzuſchneiden,
Wenn’s heißt,: der Ruprecht in
Batavia
Krepirt’ — ich weiß, an welchem Fieber
nicht,
War’s gelb, war’s ſchl ſcharlach,
oder war es faul.
Walter.
Sprecht nicht mit den
Parthein, Herr Richter Adam,
Vor der Seſſion! Hier,
ſetzt euch, und befragt ſie.
Vor der Session! Hier
setzt euch, und befragt sie.
Vor der Seſſion! Hier
ſetzt euch, und befragt ſie.
Adam.
Was ſagt er? — Was befehlen Ew. Gnaden?
Walter.
Was ich befehl’? — Ich ſagte deutlich
euch,
Daß ihr nicht heimlich vor der Sitzung
ſollt
Mit den Parthein zweideut’ge Sprache
führen.
Hier iſt der Platz, der eurem Amt
gebührt,
Und öffentlich Verhör, was ich erwarte.
Adam
/: für ſich :/
Verflucht! Ich kann mich
nicht entſchließen —
Verflucht! Ich kann mich
nicht dazu entschlieſsen —
Verflucht! Ich kann mich
nicht dazu entſchließen —!
— Es klirrte etwas, da ich
Abſchied nahm:
— Es klirrte etwas, da
ich Abschied nahm:
— Es klirrte etwas, da
ich Abſchied nahm —
Licht
/: ihn aufſchreckend
:/
Herr Richter! Seid ihr —?
Adam.
Ich? Auf Ehre — ich
nicht!Möglich
ist, dass es sich hier um eine Sofortkorrektur
Kleists gehandelt hat, er also statt ›nicht‹ in
der Abschrift zunächst ›ich‹ geschrieben hat. Dann
würde die Vers-Variante b
entfallen.
Ich? Auf Ehre — ich
Ich? Auf Ehre
nicht!
Ich? Auf Ehre nicht?
Ich? Auf Ehre nicht!
Ich hatte ſie behutſam drauf gehängt,
Und müßt’ ein Ochs geweſen ſein —
Licht.
Was?
33.
Adam.
Was?
Licht.
Ich fragte —!
Ich fragte —!
Ich fragte —?
Adam
Ihr fragtet, ob ich —?
Licht.
Ob ihr taub ſeid, fragt’ ich.
Dort Sr. Gnaden haben euch gerufen.
Adam.
Ich glaubte —! Wer ruft?
Ich glaubte —! Wer
ruft?
Ich glaubte —? Wer
ruft?
Licht.
Der Herr Gerichtsrath dort.
Adam
/: für ſich :/
Ei! Hol’s der Henker auch! Zwei Fälle
giebt’s,
Mein Seel, nicht mehr, und wenn’s nicht
biegt, ſo bricht’s.
— Gleich! Gleich! Gleich! Was befehlen Ew.
Gnaden?
Soll jetzt die Procedur beginnen?
Walter.
Ihr ſeid ja ſonderbar zerſtreut. Was fehlt
euch?
Adam.
A — Auf Ehr’!
Verzeiht. Es hat ein Perlhuhn mir,
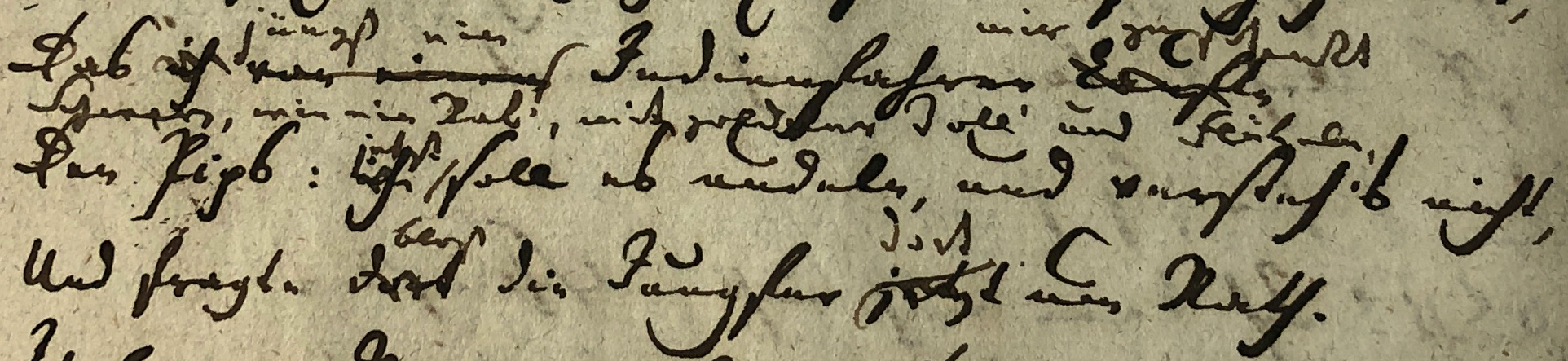 Das ich
von einem
jüngſt ein
Indienfahrer kaufte
mir
geſchenktWie an den unterschiedlichen
Durchsteichungen zu erkennen, sind in der Sentenz ›ich
von einem‹ zunächst das ›ich‹ (zusammen mit ›kaufte‹
am Versende), später das ›von einem‹ gestrichen
worden. Alle Änderungen der Verse 559–561 sind 1808
durchgeführt worden, erkennbar an der steileren
Schriftlage und der Schlingenbildung in den
Unterlängen von g und h. Entsprechend sind die
Änderungen in die Phöbusfassung eingegangen, der
Erstdruck zeigt die Fassung der
Grundschicht.
Das ich
von einem Indienfahrer kaufte
Das von einem
Indienfahrer mir geſchenkt
Das jüngſt
ein Indienfahrer mir geſchenkt
Das jüngst ein
Indienfahrer mir geschenkt,
Das ich von
einem Indienfahrer kaufte,
Schwarz, wie ein Rab’, mit
goldner
gold’ner Ein Apostroph ist selbst in großer
Vergrößerung nicht erkennbar. Auch im
Phöbusdruck steht nur ›goldner‹.
gold’ner
Toll’ und Flügeln,
Schwarz, wie ein
Rab’, mit goldner Toll und Flügeln,
[keine
Entsprechung]
Den Pips: ich
jetzt ſoll es nudeln,
und verſteh’s nicht,
Den Pips:
ich ſoll es nudeln, und verſteh’s
nicht,
Den Pips: jetzt
ſoll esKleist
vergißt offensichtlich, in der Korrektur
zusätzlich das ›es‹ durch ›ich’s‹ zu ersetzen. In
der Phöbusfassung dann richtig. nudeln, und
verſteh’s nicht,
Den Pips: jetzt soll
ich’s nudeln, und versteh’s nicht.
Den Pips: ich ſoll es
nudeln, und verſteh’s nicht,
Und fragte dort
bloß die Jungfer jetzt
dort um
Rath.
Und fragte
dort die Jungfer jetzt um Rath.Die
Textgenese ist nicht so eindeutig zu bestimmen wie
BKA (BKA I/3, 291) und HAM (S. 144) es nahelegen,
dass die Variante a ›Und fragte dort die Jungfer
jetzt um Rath.‹ in einem einzigen Korrekturgang in
die Variante c geändert worden sei, wofür
Schriftmerkmale und Form der Streichungen durchaus
sprechen könnten. Unberücksichtigt bleibt bei
dieser Annahme die Einfügungsklammer, mit der das
einzufügende ›dort‹ vor ›jetzt‹ platziert werden
soll. Da Kleist am Versanfang auf eine
Einfügemarke verzichtet, muss diese vor ›jetzt‹
eine Funktion gehabt haben. Insofern kann davon
ausgegangen werden, dass ›jetzt‹ zunächst nicht
gestrichen, sondern zu einem ›dort jetzt‹
erweitert wurde. Wenn aber am Versende ›dort‹
hinzugefügt wird, muss es gleichzeitig am
Versanfang gestrichen worden sein, wie in
Variante b dargestellt: ›Und fragte die Jungfer
dort jetzt um Rath.‹ Erst in einer weiteren
Änderung ist dann die endgültige Variante c
entstanden. Für E kommt es zu einer erneuten
Umstellung von ›bloß‹ und ›dort‹.
Und fragte die Jungfer
dort
jetzt um Rath.
Und fragte bloß
die Jungfer dort um Rath.
Und fragte blos die
Jungfer dort um Rath.
Und fragte dort die
Jungfer bloß um Rath.
Ich bin ein Narr in ſolchen Dingen,
ſeht,
Und meine Hühner nenn’ ich ich meine Kinder.
Walter
Hier. Setzt euch. Ruft den
Kläger und vernehmt ihn:
Und ihr, Herr Schreiber
führt das Protokoll.
Und ihr, Herr Schreiber,
führt das Protocoll.
Und ihr, Herr Schreiber,
fuͤhrt das Protokoll.
Adam.
Befehlen Ew. Gnaden den Proceß
Nach den Formalitäten, oder ſo,
Wie er in Huiſum üblich iſt, zu halten?
34.
Walter.
Nach den geſetzlichen
Formalitäten.
Nach den gesetzlichen
Formalitäten:
Nach den geſetzlichen
Formalitaͤten,
Wie er in Huiſum üblich iſt,
So, wie er hier wird üblich
ſein, nicht anders.
Wie er in Huiſum
üblich iſt, nicht anders.
So, wie er hier wird üblich
ſein, nicht anders.
So, wie er hier wird
üblich sein, nicht anders.
Wie er in Huiſum uͤblich
iſt, nicht anders.
Adam.
Gut, gut. Ich werd’ euch zu bedienen
wiſſen.
Seid ihr bereit, Herr Schreiber?
Licht.
Zu euren Dienſten.
Adam.
— So nim̄,
Gerechtigkeit, denn deinen Lauf!
Klägere trete vor.
Frau Marthe
Hier, Herr Dorfrichter!
Adam.
Wer ſeid ihr?
Frau Marthe.
Wer —?
Adam
Ihr.
Frau Marthe
Wer ich —?
Adam.
Wer ihr ſeid!
Wes Namens, NStandes, Wohnorts, und
ſo weiter.
Frau Marthe.
Ich glaub’, er ſpaßt, Herr
Richter.
Ich glaub’ er spaſst,
Herr Richter.
Ich glaub’, er ſpaßt,
Herr Richter.
Adam.
Spaßen, was!
Ich ſitz’ im Namen der Juſtiz, Frau
Marthe,
Und die Juſtiz muß wiſſen, wer ihr ſeid.
Licht
/: halblaut :/
Laßt doch die ſonderbare Frag’ —
Frau Marthe
Ihr kuckt
Mir alle Sonntag in die Fenſter ja,
Wenn ihre auf’s Vorwerk geht.
Wenn ihr auf’s Vorwerk
geht.
Wenn ihr auf’s Vorwerk
geht!
35.
Walter.
Kennt ihr die Frau?
Adam.
Sie wohnt hier um die Ecke, Ew. Gnaden,
Wenn man den Fußſteig durch die Hecken
geht;
Wittw’ eines Caſtellans, Hebam̄e jetzt,
Sonſt eine ehrliche Frau, von gutem
Rufe.
Walter
Wenn ihr ſo unterrichtet ſeid, Herr
Richter,
So ſind dergleichen Fragen überflüſſig.
Setzt ihren Namen in das Protokoll,
Und ſchreibt dabei: dem Amte
wohlbekannt.
Adam.
Auch das. Ihr ſeid nicht für
Formalitäten.
Thut ſo, wie Sr. Gnaden anbefohlen.
Walter.
Fragt nach dem Gegenſtand der Klage
jetzt.
Adam.
Jetzt ſoll ich —?
Walter.
/: ungeduldig
:/
Ja, den Gegenſtand ermitteln!
Adam.
Das iſt gleichfalls ein Krug, verzeiht.
Walter.
Wie?
Gleichfalls!
Wie! Gleichfalls —
Wie? Gleichfalls!
Adam.
Ein Krug. Ein bloßer Krug. Setzt einen
Krug,
Und ſchreibt dabei: dem Amte
wohlbekannt.
Licht.
Herr Rich Auf meine
hingeworfene Vermuthung
Wollt ihr,
ſogleich
ſo gleich
—?
Herr Richter —?
Wollt ihr ſogleich
—?
Wollt ihr,
Herr Richter —?
Wollt ihr, Herr Richter
—?
Wollt ihr, Herr Richter
—?
Adam.
Mein Seel, wenn ich’s euch
ſage,
So ſchreibt ihr’s hin. Iſt’s nicht ein Krug,
Frau Marthe.?
So ſchreibt ihr’s hin.
Iſt’s nicht ein Krug, Frau Marthe.
So ſchreibt ihr’s hin.
Iſt’s nicht ein Krug, Frau Marthe?
So schreibt ihr’s hin.
Ist's nicht ein Krug, Frau Marthe?
So ſchreibt ihrs hin.
Iſt’s nicht ein Krug, Frau Marthe?
Frau
Marthe
36.
Frau Marthe
Ja, hier der Krug —
Adam.
Da habt ihr’s.
Frau Marthe.
Der zerbrochne —
Adam.
Pedantiſche Bedenklichkeit.
Licht.
Ich bitt’ euch —
Adam
Und wer zerbrach den Krug?
Gewiß der Schlingel —?
Und wer zerbrach den
Krug? Gewiſs der Schlingel?
Und wer zerbrach den
Krug? Gewiß der Schlingel —?
Frau Marthe.
Ja, er, der Schlingel dort — .
Adam
/: für ſich :/
Mehr brauch’ ich
nicht.
Mehr brauch’ ich
nicht.
Mehr brauch ich
nicht.
Ruprecht.
Das iſt nicht wahr, Herr Richter.
Adam
/: für ſich :/
Auf, aufgelebt, du alter Adam!
Ruprecht.
Das lügt ſie in den Hals hinein —
Adam.
Schweig, Maulaffe,!
Schweig,
Maulaffe,
Schweig,
Maulaffe!
Schweig, Maulaffe!
Schweig, Maulaffe!
Du ſteckſt den Hals noch
früh genug in’s Eiſen.
Du steckst den Hals noch
früh genug ins Eisen.
Du ſteckſt den Hals noch
fruͤh genug in’s Eiſen.
— Setzt einen Krug, Herr Schreiber, wie
geſagt,
Zuſamt dem Namen deſſ’,
der ihn zerſchlagen:
Znsammt dem Namen dess’,
der ihn zerschlagen:
Zuſammt dem Namen deſſ’,
der ihn zerſchlagen.
Jetzt wird die Sache gleich ermittelt
ſein.
Walter.
Herr Richter! Ei! Welch’
ein gewaltſames Verfahren.
Herr Richter! Ei, welch
ein gewaltsames Verfahren!
Herr Richter! Ei! Welch’
ein gewaltſames Verfahren.
Adam.
Wie ſo?
Licht.
Wollt ihr nicht förmlich —?
37.
Adam.
Nein! ſag’
ich.
Nein! sag’ ich.
Nein! ſag’ ich;
Ihr Gnaden lieben Förmlichkeiten nicht.
Walter.
Wenn ihr die Inſtruction, Herr Richter
Adam,
Nicht des Proceſſes einzuleiten wißt,
Iſt hier der Ort jetzt nicht, es euch zu
lehren.
Wenn ihr Recht anders nicht, als ſo, könnt geben,
So tretet ab: vielleicht kann’s euer
Schreiber.
Adam.
Erlaubt! Ich gab’s, wie’s
hier in Huiſum üblich.
Erlaubt! Ich gab’s,
wie’s hier in Huisum üblich!
Erlaubt! Ich gab’s,
wie’s hier in Huiſum uͤblich;
Ew. Gnaden haben’s alſo mir befohlen.
Walter.
Ich hätt’ —?
Adam.
Auf meine Ehre!
Walter.
Ich befahl euch,
Recht hier nach den Geſetzen zu
ertheilen;
Und hier in Huiſum glaubt’
ich die Geſetze
Und hier in Huisum
glaubt’ ich die Gesetze,
Und hier in Huiſum
glaubt’ ich die Geſetze,
Wie anderswo in den vereinten Staaten.
Adam.
Da muß ſubmiß ich um
Verzeihung bitten.
Da muſs submiſs ich um
Verzeihung bitten.
Da muß ſubmiß ich um
Verzeihung bitten!
Wir haben hier, mit euerer
Erlaubniß,
Wir haben hier, mit
euerer Erlaubniſs,
Wir haben hier, mit Ew.
Erlaubniß,
Statuten, eigenthümliche, in Huiſum,
Nicht aufgeſchriebene, muß ich geſtehn, doch
durch
Bewährte Tradition uns überliefert.
Von dieſer Form, getrau ich mir zu
hoffen,
Bin ich noch heut kein Jota abgewichen.
Doch auch in eurer andern Form bin ich,
Wie ſie im Reich mag üblich ſein, zu
Hauſe.
38.
Verlangt ihr den Beweis?
Wohlan, befehlt.
Verlangt ihr den Beweis?
Wohlan, befehlt.
Verlangt ihr den Beweis?
Wohlan, befehlt!
Ich kann Recht jeſo jetzt,
jetzo ſo ertheilen.
Walter.
Ihr gebt mir ſchlechte Meinungen, Herr
Richter.
Es ſei. Ihr fangt von vorn
die Sache an.
Es sei. Ihr fangt von
vorn die Sache an.
Es ſei. Ihr fangt von
vorn die Sache an. —
Adam.
Auf Ehr’! Gebt Acht, ihr ſollt zufrieden
ſein.
— Frau Marthe Rull! Bringt eure Klage
vor.
Frau Marthe.
Ich klag’, ihr wißt’s,
hier wegen dieſes Krugs.
Ich klag’, ihr wiſst’s,
hier wegen dieses Krugs.
Ich klag’, ihr wißt’s,
hier wegen dieſes Krugs;
Das ich
von einem
jüngſt ein
Indienfahrer kaufte
mir
geſchenktWie an den unterschiedlichen
Durchsteichungen zu erkennen, sind in der Sentenz ›ich
von einem‹ zunächst das ›ich‹ (zusammen mit ›kaufte‹
am Versende), später das ›von einem‹ gestrichen
worden. Alle Änderungen der Verse 559–561 sind 1808
durchgeführt worden, erkennbar an der steileren
Schriftlage und der Schlingenbildung in den
Unterlängen von g und h. Entsprechend sind die
Änderungen in die Phöbusfassung eingegangen, der
Erstdruck zeigt die Fassung der
Grundschicht.
Das ich
von einem Indienfahrer kaufte
Das von einem
Indienfahrer mir geſchenkt
Das jüngſt
ein Indienfahrer mir geſchenkt
Das jüngst ein
Indienfahrer mir geschenkt,
Das ich von
einem Indienfahrer kaufte,
Schwarz, wie ein Rab’, mit
goldner
gold’ner Ein Apostroph ist selbst in großer
Vergrößerung nicht erkennbar. Auch im
Phöbusdruck steht nur ›goldner‹.
gold’ner
Toll’ und Flügeln,
Schwarz, wie ein
Rab’, mit goldner Toll und Flügeln,
[keine
Entsprechung]
Den Pips: ich
jetzt ſoll es nudeln,
und verſteh’s nicht,
Den Pips:
ich ſoll es nudeln, und verſteh’s
nicht,
Den Pips: jetzt
ſoll esKleist
vergißt offensichtlich, in der Korrektur
zusätzlich das ›es‹ durch ›ich’s‹ zu ersetzen. In
der Phöbusfassung dann richtig. nudeln, und
verſteh’s nicht,
Den Pips: jetzt soll
ich’s nudeln, und versteh’s nicht.
Den Pips: ich ſoll es
nudeln, und verſteh’s nicht,
Und fragte dort
bloß die Jungfer jetzt
dort um
Rath.
Und fragte
dort die Jungfer jetzt um Rath.Die
Textgenese ist nicht so eindeutig zu bestimmen wie
BKA (BKA I/3, 291) und HAM (S. 144) es nahelegen,
dass die Variante a ›Und fragte dort die Jungfer
jetzt um Rath.‹ in einem einzigen Korrekturgang in
die Variante c geändert worden sei, wofür
Schriftmerkmale und Form der Streichungen durchaus
sprechen könnten. Unberücksichtigt bleibt bei
dieser Annahme die Einfügungsklammer, mit der das
einzufügende ›dort‹ vor ›jetzt‹ platziert werden
soll. Da Kleist am Versanfang auf eine
Einfügemarke verzichtet, muss diese vor ›jetzt‹
eine Funktion gehabt haben. Insofern kann davon
ausgegangen werden, dass ›jetzt‹ zunächst nicht
gestrichen, sondern zu einem ›dort jetzt‹
erweitert wurde. Wenn aber am Versende ›dort‹
hinzugefügt wird, muss es gleichzeitig am
Versanfang gestrichen worden sein, wie in
Variante b dargestellt: ›Und fragte die Jungfer
dort jetzt um Rath.‹ Erst in einer weiteren
Änderung ist dann die endgültige Variante c
entstanden. Für E kommt es zu einer erneuten
Umstellung von ›bloß‹ und ›dort‹.
Und fragte die Jungfer
dort
jetzt um Rath.
Und fragte bloß
die Jungfer dort um Rath.
Und fragte blos die
Jungfer dort um Rath.
Und fragte dort die
Jungfer bloß um Rath.
Ich bin ein Narr in ſolchen Dingen,
ſeht,
Und meine Hühner nenn’ ich ich meine Kinder.
Walter
Hier. Setzt euch. Ruft den
Kläger und vernehmt ihn:
Und ihr, Herr Schreiber
führt das Protokoll.
Und ihr, Herr Schreiber,
führt das Protocoll.
Und ihr, Herr Schreiber,
fuͤhrt das Protokoll.
Adam.
Befehlen Ew. Gnaden den Proceß
Nach den Formalitäten, oder ſo,
Wie er in Huiſum üblich iſt, zu halten?
34.
Walter.
Nach den geſetzlichen
Formalitäten.
Nach den gesetzlichen
Formalitäten:
Nach den geſetzlichen
Formalitaͤten,
Wie er in Huiſum üblich iſt,
So, wie er hier wird üblich
ſein, nicht anders.
Wie er in Huiſum
üblich iſt, nicht anders.
So, wie er hier wird üblich
ſein, nicht anders.
So, wie er hier wird
üblich sein, nicht anders.
Wie er in Huiſum uͤblich
iſt, nicht anders.
Adam.
Gut, gut. Ich werd’ euch zu bedienen
wiſſen.
Seid ihr bereit, Herr Schreiber?
Licht.
Zu euren Dienſten.
Adam.
— So nim̄,
Gerechtigkeit, denn deinen Lauf!
Klägere trete vor.
Frau Marthe
Hier, Herr Dorfrichter!
Adam.
Wer ſeid ihr?
Frau Marthe.
Wer —?
Adam
Ihr.
Frau Marthe
Wer ich —?
Adam.
Wer ihr ſeid!
Wes Namens, NStandes, Wohnorts, und
ſo weiter.
Frau Marthe.
Ich glaub’, er ſpaßt, Herr
Richter.
Ich glaub’ er spaſst,
Herr Richter.
Ich glaub’, er ſpaßt,
Herr Richter.
Adam.
Spaßen, was!
Ich ſitz’ im Namen der Juſtiz, Frau
Marthe,
Und die Juſtiz muß wiſſen, wer ihr ſeid.
Licht
/: halblaut :/
Laßt doch die ſonderbare Frag’ —
Frau Marthe
Ihr kuckt
Mir alle Sonntag in die Fenſter ja,
Wenn ihre auf’s Vorwerk geht.
Wenn ihr auf’s Vorwerk
geht.
Wenn ihr auf’s Vorwerk
geht!
35.
Walter.
Kennt ihr die Frau?
Adam.
Sie wohnt hier um die Ecke, Ew. Gnaden,
Wenn man den Fußſteig durch die Hecken
geht;
Wittw’ eines Caſtellans, Hebam̄e jetzt,
Sonſt eine ehrliche Frau, von gutem
Rufe.
Walter
Wenn ihr ſo unterrichtet ſeid, Herr
Richter,
So ſind dergleichen Fragen überflüſſig.
Setzt ihren Namen in das Protokoll,
Und ſchreibt dabei: dem Amte
wohlbekannt.
Adam.
Auch das. Ihr ſeid nicht für
Formalitäten.
Thut ſo, wie Sr. Gnaden anbefohlen.
Walter.
Fragt nach dem Gegenſtand der Klage
jetzt.
Adam.
Jetzt ſoll ich —?
Walter.
/: ungeduldig
:/
Ja, den Gegenſtand ermitteln!
Adam.
Das iſt gleichfalls ein Krug, verzeiht.
Walter.
Wie?
Gleichfalls!
Wie! Gleichfalls —
Wie? Gleichfalls!
Adam.
Ein Krug. Ein bloßer Krug. Setzt einen
Krug,
Und ſchreibt dabei: dem Amte
wohlbekannt.
Licht.
Herr Rich Auf meine
hingeworfene Vermuthung
Wollt ihr,
ſogleich
ſo gleich
—?
Herr Richter —?
Wollt ihr ſogleich
—?
Wollt ihr,
Herr Richter —?
Wollt ihr, Herr Richter
—?
Wollt ihr, Herr Richter
—?
Adam.
Mein Seel, wenn ich’s euch
ſage,
So ſchreibt ihr’s hin. Iſt’s nicht ein Krug,
Frau Marthe.?
So ſchreibt ihr’s hin.
Iſt’s nicht ein Krug, Frau Marthe.
So ſchreibt ihr’s hin.
Iſt’s nicht ein Krug, Frau Marthe?
So schreibt ihr’s hin.
Ist's nicht ein Krug, Frau Marthe?
So ſchreibt ihrs hin.
Iſt’s nicht ein Krug, Frau Marthe?
Frau
Marthe
36.
Frau Marthe
Ja, hier der Krug —
Adam.
Da habt ihr’s.
Frau Marthe.
Der zerbrochne —
Adam.
Pedantiſche Bedenklichkeit.
Licht.
Ich bitt’ euch —
Adam
Und wer zerbrach den Krug?
Gewiß der Schlingel —?
Und wer zerbrach den
Krug? Gewiſs der Schlingel?
Und wer zerbrach den
Krug? Gewiß der Schlingel —?
Frau Marthe.
Ja, er, der Schlingel dort — .
Adam
/: für ſich :/
Mehr brauch’ ich
nicht.
Mehr brauch’ ich
nicht.
Mehr brauch ich
nicht.
Ruprecht.
Das iſt nicht wahr, Herr Richter.
Adam
/: für ſich :/
Auf, aufgelebt, du alter Adam!
Ruprecht.
Das lügt ſie in den Hals hinein —
Adam.
Schweig, Maulaffe,!
Schweig,
Maulaffe,
Schweig,
Maulaffe!
Schweig, Maulaffe!
Schweig, Maulaffe!
Du ſteckſt den Hals noch
früh genug in’s Eiſen.
Du steckst den Hals noch
früh genug ins Eisen.
Du ſteckſt den Hals noch
fruͤh genug in’s Eiſen.
— Setzt einen Krug, Herr Schreiber, wie
geſagt,
Zuſamt dem Namen deſſ’,
der ihn zerſchlagen:
Znsammt dem Namen dess’,
der ihn zerschlagen:
Zuſammt dem Namen deſſ’,
der ihn zerſchlagen.
Jetzt wird die Sache gleich ermittelt
ſein.
Walter.
Herr Richter! Ei! Welch’
ein gewaltſames Verfahren.
Herr Richter! Ei, welch
ein gewaltsames Verfahren!
Herr Richter! Ei! Welch’
ein gewaltſames Verfahren.
Adam.
Wie ſo?
Licht.
Wollt ihr nicht förmlich —?
37.
Adam.
Nein! ſag’
ich.
Nein! sag’ ich.
Nein! ſag’ ich;
Ihr Gnaden lieben Förmlichkeiten nicht.
Walter.
Wenn ihr die Inſtruction, Herr Richter
Adam,
Nicht des Proceſſes einzuleiten wißt,
Iſt hier der Ort jetzt nicht, es euch zu
lehren.
Wenn ihr Recht anders nicht, als ſo, könnt geben,
So tretet ab: vielleicht kann’s euer
Schreiber.
Adam.
Erlaubt! Ich gab’s, wie’s
hier in Huiſum üblich.
Erlaubt! Ich gab’s,
wie’s hier in Huisum üblich!
Erlaubt! Ich gab’s,
wie’s hier in Huiſum uͤblich;
Ew. Gnaden haben’s alſo mir befohlen.
Walter.
Ich hätt’ —?
Adam.
Auf meine Ehre!
Walter.
Ich befahl euch,
Recht hier nach den Geſetzen zu
ertheilen;
Und hier in Huiſum glaubt’
ich die Geſetze
Und hier in Huisum
glaubt’ ich die Gesetze,
Und hier in Huiſum
glaubt’ ich die Geſetze,
Wie anderswo in den vereinten Staaten.
Adam.
Da muß ſubmiß ich um
Verzeihung bitten.
Da muſs submiſs ich um
Verzeihung bitten.
Da muß ſubmiß ich um
Verzeihung bitten!
Wir haben hier, mit euerer
Erlaubniß,
Wir haben hier, mit
euerer Erlaubniſs,
Wir haben hier, mit Ew.
Erlaubniß,
Statuten, eigenthümliche, in Huiſum,
Nicht aufgeſchriebene, muß ich geſtehn, doch
durch
Bewährte Tradition uns überliefert.
Von dieſer Form, getrau ich mir zu
hoffen,
Bin ich noch heut kein Jota abgewichen.
Doch auch in eurer andern Form bin ich,
Wie ſie im Reich mag üblich ſein, zu
Hauſe.
38.
Verlangt ihr den Beweis?
Wohlan, befehlt.
Verlangt ihr den Beweis?
Wohlan, befehlt.
Verlangt ihr den Beweis?
Wohlan, befehlt!
Ich kann Recht jeſo jetzt,
jetzo ſo ertheilen.
Walter.
Ihr gebt mir ſchlechte Meinungen, Herr
Richter.
Es ſei. Ihr fangt von vorn
die Sache an.
Es sei. Ihr fangt von
vorn die Sache an.
Es ſei. Ihr fangt von
vorn die Sache an. —
Adam.
Auf Ehr’! Gebt Acht, ihr ſollt zufrieden
ſein.
— Frau Marthe Rull! Bringt eure Klage
vor.
Frau Marthe.
Ich klag’, ihr wißt’s,
hier wegen dieſes Krugs.
Ich klag’, ihr wiſst’s,
hier wegen dieses Krugs.
Ich klag’, ihr wißt’s,
hier wegen dieſes Krugs;
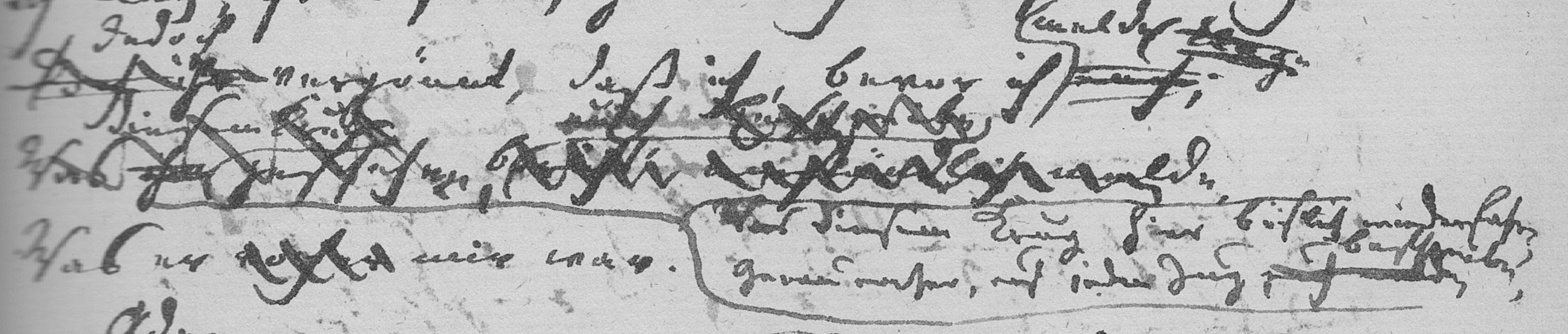 Doch ihr
Jedoch vergönnt, daß ich, bevor ich euch,
klage
melde
Die Korrekturen der Verse 641f sind
versübergreifend, wobei die versübergreifenden
Textstände (ɑ, β und ɣ) nicht eindeutig zu
rekonstruieren sind. So könnte Variante 641b schon
Teil des Textstands β gewesen sein, da auch sie
anschlussfähig ist zu Variante 642b. Textstand β
bildet die Grundlage für E, wobei offen bleiben muss,
ob die Änderung von ›euch beſchreibe‹ in ›auch
beſchreibe‹ ein Abschreibfehler oder eine Korrektur
ist. Textstand ɣ ist die Basis für die ebenfalls
modifizierte ›Phöbus‹-Fassung. Vgl. Günter Dunz-Wolff,
Kleists Arbeit am Text, KJb 2020, S. xxx
Doch ihr
vergönnt, daß ich, bevor ich euch,
Jedoch vergönnt,
daß ich, bevor ich klage
Jedoch
vergönnt, daß ich, bevor ich melde
Jedoch vergönnt, daſs
ich, bevor ich melde,
Jedoch vergoͤnnt, daß
ich, bevor ich melde
Was ihm
dieſem Krug geſchehen, euch
beſchreibe bericht’, umſtändlich
melde,
Doch ihr
Jedoch vergönnt, daß ich, bevor ich euch,
klage
melde
Die Korrekturen der Verse 641f sind
versübergreifend, wobei die versübergreifenden
Textstände (ɑ, β und ɣ) nicht eindeutig zu
rekonstruieren sind. So könnte Variante 641b schon
Teil des Textstands β gewesen sein, da auch sie
anschlussfähig ist zu Variante 642b. Textstand β
bildet die Grundlage für E, wobei offen bleiben muss,
ob die Änderung von ›euch beſchreibe‹ in ›auch
beſchreibe‹ ein Abschreibfehler oder eine Korrektur
ist. Textstand ɣ ist die Basis für die ebenfalls
modifizierte ›Phöbus‹-Fassung. Vgl. Günter Dunz-Wolff,
Kleists Arbeit am Text, KJb 2020, S. xxx
Doch ihr
vergönnt, daß ich, bevor ich euch,
Jedoch vergönnt,
daß ich, bevor ich klage
Jedoch
vergönnt, daß ich, bevor ich melde
Jedoch vergönnt, daſs
ich, bevor ich melde,
Jedoch vergoͤnnt, daß
ich, bevor ich melde
Was ihm
dieſem Krug geſchehen, euch
beſchreibe bericht’, umſtändlich
melde,Was dieſem Krug hier böſ’lich wiederfahren,
Genau vorher, auf jeden Zug, euch melde, beſchreibe,Hier fügt Kleist für die ›Phöbus‹-Fassung einen zusätzlichen Vers ein. Was ihm geſchehn, bericht’ umſtändlich melde, Was dieſem Krug geſchehen, euch beſchreibe Was dieſem Krug hier böſ’lich wiederfahren,
Genau vorher, auf jeden Zug euch melde, Was dieſem Krug hier böſ’lich wiederfahren,
Genau vorher, auf jeden Zug, beſchreibe, Was diesem Krug hier böslich widerfahren,
Genau vorher, auf jedem Zug euch sage, Was dieſem Krug geſchehen, auch beſchreibe Was er vorher mir war. Was er vorher mir war. Was er vorher mir war. Was er mir war. Was er vorher mir war. Adam. Das Reden iſt an euch. Frau Marthe. Wohlan! Seht ihr den Krug, ihr werthen werthgeſchätzten Herren? Wohlan! Seht ihr den Krug, ihr werthen Herren? Seht ihr den Krug, ihr werthgeſchätzten Herren? Seht ihr den Krug, ihr werthgeschätzten Herren? Seht ihr den Krug, ihr werthgeſchaͤtzten Herren? Seht ihr den Krug? Adam. O Jja, wir ſehen ihn. Frau Marthe. Nichts ſeht ihr, mit Verlaub, die Scherben ſeht ihr, Nichts seht ihr, mit Verlaub, die Scherben seht ihr, Nichts ſeht ihr, mit Verlaub, die Scherben ſeht ihr; Der Krüge ſchönſter iſt entzweie geſchlagen. Hier grade auf dem Loch, wo jetzo nichts, Sind die geſamten niederländiſchen Provinzen Dem ſpan’ſchen Philipp übergeben worden.Die Verse 649f sind für den ›Phöbus‹ von Kleist gekürzt: ›Sind die geſamten — — — — Provinzen | — — — — übergeben worden. | U. s. w. | (Hier folgt die Beschreibung des Kruges)‹. Die Auslassung der ›Beschreibung des Kruges‹ umfasst im Manuskript ca. 3,5 Seiten [hier bis Vers 729]. Hier im Ornat ſtand Kaiſer Karl der fünfte,: Von dem ſeht ihr nur noch die Beine ſtehn. Hier kniete Philipp, und empfieng die Krone: Der liegt im Topf, bis auf den Hintertheil, Und auch noch der hat einen Stoß empfangen. 39.
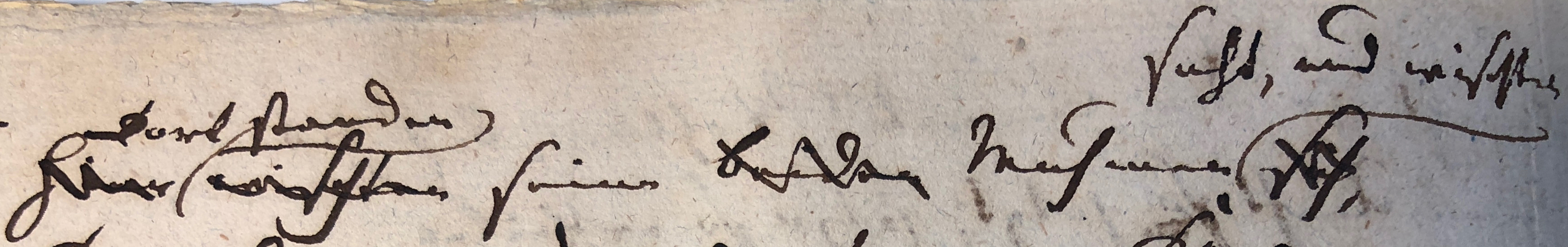 Hier
Dort
wiſchten
ſtanden ſeine beiden Muhmen ſeht, und wiſchtenHier
und im Folgenden finden sich Korrekturen, die
Kleist 1808 im Kontext der
›Phöbus‹-Überarbeitung vorgenommen hat. In die
›Phöbus‹-Fragmente sind sie aufgrund der
Kürzung der Krug-Beschreibung nicht
aufgenommen worden. Die genaue Bestimmung der
für die ›Phöbus‹-Fragmente auszuwählenden
Verse hat Kleist offensichtlich erst nach
Abschluß der Korrekturen
vorgenommen.ſich,In diesem Monolog von Marthe
Rull finden sich wieder versübergreifende Korrekturen
in den Varianten. Hier entspricht ɑ dem Textstand der
Grundschicht, β bildet die Grundlage für die Fassung
von E und ɣ entspricht dem finalen Textstand von 1808,
der nicht im ›Phöbus‹ aufgenommen worden
ist.
Hier wiſchten
ſeine beiden Muhmen ſich,
Dort
wiſchten ſeine beiden Muhmen
ſich,
Dort ſtanden
ſeine Muhmen ſeht, und wiſchten,
Dort wiſchten ſeine
beiden Muhmen ſich,
Der Franzen und der Ungarn Königinn,en
Hier
Dort
wiſchten
ſtanden ſeine beiden Muhmen ſeht, und wiſchtenHier
und im Folgenden finden sich Korrekturen, die
Kleist 1808 im Kontext der
›Phöbus‹-Überarbeitung vorgenommen hat. In die
›Phöbus‹-Fragmente sind sie aufgrund der
Kürzung der Krug-Beschreibung nicht
aufgenommen worden. Die genaue Bestimmung der
für die ›Phöbus‹-Fragmente auszuwählenden
Verse hat Kleist offensichtlich erst nach
Abschluß der Korrekturen
vorgenommen.ſich,In diesem Monolog von Marthe
Rull finden sich wieder versübergreifende Korrekturen
in den Varianten. Hier entspricht ɑ dem Textstand der
Grundschicht, β bildet die Grundlage für die Fassung
von E und ɣ entspricht dem finalen Textstand von 1808,
der nicht im ›Phöbus‹ aufgenommen worden
ist.
Hier wiſchten
ſeine beiden Muhmen ſich,
Dort
wiſchten ſeine beiden Muhmen
ſich,
Dort ſtanden
ſeine Muhmen ſeht, und wiſchten,
Dort wiſchten ſeine
beiden Muhmen ſich,
Der Franzen und der Ungarn Königinn,en
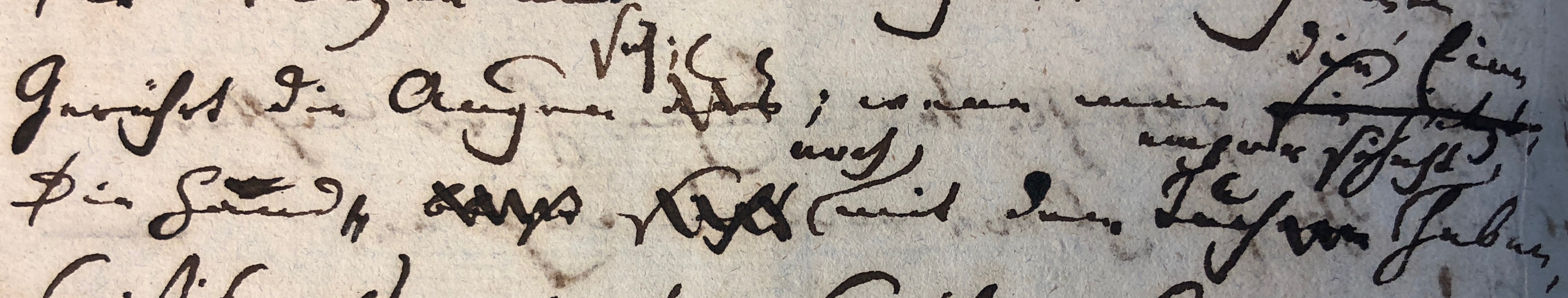 Gerührt die Augen
aus;
ſich; wenn man ſie jetzt,
die
Eine
Gerührt die Augen
aus; wenn man ſie jetzt,
Gerührt
die Augen aus; wenn man die
Eine
Gerührt die
Augen ſich; wenn man die
Eine
Geruͤhrt die
Augen aus; wenn man die Eine
Die Häande
bloß ſieht
noch mit denm Tüuchern
empor
ſieht heben,
Die
Hände
bloß
ſieht mit den
Tüchern heben,
Die Hand
noch mit dem Tuch empor
ſieht heben,
Die Hand noch mit dem
Tuch empor ſieht heben,
So iſt’s, als weineten ſie über
ſich.
So iſt’s, als
weineten ſie über ſich.
So iſt’s,
als weinete ſie über ſich.
So iſt’s, als weinete
ſie uͤber ſich.
Gerührt die Augen
aus;
ſich; wenn man ſie jetzt,
die
Eine
Gerührt die Augen
aus; wenn man ſie jetzt,
Gerührt
die Augen aus; wenn man die
Eine
Gerührt die
Augen ſich; wenn man die
Eine
Geruͤhrt die
Augen aus; wenn man die Eine
Die Häande
bloß ſieht
noch mit denm Tüuchern
empor
ſieht heben,
Die
Hände
bloß
ſieht mit den
Tüchern heben,
Die Hand
noch mit dem Tuch empor
ſieht heben,
Die Hand noch mit dem
Tuch empor ſieht heben,
So iſt’s, als weineten ſie über
ſich.
So iſt’s, als
weineten ſie über ſich.
So iſt’s,
als weinete ſie über ſich.
So iſt’s, als weinete
ſie uͤber ſich.
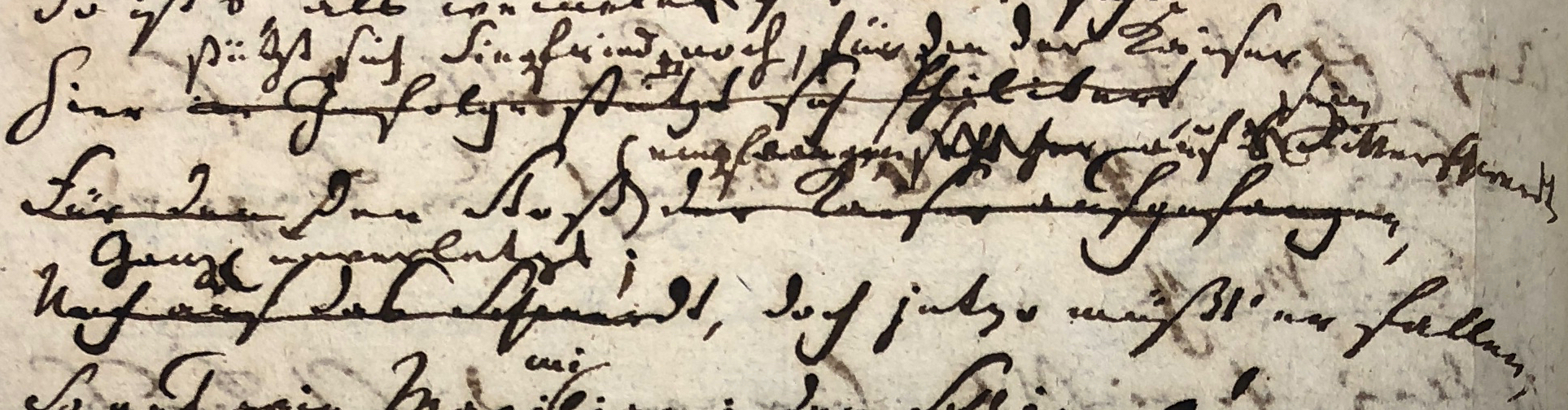 Hier im Gefolge ſtützt ſich Philibert,
ſtützt ſich Siegfried, noch, für den der
Kaiſer
Hier im
Gefolge ſtützt ſich Philibert,
Hier ſtützt ſich
Siegfried noch, für den der Kaiſer
Hier im Gefolge ſtuͤtzt
ſich Philibert,
Für den
dDen Stoß empfieang,en
ſeht her, auf’s
ſein Ritterſchwerth,der
Kaiſer aufgefangen,
Hier im Gefolge ſtützt ſich Philibert,
ſtützt ſich Siegfried, noch, für den der
Kaiſer
Hier im
Gefolge ſtützt ſich Philibert,
Hier ſtützt ſich
Siegfried noch, für den der Kaiſer
Hier im Gefolge ſtuͤtzt
ſich Philibert,
Für den
dDen Stoß empfieang,en
ſeht her, auf’s
ſein Ritterſchwerth,der
Kaiſer aufgefangen,[Vgl. Faksimile Vers 661.] BKA: Die Streichung von ›der Kaiſer aufgefangen,‹ ist nicht transkribiert.
Für den den Stoß der Kaiſer aufgefangen, Den Stoß empfieng, ſeht her, auf’s Ritterſchwerth, Den Stoß empfangen auf ſein Ritterſchwerth, Fuͤr den den Stoß der Kaiſer aufgefangen, Noch auf das Schwerdt, Ganz unverletzt; doch jetzo müßt’ er fallen, Noch auf das Schwerdt, doch jetzo müßt’ er fallen, Ganz unverletzt; doch jetzo müßt’ er fallen, Noch auf das Schwerdt; doch jetzo muͤßt’ er fallen, So gut, wie Maximilian: der Schlingel! Die Schwerdter unten jetzt ſind weghinweggeſchlagen. Die Schwerdter unten jetzt ſind weggeſchlagen. Die Schwerdter unten ſind hinweg geſchlagen. Die Schwerdter unten jetzt ſind weggeſchlagen.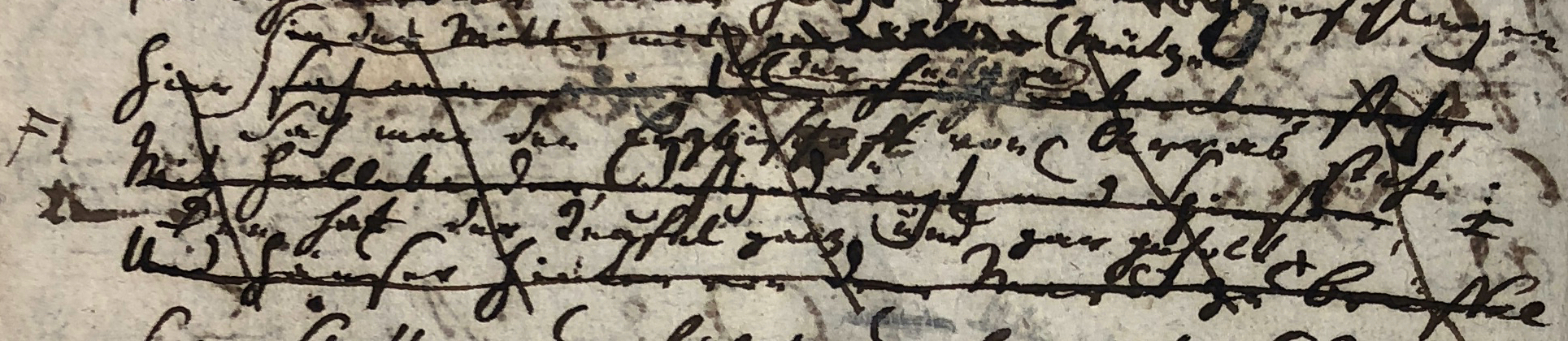 Hier ſah man ringsum Leibtrabanten
ſtehn,
in der
Mitte, mit gewölbter
der
heilgen Mütze1808 auf
eingesiegeltem Zettel (s. u.) modifiziert Kleist in
›Hier, in der Mitte, mit der heil’gen
Mütze,‹.
Hier ſah man
ringsum Leibtrabanten ſtehn,
Hier in der Mitte, mit
gewölbter Mütze,
Hier in der
Mitte, mit der heilgen Mütze,
Hier in der Mitte, mit
der heil’gen Muͤtze,
Mit Hellebarden, dichtgedrängt, und
Spießen,
Sah man den
Erzbiſchoff von Arras ſtehn,:
Mit Hellebarden,
dichtgedrängt, und Spießen,
Sah
man den Erzbiſchoff von Arras
ſtehn,:In
der Zettelfassung ändert Kleist das abschließende
Satzzeichen in ein Semikolon (wie in
E).
Sah man den Erzbiſchof
von Arras ſtehn;
Und Häuſer hinten von dem Markt zu Brüſſel
Den hat
der Teufel ganz und gar geholt,
Und Häuſer hinten von
dem Markt zu Brüſſel
Den
hat der Teufel ganz und gar geholt,
Den hat der Teufel ganz
und gar geholt,
Hier ſah man ringsum Leibtrabanten
ſtehn,
in der
Mitte, mit gewölbter
der
heilgen Mütze1808 auf
eingesiegeltem Zettel (s. u.) modifiziert Kleist in
›Hier, in der Mitte, mit der heil’gen
Mütze,‹.
Hier ſah man
ringsum Leibtrabanten ſtehn,
Hier in der Mitte, mit
gewölbter Mütze,
Hier in der
Mitte, mit der heilgen Mütze,
Hier in der Mitte, mit
der heil’gen Muͤtze,
Mit Hellebarden, dichtgedrängt, und
Spießen,
Sah man den
Erzbiſchoff von Arras ſtehn,:
Mit Hellebarden,
dichtgedrängt, und Spießen,
Sah
man den Erzbiſchoff von Arras
ſtehn,:In
der Zettelfassung ändert Kleist das abschließende
Satzzeichen in ein Semikolon (wie in
E).
Sah man den Erzbiſchof
von Arras ſtehn;
Und Häuſer hinten von dem Markt zu Brüſſel
Den hat
der Teufel ganz und gar geholt,
Und Häuſer hinten von
dem Markt zu Brüſſel
Den
hat der Teufel ganz und gar geholt,
Den hat der Teufel ganz
und gar geholt,
Hier, in der Mitte, mit der heil’gen Mütze, Sah man den Erzbiſchoff von Arras ſtehn; Den Hirtenſtab hielt er, und hinter ihm [ ] Sah man geſchmückt den ganzen from̄en Klerus prangen: Sah man den ganzen from̄en Klerus prangen: Sah man geſchmückt den ganzen Klerus prangen: [ ] Den hat der Teufel ganz und gar geholt,[Von dritter Hand ist unten links auf dem angesiegelten Zettel notiert: ›acc. ms. 19287 1512‹. Siehe hierzu nähere Erläuterungen in BKA I/3 S. 440ff.]
Sein Schatten nunr fällt nur über’s Pflaſter. Sein Schatten nunr fällt nur über’s Pflaſter. Sein Schatten nur faͤllt lang noch uͤbers Pflaſter. Hier ſtanden rings, im Grunde, Leibtrabanten, Mit Hellebarden, dichtgedrängt, und Spießen, Mit Hellebarden, dicht gedraͤngt, und Spießen,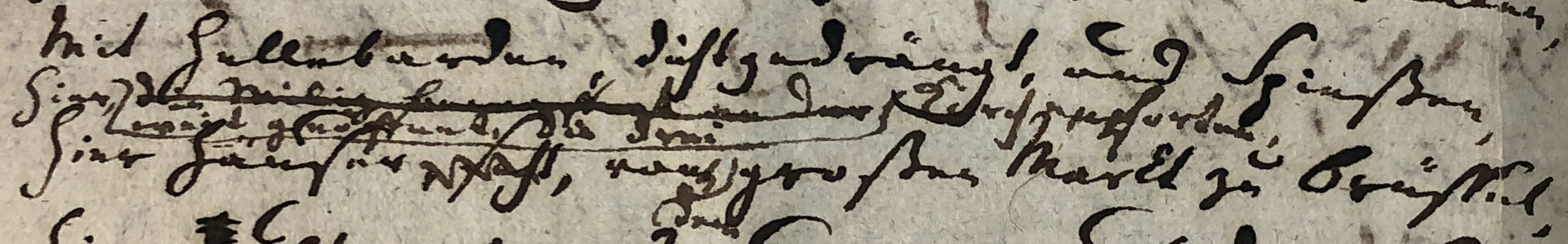 Hier, die Miliz bewaffnet an
den weit geöffnet, die
drei Kirchenpforten,
Hier, die Miliz
bewaffnet an den Kirchenpforten,
Hier, weit
geöffnet, die drei Kirchenpforten,
[ ]
Hier Häuſer, ſeht,
vomn
dem großen Markt zu
Brüſſel,
Hier Häuſer, ſeht,
vom großen Markt zu Brüſſel,
Hier Häuſer, von
dem großen Markt zu
Brüſſel,
Hier Haͤuſer, ſeht, vom
großen Markt zu Bruͤſſel,
Hier kguckt noch ein
Neugier’ger aus dem Fenſter:
Doch was er jetzo ſieht, das weiß ich
nicht.
Adam.
Frau Marth’! Erlaßt uns das zerſcherbte
Pactum,
Frau Marth’! Erlaßt uns
das zerſcherbte Pactum,
Frau Marth! Erlaßt uns
das zerſcherbte Pactum,
Wenn es zur Sache nicht gehört.
Uns geht das Loch — nichts die Provinzen
an,
Die darauf übergeben worden ſind.
Frau Marthe!
Erlaubt! Wie ſchön
der Krug, gehört zur Sache. —
Den Krug erbeutete ſich Childerich,
Der Keſſelflicker, als Oranien
Briel mit den Waſſergeuſenen überrumpelte.
40.
Ihn hatt’ ein Spanier, gefüllt mit Wein,
Juſt an den Mund geſetzt, als Childerich
Den Spanier von hinten niederwarf,
Den Krug ergriff, ihn leert’, und weiter
gieng.
Adam.
Ein würd’ger Waſſergeuſe.
Frau Marthe.
Hierauf vererbte
Der Krug auf Fürchtegott,
den Todtengräber.
Der Krug auf
Fuͤrchtegott, den Todtengraͤber;
Der trank zu dreimal nur, der Nüchterne,
Und ſtets vermiſcht mit Waſſer aus dem
Krug.
Das Erſtemal, als er im Sechzigſten,
Ein junges Weib ſich nahm; drei Jahre
drauf,
Als ſie noch glücklich ihn zum Vater
machte;
Hier, die Miliz bewaffnet an
den weit geöffnet, die
drei Kirchenpforten,
Hier, die Miliz
bewaffnet an den Kirchenpforten,
Hier, weit
geöffnet, die drei Kirchenpforten,
[ ]
Hier Häuſer, ſeht,
vomn
dem großen Markt zu
Brüſſel,
Hier Häuſer, ſeht,
vom großen Markt zu Brüſſel,
Hier Häuſer, von
dem großen Markt zu
Brüſſel,
Hier Haͤuſer, ſeht, vom
großen Markt zu Bruͤſſel,
Hier kguckt noch ein
Neugier’ger aus dem Fenſter:
Doch was er jetzo ſieht, das weiß ich
nicht.
Adam.
Frau Marth’! Erlaßt uns das zerſcherbte
Pactum,
Frau Marth’! Erlaßt uns
das zerſcherbte Pactum,
Frau Marth! Erlaßt uns
das zerſcherbte Pactum,
Wenn es zur Sache nicht gehört.
Uns geht das Loch — nichts die Provinzen
an,
Die darauf übergeben worden ſind.
Frau Marthe!
Erlaubt! Wie ſchön
der Krug, gehört zur Sache. —
Den Krug erbeutete ſich Childerich,
Der Keſſelflicker, als Oranien
Briel mit den Waſſergeuſenen überrumpelte.
40.
Ihn hatt’ ein Spanier, gefüllt mit Wein,
Juſt an den Mund geſetzt, als Childerich
Den Spanier von hinten niederwarf,
Den Krug ergriff, ihn leert’, und weiter
gieng.
Adam.
Ein würd’ger Waſſergeuſe.
Frau Marthe.
Hierauf vererbte
Der Krug auf Fürchtegott,
den Todtengräber.
Der Krug auf
Fuͤrchtegott, den Todtengraͤber;
Der trank zu dreimal nur, der Nüchterne,
Und ſtets vermiſcht mit Waſſer aus dem
Krug.
Das Erſtemal, als er im Sechzigſten,
Ein junges Weib ſich nahm; drei Jahre
drauf,
Als ſie noch glücklich ihn zum Vater
machte;
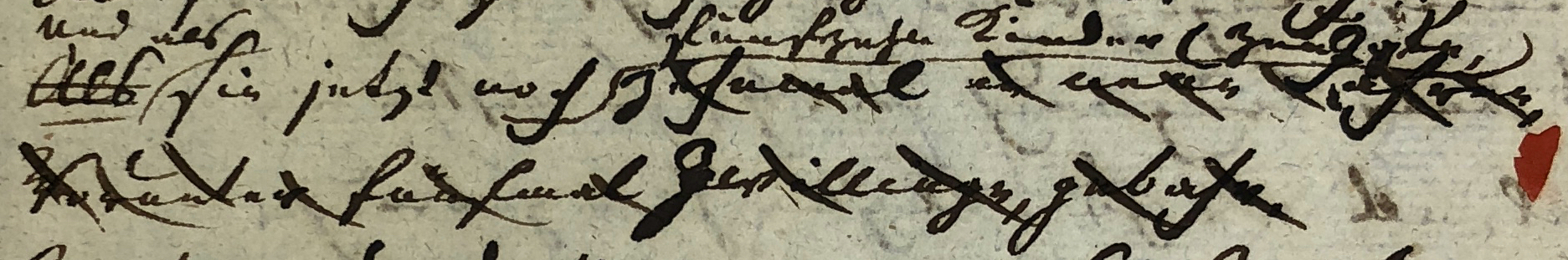 Als
Und
als ſie jetzt noch zehnmal in neun Jahren,
funfzehn
Kinder zeugte,
Als ſie jetzt
noch zehnmal in neun Jahren,
Und
als ſie jetzt noch funfzehn Kinder
zeugte,
Und als ſie jetzt noch
funfzehn Kinder zeugte,
Worunter
fünfmal zZwillinge,
gebahr,
Worunter fünfmal Zwillinge,
gebahr,
[ ]
[ ]
Trank er zum drittenmale, als ſie ſtarb.
Adam.
Gut. Das iſt auch nicht übel.
Frau Marthe
Drauf fiel der Krug
An den Zachäus, Schneider in Tirlemont,
Der meinem ſeel’gen Mann, was ich euch
jetzt
Berichten will, mit eignem
Mund’ erzählt.
Berichten will, mit
eignem Mund erzaͤhlt.
Der warf, als die Franzoſen plünderten,
Den Krug, ſamt allem Hausrath aus dem
Fenſter,
Sprang ſelbſt, und brach den Hals, der
Ungeſchickte,
Und dieſer irrdne Krug,
der Krug von Thon,
Und dieſer irdne Krug,
der Krug von Thon,
Auf’s Bein kam er zu ſtehen, und blieb
ganz.
Adam.
Zur Sache, wenn’s blbeliebt, Frau Marthe! Zur Sache!
Zur Sache, wenn’s
beliebt, Frau Marthe! Zur Sache!
Zur Sache, wenn’s
beliebt, Frau Marthe Rull! Zur Sache!
41
Frau Marthe
Drauf in der Feuersbrunſt
von ſechs und ſechzig,
Drauf in der
Feuersbrunſt von Sechs und ſechszig,
Da hatt’ ihn ſchon mein Mann, Gott hab’ ihn
ſeelig —
Adam.
Zum Teufel! Weib! So ſeid ihr noch nicht
fertig?
Frau Marthe
— Wenn ich nicht reden ſoll, Herr
Richter Adam,
So bin ich unnütz hier, ſo will ich
gehn,
Und ein Gericht mir ſuchen, das mich
hört.
Adam Walter.Von fremder Hand
›Adam‹ gestrichen und ›Walter.‹
ergänzt.
Ihr sollt hier reden: doch von Dingen
nicht,
Die eurer Klage fremd. Wenn ihr uns
ſagt,
Daß jener Krug euch werth, ſo wiſſen wir
Soviel, als wir zum
Richten hier gebrauchen.
So viel, als wir zum
Richten hier gebrauchen.
Frau Marthe.
Wieviel ihr brauchen
möget, hier zu richten,
Wie viel ihr brauchen
moͤget, hier zu richten,
Das weiß ich nicht, und unterſuch’ es
nicht;
Das aber weiß ich, daß ich, um zu
klagen,
Muß vor euch ſagen dürfen, über was.
Als
Und
als ſie jetzt noch zehnmal in neun Jahren,
funfzehn
Kinder zeugte,
Als ſie jetzt
noch zehnmal in neun Jahren,
Und
als ſie jetzt noch funfzehn Kinder
zeugte,
Und als ſie jetzt noch
funfzehn Kinder zeugte,
Worunter
fünfmal zZwillinge,
gebahr,
Worunter fünfmal Zwillinge,
gebahr,
[ ]
[ ]
Trank er zum drittenmale, als ſie ſtarb.
Adam.
Gut. Das iſt auch nicht übel.
Frau Marthe
Drauf fiel der Krug
An den Zachäus, Schneider in Tirlemont,
Der meinem ſeel’gen Mann, was ich euch
jetzt
Berichten will, mit eignem
Mund’ erzählt.
Berichten will, mit
eignem Mund erzaͤhlt.
Der warf, als die Franzoſen plünderten,
Den Krug, ſamt allem Hausrath aus dem
Fenſter,
Sprang ſelbſt, und brach den Hals, der
Ungeſchickte,
Und dieſer irrdne Krug,
der Krug von Thon,
Und dieſer irdne Krug,
der Krug von Thon,
Auf’s Bein kam er zu ſtehen, und blieb
ganz.
Adam.
Zur Sache, wenn’s blbeliebt, Frau Marthe! Zur Sache!
Zur Sache, wenn’s
beliebt, Frau Marthe! Zur Sache!
Zur Sache, wenn’s
beliebt, Frau Marthe Rull! Zur Sache!
41
Frau Marthe
Drauf in der Feuersbrunſt
von ſechs und ſechzig,
Drauf in der
Feuersbrunſt von Sechs und ſechszig,
Da hatt’ ihn ſchon mein Mann, Gott hab’ ihn
ſeelig —
Adam.
Zum Teufel! Weib! So ſeid ihr noch nicht
fertig?
Frau Marthe
— Wenn ich nicht reden ſoll, Herr
Richter Adam,
So bin ich unnütz hier, ſo will ich
gehn,
Und ein Gericht mir ſuchen, das mich
hört.
Adam Walter.Von fremder Hand
›Adam‹ gestrichen und ›Walter.‹
ergänzt.
Ihr sollt hier reden: doch von Dingen
nicht,
Die eurer Klage fremd. Wenn ihr uns
ſagt,
Daß jener Krug euch werth, ſo wiſſen wir
Soviel, als wir zum
Richten hier gebrauchen.
So viel, als wir zum
Richten hier gebrauchen.
Frau Marthe.
Wieviel ihr brauchen
möget, hier zu richten,
Wie viel ihr brauchen
moͤget, hier zu richten,
Das weiß ich nicht, und unterſuch’ es
nicht;
Das aber weiß ich, daß ich, um zu
klagen,
Muß vor euch ſagen dürfen, über was.
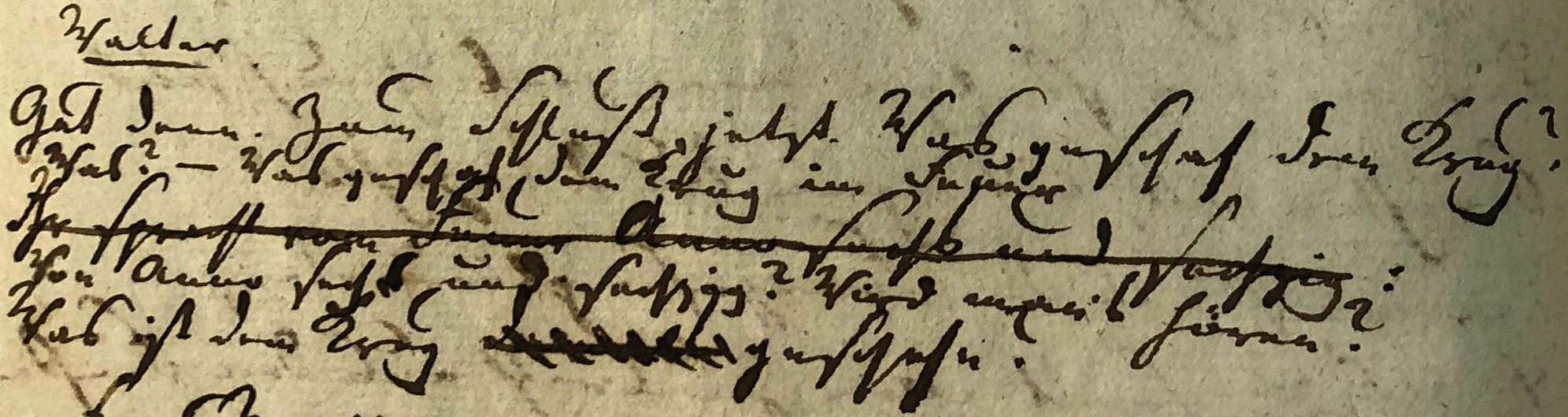 Walter.
Gut denn. Zum Schluß jetzt. Was geſchah dem
Krug?
Ihr ſpracht vom Feuer Anno ſechs und
ſechzig:Was? — Was geſchah dem Krug
im Feuer
Ihr ſpracht vom Feuer
Anno ſechs und ſechzig:
Was? — Was
geſchah dem Krug im Feuer
Was? — Was geſchah dem
Krug im Feuer
Von Anno ſechs und ſechzig? Wird man’s
hören?
[ ]
Von Anno ſechs
und ſechzig? Wird man’s hören?
Von Anno ſechs und
ſechszig? Wird man’s hoͤren?
Was iſt dem Krug damals geschehn?
Was iſt dem Krug
damals geschehn?
Was iſt dem Krug
geschehn?
Was iſt dem Krug
geſchehn?
Frau Marthe
Was ihm geſchehen?
Nichts iſt dem Krug, ich bitt’ euch ſehr,
ihr Herren,
Nichts Anno ſechs und
ſechzig ihm geſchehen.
Nichts Anno ſechs und
ſechszig ihm geſchehen.
Ganz blieb der Krug, ganz in der Flam̄en
Mitte,
42.
Und aus des Hauſes Aſche zog ich ihn
Hervor, glaſirt, am andern Morgen,
glänzend,
Als käm’ er eben aus dem Töpferofen.
Walter.
Nun gut. Nun kennen wir den Krug. Nun
wiſſen
Wir Alles, was dem Krug geſchehn, was
nicht.
Was giebt’s jetzt weiter?
Frau Marthe
Nun dieſen Krug jetzt ſeht — den
Krug,
Nun dieſen Krug
jetzt ſeht — den Krug,
Nun dieſen Krug jetzt
ſeht,
Nun diesen Krug jetzt
seht,
Nun dieſen Krug jetzt
ſeht — den Krug,
Den Krug
Z
z
ertrüm̄ertIn Vers 733f übersieht Kleist
die Korrektur der versalen Versanfänge ›Zertrümmert‹
und ›Für‹. einen Krug noch werth, —
den Krug
Zertrüm̄ert einen
Krug noch werth, den Krug
Den Krug
zertrüm̄ert einen Krug noch werth, —
Den Krug, zertrümmert
einen Krug noch werth,
Zertruͤmmert einen Krug
noch werth, den Krug
Den Krug,
F
f
ür eines Fräuleins Mund, die Lippe
ſelbſt
Für eines Fräuleins
Mund, die Lippe ſelbſt
Den Krug, für
eines Fräuleins Mund, die Lippe
Den Krug, für eines
Fräuleins Mund, die Lippe
Fuͤr eines Fraͤuleins
Mund, die Lippe ſelbſt,
Nicht der Frau Erbſtatthalterinn zu
ſchlecht,
Den Krug, ihr hohen Herren Richter
beide,
Den Krug hat jener Schlingel mir
zerbrochen.
Adam.
Wer?
Frau Marthe
Er, der Ruprecht dort.
Ruprecht.
Das iſt gelogen,
Herr Richter.
Adam
Schweig’ er, bis man ihn fragen
wird.
Auch heut an ihn noch wird die Reihe
kom̄en.
— Habt ihr’s im Protokoll bemerkt?
— Habt ihr's im
Protocoll bemerkt.
— Habt ihr’s im
Protocoll bemerkt?
Licht.
O ja.
Adam.
Erzählt den Hergang, würdige Frau
Marthe.
43.
Frau Marthe.
Es war Uhr Eeilfe geſtern —
Adam.
Wann, ſagt ihr?
Frau Marthe
Uhr eilf.
Adam.
Am Morgen!
Frau Marthe.
Nein, verzeiht am Abend,
—
Nein, verzeiht am
Abend,
Nein, verzeiht am Abend
—
Nein, verzeiht! am Abend
—
Nein, verzeiht am
Abend,
Adam
/: wendet ſich, mit der Gebährde
des Erſchreckens :/
Frau Marthe
/: fortfahrend
:/Kleist fügt für die ›Phöbus‹-Überarbeitung
hier Regieanweisungen ein. In E steht Vers 744 in
der Fassung der Grundschicht.
Und ſchon die Lamp’ im Bette wollt’ ich
löſchen,
Als laute Männerſtim̄en, ein Tumult,
In meiner Tochter
abgelegnen Kam̄er,
In meiner Tochter
abgeleg'nen Kammer
In meiner Tochter
abgelegnen Kammer,
Als ob der Feind’ einbräche, mich
erſchreckt.
Geſchwind’ die Trepp’ eil’ ich hinab, ich
finde
Die Kam̄erthür gewaltſam eingeſprengt,
1Papierverderbtheit, so dass Kleists nachträglich
eingefügte Zeilenzählung (1, 2, 3, 4, 6, 7, 5) gar
nicht oder kaum noch (6, 7) erkennbar ist.
Schimpfreden ſchallen wüthend mir entgegen,
2 Und da ich mir den Auftritt jetzt
beleuchte,
3 Was find’ ich jetzt, Herr Richter, was
jetzt find’ ich?
Walter.
Gut denn. Zum Schluß jetzt. Was geſchah dem
Krug?
Ihr ſpracht vom Feuer Anno ſechs und
ſechzig:Was? — Was geſchah dem Krug
im Feuer
Ihr ſpracht vom Feuer
Anno ſechs und ſechzig:
Was? — Was
geſchah dem Krug im Feuer
Was? — Was geſchah dem
Krug im Feuer
Von Anno ſechs und ſechzig? Wird man’s
hören?
[ ]
Von Anno ſechs
und ſechzig? Wird man’s hören?
Von Anno ſechs und
ſechszig? Wird man’s hoͤren?
Was iſt dem Krug damals geschehn?
Was iſt dem Krug
damals geschehn?
Was iſt dem Krug
geschehn?
Was iſt dem Krug
geſchehn?
Frau Marthe
Was ihm geſchehen?
Nichts iſt dem Krug, ich bitt’ euch ſehr,
ihr Herren,
Nichts Anno ſechs und
ſechzig ihm geſchehen.
Nichts Anno ſechs und
ſechszig ihm geſchehen.
Ganz blieb der Krug, ganz in der Flam̄en
Mitte,
42.
Und aus des Hauſes Aſche zog ich ihn
Hervor, glaſirt, am andern Morgen,
glänzend,
Als käm’ er eben aus dem Töpferofen.
Walter.
Nun gut. Nun kennen wir den Krug. Nun
wiſſen
Wir Alles, was dem Krug geſchehn, was
nicht.
Was giebt’s jetzt weiter?
Frau Marthe
Nun dieſen Krug jetzt ſeht — den
Krug,
Nun dieſen Krug
jetzt ſeht — den Krug,
Nun dieſen Krug jetzt
ſeht,
Nun diesen Krug jetzt
seht,
Nun dieſen Krug jetzt
ſeht — den Krug,
Den Krug
Z
z
ertrüm̄ertIn Vers 733f übersieht Kleist
die Korrektur der versalen Versanfänge ›Zertrümmert‹
und ›Für‹. einen Krug noch werth, —
den Krug
Zertrüm̄ert einen
Krug noch werth, den Krug
Den Krug
zertrüm̄ert einen Krug noch werth, —
Den Krug, zertrümmert
einen Krug noch werth,
Zertruͤmmert einen Krug
noch werth, den Krug
Den Krug,
F
f
ür eines Fräuleins Mund, die Lippe
ſelbſt
Für eines Fräuleins
Mund, die Lippe ſelbſt
Den Krug, für
eines Fräuleins Mund, die Lippe
Den Krug, für eines
Fräuleins Mund, die Lippe
Fuͤr eines Fraͤuleins
Mund, die Lippe ſelbſt,
Nicht der Frau Erbſtatthalterinn zu
ſchlecht,
Den Krug, ihr hohen Herren Richter
beide,
Den Krug hat jener Schlingel mir
zerbrochen.
Adam.
Wer?
Frau Marthe
Er, der Ruprecht dort.
Ruprecht.
Das iſt gelogen,
Herr Richter.
Adam
Schweig’ er, bis man ihn fragen
wird.
Auch heut an ihn noch wird die Reihe
kom̄en.
— Habt ihr’s im Protokoll bemerkt?
— Habt ihr's im
Protocoll bemerkt.
— Habt ihr’s im
Protocoll bemerkt?
Licht.
O ja.
Adam.
Erzählt den Hergang, würdige Frau
Marthe.
43.
Frau Marthe.
Es war Uhr Eeilfe geſtern —
Adam.
Wann, ſagt ihr?
Frau Marthe
Uhr eilf.
Adam.
Am Morgen!
Frau Marthe.
Nein, verzeiht am Abend,
—
Nein, verzeiht am
Abend,
Nein, verzeiht am Abend
—
Nein, verzeiht! am Abend
—
Nein, verzeiht am
Abend,
Adam
/: wendet ſich, mit der Gebährde
des Erſchreckens :/
Frau Marthe
/: fortfahrend
:/Kleist fügt für die ›Phöbus‹-Überarbeitung
hier Regieanweisungen ein. In E steht Vers 744 in
der Fassung der Grundschicht.
Und ſchon die Lamp’ im Bette wollt’ ich
löſchen,
Als laute Männerſtim̄en, ein Tumult,
In meiner Tochter
abgelegnen Kam̄er,
In meiner Tochter
abgeleg'nen Kammer
In meiner Tochter
abgelegnen Kammer,
Als ob der Feind’ einbräche, mich
erſchreckt.
Geſchwind’ die Trepp’ eil’ ich hinab, ich
finde
Die Kam̄erthür gewaltſam eingeſprengt,
1Papierverderbtheit, so dass Kleists nachträglich
eingefügte Zeilenzählung (1, 2, 3, 4, 6, 7, 5) gar
nicht oder kaum noch (6, 7) erkennbar ist.
Schimpfreden ſchallen wüthend mir entgegen,
2 Und da ich mir den Auftritt jetzt
beleuchte,
3 Was find’ ich jetzt, Herr Richter, was
jetzt find’ ich?
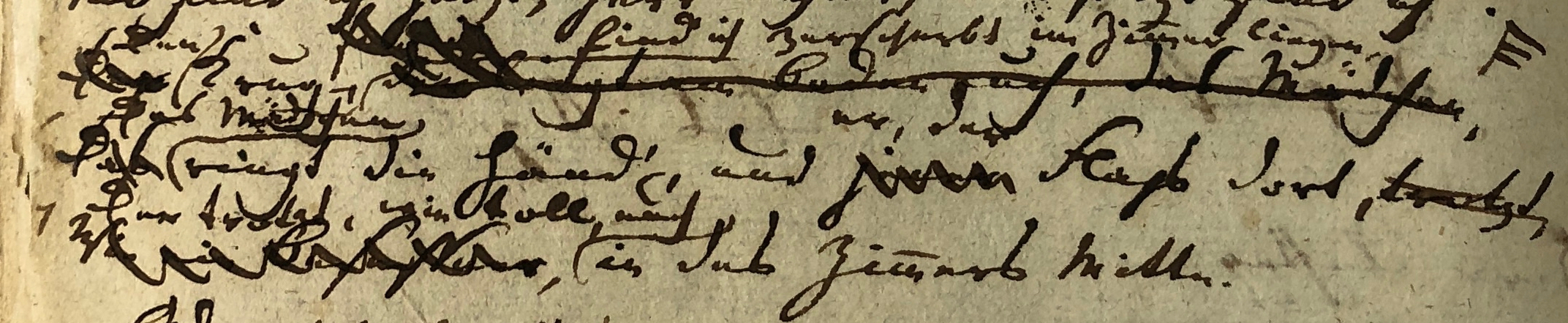 4 Der
Den
Krug,BKA liest das
gestrichene Komma hinter ›Krug‹ als eingefügten
Gedankenstrich.
find’ ich
der liegt am Boden euch, das Mädchen,
find’ ich zerſcherbt im Zim̄er liegen,
ᚫEinfügemarke: Kleist fügt in der Überarbeitung einen
Vers (5) hinzu, hier weiter unten Vers 755.
Der
Krug,
der liegt am Boden euch, das Mädchen,
Den Krug find
ich,Es ist unsicher, ob die
Variante b überhaupt intendiert war, zumal sie
klar gegen die Versmetrik verstößt. Für
wahrscheinlicher hält Verf. die Möglichkeit, dass
Kleist sofort nach Variante c korrigiert hat.
Jedenfalls wurden die Tilgungen von ›der liegt am
Boden euch, das Mädchen,‹ und ›find’ ich‹ getrennt
durchgeführt, erstere mit einem durchgehenden
Strich, letztere mit Schraffur. Möglich ist, dass
Kleist zunächst die längere Sequenz ›der liegt
...‹ gestrichen hat, danach die Korrektur begann
mit ›find’ ich‹, dieses aber aufgrund von
Platzproblemen zwischen den Zeilen wieder streicht
und neu ansetzte mit der Sequenz ›find’ ich
zerſcherbt im Zim̄er liegen,‹. In diesem Fall
würde Variante b entfallen.
der liegt am Boden euch, das Mädchen,
Den Krug find’
ich zerſcherbt im Zim̄er liegen,
Den Krug find’ ich
zerscherbt im Zimmer liegen,
Den Krug find’ ich
zerſcherbt im Zimmer liegen,
6 Das
Das Mädchen ringt die Händ’, und
jener
er, der Flaps dort,
trotzt,
Das ringt die
Händ’, und jener Flaps dort,
trotzt,
Das
Mädchen ringt die Händ’, und er,
der Flaps dort,
Das Mädchen ringt die
Hand', und er, der Flaps dort,
Das Maͤdchen ringt die
Haͤnd’, und er der Flaps dort,
7 Wie ein Beſeſſner,
Der trotzt, wie toll, euch in des Zim̄ers
Mitte.
Wie ein
Beſeſſner, in des Zim̄ers Mitte.
Der trotzt,
wie toll, euch in des Zim̄ers Mitte.
Der trotzt, wie toll,
euch in des Zimmers Mitte.
Der trotzt, wie toll,
euch in des Zimmers Mitte.
ᚫ 5 In
jedem Winkel liegt ein Stück,
In jedem
Winkel liegt ein Stück,
In jedem Winkel brüchig
liegt ein Stück,
In jedem Winkel liegt
ein Stuͤck,
Adam.
/: bankerott
:/
Ei, Wetter!
Frau Marthe.
Was?
Adam.
Sieh da, Frau Marthe!
Frau Marthe.
Ja.
Ja.
Ja! —
Drauf iſt’s, als ob in ſo
gerechtem Zorn
Drauf ist’s, als ob, in
so gerechtem Zorn,
Drauf iſt’s, als ob in
ſo gerechtem Zorn,
Mir noch zehn Arme wüchſen, jeglichen
44.
Fühl’ ich mir wie ein
Geier ausgerüſtet.
Fühl’ ich mir, wie ein
Geier, ausgerüstet.
Fuͤhl’ ich mir wie ein
Geier ausgeruͤſtet.
Ihn ſtell’ ich dort
zur
[BKA liest ›zu‹]
Rede, was er hier
Ihn stell’ ich dort zur
Rede, was er hier
Ihn ſtell’ ich dort zu
Rede, was er hier
In ſpäter Nacht zu ſuchen, mir die Krüge
Des Hauſes tobend einzuſchlagen habe:
Und er, zur Antwort giebt er mir, jetzt
rathet?
Der Unverſchämte! Der Hallunke, der!
Aufs Rad will ich ihn ſehen, oder mich
Nicht mehr geduldig auf den Rücken
legen:
Er ſpricht, es hab’ ein Anderer den Krug
Vom Simſ’ geſtürzt — ein Anderer, ich bitt’
euch,
Der vor ihm aus der Kam̄er nur
entwichen;
— Und überhäuft mit Schimpf mir da das
Mädchen.
Adam.
O! Faule
Fiſche
[BKA liest den ursprünglichen, dann
durch einen Gedankenstrich überschriebenen Punkt
nicht mit.]
[Hamacher liest den
ursprünglichen, dann durch einen Gedankenstrich
überschriebenen Punkt nicht mit.]
.
—
Laßt nur. Nun?
Hierauf?
O! Faule Fiſche.
Laßt nur. Nun?
O! Faule Fiſche
—
Hierauf?
O! Faule Fische —
hierauf!
O! faule Fiſche —
Hierauf?
Frau Marthe.
Auf dies Wort
Seh’ ich das Mädchen
fragend an, die ſteht
Seh ich das Mädchen
fragend an, die steht
Seh’ ich das Maͤdchen
fragend an; die ſteht
Gleich einer Leiche da, ich ſage: Eve! —
Sie ſetzt ſich: iſt’s ein
Anderer geweſen?,
Sie ſetzt ſich: iſt’s ein
Anderer geweſen?
Sie ſetzt ſich:
iſt’s ein Anderer geweſen,
Sie setzt sich: ist’s
ein Anderer gewesen,
Sie ſetzt ſich; iſt’s
ein Anderer geweſen,
Frag’ ich,?
uUnd Joſeph und Marie, ruft ſie,
Frag’ ich,
und Joſeph und Marie, ruft ſie,
Frag’
ich?
Und Joſeph und Marie, ruft ſie,
Frag’ ich? Und Joseph
und Marie, ruft sie,
Frag’ ich? Und Joſeph
und Marie, ruft ſie,
Was denkt ihr Mutter auch?
— So ſprich! Wer war’s?
Was denkt ihr Mutter
euch? — So sprich! Wer war’s?
Was denkt ihr Mutter
auch? — So ſprich! Wer war’s?
¿Getilgter Buchstabe am Zeilenanfang.
Unleserlich. Wer ſonſt, ſagt ſie, —
und wer auch konnt’ es anders?
Und ſchwört mir zu, daß er’s geweſen
iſt.
Eve.
Was ſchwor’ ich euch? Was hab’ ich euch
geſchworen?
Nichts ſchwor’ ich, nichts euch
—
Nichts schwor’ ich,
nichts euch —
Nichts ſchwor ich,
nichts euch —
Frau Marthe.
Eve!
Eve.
Nein! Dies verfälſcht
lügt
ihr —
Nein! Dies
verfälſcht ihr —
Nein! Dies lügt ihr
—
Nein! Dïes lügt ihr
—
Nein! Dies luͤgt ihr.
—
Ruprecht.
Da hört ihr’s.
45.
Adam.
Hund, jetzt, verfluchter,
ſchweig,
Soll hier die Fauſt den
Rachen dir nicht ſtopfen!
Soll hier die Faust den
Rachen dir nicht stopfen!
Soll hier die Fauſt den
Rachen dir noch ſtopfen!
Nachher iſt Zeit für dich, nicht jetzt.
Frau Marthe.
Du hätteſt nicht —?
Eve.
Nein! Mutter! Nein! Dies lügt
verfälſcht ihr,.
Nein! Mutter!
Nein! Dies lügt
ihr,
Nein! Mutter! Dies
verfälſcht ihr.
Nein Mutter! Dies
verfälscht ihr.
Nein, Mutter! Dies
verfaͤlſcht ihr.
Seht, leid thut’s in der That mir tief zur
Seele,
Daß ich es öffentlich erklären muß:
Doch nichts ſchwor ich, nichts, nichts hab’
ich geſchworen.
Adam.
Seid doch vernünftig, Kinder.
Licht.
/: für ſich :/
Ei, was Teufel
—?Das iſt ja ſeltſam.
Ei, was Teufel —?
Das iſt ja ſeltſam.
Das ist ja seltsam.
Das iſt ja ſeltſam.
Frau Marthe.
Du hätteſt mir, o Eve,
nicht verſichert —?
Du hättest mir, o Eve,
nicht versichert —?
Du haͤtteſt mir, o Eve,
nicht verſichert?
Nicht Joſeph und Mariea angerufen?
Nicht Joſeph und
Marie angerufen?
Nicht Joſeph und
Maria angerufen?
Nicht Joseph und Marie
angerufen?
Nicht Joſeph und Marie
angerufen?
Eve.
Beim Schwur nicht,!
ſSchwörend
nicht,!
ſSeht dies jetzt ſchwör’ ich,
Beim Schwur
nicht,
ſchwörend nicht,
ſeht dies jetzt ſchwör’ ich,
Beim Schwur nicht!
Schwörend nicht!
Seht dies jetzt ſchwör’ ich,
Beim Schwur nicht!
Schwörend nicht! Seht dies jetzt schwör’ ich,
Beim Schwur nicht!
Schwoͤrend nicht! Seht dies jetzt ſchwoͤr’ ich,
Und Joſeph und Maria ruf’
ich an.
Und Joseph und Marie
ruf’ ich an.
Und Joſeph und Maria ruf
ich an.
Adam.
Ei, Leutchen! Ei, Frau Marthe! Was auch
macht ſie?
Wie ſchüchtert ſie das gute Kind auch
ein.
Wenn ſich die Jungfer wird beſonnen
haben,
Erinnert ruhig deſſen, was geſchehen,
— Ich ſage, was geſchehen
iſt, und was,
— Ich sage, was
geschehen ist,
und was,
— Ich ſage was geſchehen
iſt, und
was,
Spricht ſie nicht, wie ſie ſoll, geſchehn
noch kann:
Gebt Acht, ſo ſagt ſie heute’
uns aus, wie geſtern,
Gebt Acht, ſo ſagt ſie
heute aus, wie geſtern,
Gebt Acht, ſo ſagt ſie
heut’
uns aus, wie geſtern,
Gebt Acht, so sagt sie
heut uns aus, wie gestern,
Gebt Acht, ſo ſagt ſie
heut uns aus, wie geſtern,
46.
Gleichviel, ob ſie’s
beſchwören kann, ob nicht.
Gleichviel, ob sie’s
beschwören kann, ob nicht,
Gleichviel, ob ſie’s
beſchwoͤren kann ob nicht.
Laßt Joſeph und Maria aus
dem Spiele.
Laſst Joseph und Marie
aus dem Spiele.
Laßt Joſeph und Maria
aus dem Spiele.
Walter.
4 Der
Den
Krug,BKA liest das
gestrichene Komma hinter ›Krug‹ als eingefügten
Gedankenstrich.
find’ ich
der liegt am Boden euch, das Mädchen,
find’ ich zerſcherbt im Zim̄er liegen,
ᚫEinfügemarke: Kleist fügt in der Überarbeitung einen
Vers (5) hinzu, hier weiter unten Vers 755.
Der
Krug,
der liegt am Boden euch, das Mädchen,
Den Krug find
ich,Es ist unsicher, ob die
Variante b überhaupt intendiert war, zumal sie
klar gegen die Versmetrik verstößt. Für
wahrscheinlicher hält Verf. die Möglichkeit, dass
Kleist sofort nach Variante c korrigiert hat.
Jedenfalls wurden die Tilgungen von ›der liegt am
Boden euch, das Mädchen,‹ und ›find’ ich‹ getrennt
durchgeführt, erstere mit einem durchgehenden
Strich, letztere mit Schraffur. Möglich ist, dass
Kleist zunächst die längere Sequenz ›der liegt
...‹ gestrichen hat, danach die Korrektur begann
mit ›find’ ich‹, dieses aber aufgrund von
Platzproblemen zwischen den Zeilen wieder streicht
und neu ansetzte mit der Sequenz ›find’ ich
zerſcherbt im Zim̄er liegen,‹. In diesem Fall
würde Variante b entfallen.
der liegt am Boden euch, das Mädchen,
Den Krug find’
ich zerſcherbt im Zim̄er liegen,
Den Krug find’ ich
zerscherbt im Zimmer liegen,
Den Krug find’ ich
zerſcherbt im Zimmer liegen,
6 Das
Das Mädchen ringt die Händ’, und
jener
er, der Flaps dort,
trotzt,
Das ringt die
Händ’, und jener Flaps dort,
trotzt,
Das
Mädchen ringt die Händ’, und er,
der Flaps dort,
Das Mädchen ringt die
Hand', und er, der Flaps dort,
Das Maͤdchen ringt die
Haͤnd’, und er der Flaps dort,
7 Wie ein Beſeſſner,
Der trotzt, wie toll, euch in des Zim̄ers
Mitte.
Wie ein
Beſeſſner, in des Zim̄ers Mitte.
Der trotzt,
wie toll, euch in des Zim̄ers Mitte.
Der trotzt, wie toll,
euch in des Zimmers Mitte.
Der trotzt, wie toll,
euch in des Zimmers Mitte.
ᚫ 5 In
jedem Winkel liegt ein Stück,
In jedem
Winkel liegt ein Stück,
In jedem Winkel brüchig
liegt ein Stück,
In jedem Winkel liegt
ein Stuͤck,
Adam.
/: bankerott
:/
Ei, Wetter!
Frau Marthe.
Was?
Adam.
Sieh da, Frau Marthe!
Frau Marthe.
Ja.
Ja.
Ja! —
Drauf iſt’s, als ob in ſo
gerechtem Zorn
Drauf ist’s, als ob, in
so gerechtem Zorn,
Drauf iſt’s, als ob in
ſo gerechtem Zorn,
Mir noch zehn Arme wüchſen, jeglichen
44.
Fühl’ ich mir wie ein
Geier ausgerüſtet.
Fühl’ ich mir, wie ein
Geier, ausgerüstet.
Fuͤhl’ ich mir wie ein
Geier ausgeruͤſtet.
Ihn ſtell’ ich dort
zur
[BKA liest ›zu‹]
Rede, was er hier
Ihn stell’ ich dort zur
Rede, was er hier
Ihn ſtell’ ich dort zu
Rede, was er hier
In ſpäter Nacht zu ſuchen, mir die Krüge
Des Hauſes tobend einzuſchlagen habe:
Und er, zur Antwort giebt er mir, jetzt
rathet?
Der Unverſchämte! Der Hallunke, der!
Aufs Rad will ich ihn ſehen, oder mich
Nicht mehr geduldig auf den Rücken
legen:
Er ſpricht, es hab’ ein Anderer den Krug
Vom Simſ’ geſtürzt — ein Anderer, ich bitt’
euch,
Der vor ihm aus der Kam̄er nur
entwichen;
— Und überhäuft mit Schimpf mir da das
Mädchen.
Adam.
O! Faule
Fiſche
[BKA liest den ursprünglichen, dann
durch einen Gedankenstrich überschriebenen Punkt
nicht mit.]
[Hamacher liest den
ursprünglichen, dann durch einen Gedankenstrich
überschriebenen Punkt nicht mit.]
.
—
Laßt nur. Nun?
Hierauf?
O! Faule Fiſche.
Laßt nur. Nun?
O! Faule Fiſche
—
Hierauf?
O! Faule Fische —
hierauf!
O! faule Fiſche —
Hierauf?
Frau Marthe.
Auf dies Wort
Seh’ ich das Mädchen
fragend an, die ſteht
Seh ich das Mädchen
fragend an, die steht
Seh’ ich das Maͤdchen
fragend an; die ſteht
Gleich einer Leiche da, ich ſage: Eve! —
Sie ſetzt ſich: iſt’s ein
Anderer geweſen?,
Sie ſetzt ſich: iſt’s ein
Anderer geweſen?
Sie ſetzt ſich:
iſt’s ein Anderer geweſen,
Sie setzt sich: ist’s
ein Anderer gewesen,
Sie ſetzt ſich; iſt’s
ein Anderer geweſen,
Frag’ ich,?
uUnd Joſeph und Marie, ruft ſie,
Frag’ ich,
und Joſeph und Marie, ruft ſie,
Frag’
ich?
Und Joſeph und Marie, ruft ſie,
Frag’ ich? Und Joseph
und Marie, ruft sie,
Frag’ ich? Und Joſeph
und Marie, ruft ſie,
Was denkt ihr Mutter auch?
— So ſprich! Wer war’s?
Was denkt ihr Mutter
euch? — So sprich! Wer war’s?
Was denkt ihr Mutter
auch? — So ſprich! Wer war’s?
¿Getilgter Buchstabe am Zeilenanfang.
Unleserlich. Wer ſonſt, ſagt ſie, —
und wer auch konnt’ es anders?
Und ſchwört mir zu, daß er’s geweſen
iſt.
Eve.
Was ſchwor’ ich euch? Was hab’ ich euch
geſchworen?
Nichts ſchwor’ ich, nichts euch
—
Nichts schwor’ ich,
nichts euch —
Nichts ſchwor ich,
nichts euch —
Frau Marthe.
Eve!
Eve.
Nein! Dies verfälſcht
lügt
ihr —
Nein! Dies
verfälſcht ihr —
Nein! Dies lügt ihr
—
Nein! Dïes lügt ihr
—
Nein! Dies luͤgt ihr.
—
Ruprecht.
Da hört ihr’s.
45.
Adam.
Hund, jetzt, verfluchter,
ſchweig,
Soll hier die Fauſt den
Rachen dir nicht ſtopfen!
Soll hier die Faust den
Rachen dir nicht stopfen!
Soll hier die Fauſt den
Rachen dir noch ſtopfen!
Nachher iſt Zeit für dich, nicht jetzt.
Frau Marthe.
Du hätteſt nicht —?
Eve.
Nein! Mutter! Nein! Dies lügt
verfälſcht ihr,.
Nein! Mutter!
Nein! Dies lügt
ihr,
Nein! Mutter! Dies
verfälſcht ihr.
Nein Mutter! Dies
verfälscht ihr.
Nein, Mutter! Dies
verfaͤlſcht ihr.
Seht, leid thut’s in der That mir tief zur
Seele,
Daß ich es öffentlich erklären muß:
Doch nichts ſchwor ich, nichts, nichts hab’
ich geſchworen.
Adam.
Seid doch vernünftig, Kinder.
Licht.
/: für ſich :/
Ei, was Teufel
—?Das iſt ja ſeltſam.
Ei, was Teufel —?
Das iſt ja ſeltſam.
Das ist ja seltsam.
Das iſt ja ſeltſam.
Frau Marthe.
Du hätteſt mir, o Eve,
nicht verſichert —?
Du hättest mir, o Eve,
nicht versichert —?
Du haͤtteſt mir, o Eve,
nicht verſichert?
Nicht Joſeph und Mariea angerufen?
Nicht Joſeph und
Marie angerufen?
Nicht Joſeph und
Maria angerufen?
Nicht Joseph und Marie
angerufen?
Nicht Joſeph und Marie
angerufen?
Eve.
Beim Schwur nicht,!
ſSchwörend
nicht,!
ſSeht dies jetzt ſchwör’ ich,
Beim Schwur
nicht,
ſchwörend nicht,
ſeht dies jetzt ſchwör’ ich,
Beim Schwur nicht!
Schwörend nicht!
Seht dies jetzt ſchwör’ ich,
Beim Schwur nicht!
Schwörend nicht! Seht dies jetzt schwör’ ich,
Beim Schwur nicht!
Schwoͤrend nicht! Seht dies jetzt ſchwoͤr’ ich,
Und Joſeph und Maria ruf’
ich an.
Und Joseph und Marie
ruf’ ich an.
Und Joſeph und Maria ruf
ich an.
Adam.
Ei, Leutchen! Ei, Frau Marthe! Was auch
macht ſie?
Wie ſchüchtert ſie das gute Kind auch
ein.
Wenn ſich die Jungfer wird beſonnen
haben,
Erinnert ruhig deſſen, was geſchehen,
— Ich ſage, was geſchehen
iſt, und was,
— Ich sage, was
geschehen ist,
und was,
— Ich ſage was geſchehen
iſt, und
was,
Spricht ſie nicht, wie ſie ſoll, geſchehn
noch kann:
Gebt Acht, ſo ſagt ſie heute’
uns aus, wie geſtern,
Gebt Acht, ſo ſagt ſie
heute aus, wie geſtern,
Gebt Acht, ſo ſagt ſie
heut’
uns aus, wie geſtern,
Gebt Acht, so sagt sie
heut uns aus, wie gestern,
Gebt Acht, ſo ſagt ſie
heut uns aus, wie geſtern,
46.
Gleichviel, ob ſie’s
beſchwören kann, ob nicht.
Gleichviel, ob sie’s
beschwören kann, ob nicht,
Gleichviel, ob ſie’s
beſchwoͤren kann ob nicht.
Laßt Joſeph und Maria aus
dem Spiele.
Laſst Joseph und Marie
aus dem Spiele.
Laßt Joſeph und Maria
aus dem Spiele.
Walter.
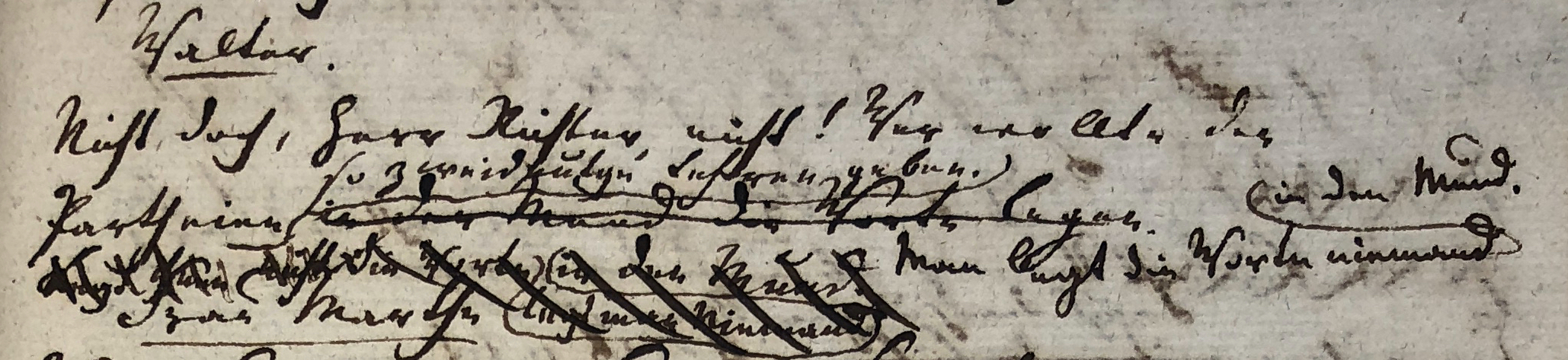 Nicht doch, Herr Richter, nicht! Wer wollte
den
Partheien in den Mund
die Worte legen.
ſo zweideutge Lehren
geben.
Partheien in den Mund die
Worte legen.
Partheien ſo
zweideutge Lehren geben.
Partheien so zweideut’ge
Lehren geben.
Partheien ſo zweideut’ge
Lehren geben.
Legt ihnen nicht dDie Worte legt man Niemand in
den Mund.Man legt die Worte niemand
in den Mund.
Legt ihnen nicht
die Worte in den Mund.
Die Worte legt
man Niemand in den Mund!
Man legt die Worte niemand in den
Mund.
Man legt die Worte
niemand in den Mund.
[ ]
Frau Marthe
Wenn ſie in’s Angeſicht
mir ſagen kann,
Wenn sie ins Angesicht
mir sagen kann,
Wenn ſie in’s Angeſicht
mir ſagen kann,
Schamlos, die liederliche
Dirne, die,
Schamlos, die lüderliche
Dirne, die,
Schamlos, die
liederliche Dirne, die,
Daß es ein Andrer, als der
Ruprecht war,
Daſs es ein Andrer als
der Ruprecht war,
Daß es ein Andrer, als
der Ruprecht war,
So mag meintwegen ſie — ich mag nicht ſagen,
was.
Ich aber, ich verſichr’ es euch, Herr
Richter,
Und kann ich gleich nicht, daß ſie’s ſchwor,
behaupten,
Daß ſie’s geſagt hat geſtern, das beſchwör’
ich,
Und Joſeph und Maria ruf’
ich an.
Und Joseph und Marie
ruf’ ich an.
Und Joſeph und Maria
ruf’ ich an.
Adam.
Nun weiter will ja auch die Jungfer —
Walter.
Herr Richter!
Adam.
Ew. Gnaden? — Was ſagt er? — Nicht, Herzens-Evchen?
Ew. Gnaden? — Was ſagt er? —
Nicht, Evchen?
Ew. Gnaden? — Was ſagt
er? — Nicht, Herzens-Evchen?
Ew. Gnaden? — Was sagt
er? — Nicht, Herzens-Evchen?
Ew. Gnaden? — Was ſagt
er? Nicht, Herzens-Evchen?
Frau Marthe
Heraus damit! Haſt du’s
mir nicht geſagt?
Hinaus damit! Hast du's
mir nicht gesagt?
Heraus damit! Haſt du’s
mir nicht geſagt?
Haſt du’s mir geſtern nicht, mir nicht
geſagt?
Eve.
Wer läugnet euch, daß ich’s
geſagt —
Wer leugnet euch, daſs
ich’ gesagt —
Wer laͤugnet euch, daß
ich’s geſagt —
Adam.
Da habt ihr’s.
Ruprecht.
Die Metze, die!
Adam.
Schreibt auf.
Veit.
Pfui, ſchäm’ ſie ſich.
47.
Walter.
Von eurer Aufführung, Herr Richter Adam,
Nicht doch, Herr Richter, nicht! Wer wollte
den
Partheien in den Mund
die Worte legen.
ſo zweideutge Lehren
geben.
Partheien in den Mund die
Worte legen.
Partheien ſo
zweideutge Lehren geben.
Partheien so zweideut’ge
Lehren geben.
Partheien ſo zweideut’ge
Lehren geben.
Legt ihnen nicht dDie Worte legt man Niemand in
den Mund.Man legt die Worte niemand
in den Mund.
Legt ihnen nicht
die Worte in den Mund.
Die Worte legt
man Niemand in den Mund!
Man legt die Worte niemand in den
Mund.
Man legt die Worte
niemand in den Mund.
[ ]
Frau Marthe
Wenn ſie in’s Angeſicht
mir ſagen kann,
Wenn sie ins Angesicht
mir sagen kann,
Wenn ſie in’s Angeſicht
mir ſagen kann,
Schamlos, die liederliche
Dirne, die,
Schamlos, die lüderliche
Dirne, die,
Schamlos, die
liederliche Dirne, die,
Daß es ein Andrer, als der
Ruprecht war,
Daſs es ein Andrer als
der Ruprecht war,
Daß es ein Andrer, als
der Ruprecht war,
So mag meintwegen ſie — ich mag nicht ſagen,
was.
Ich aber, ich verſichr’ es euch, Herr
Richter,
Und kann ich gleich nicht, daß ſie’s ſchwor,
behaupten,
Daß ſie’s geſagt hat geſtern, das beſchwör’
ich,
Und Joſeph und Maria ruf’
ich an.
Und Joseph und Marie
ruf’ ich an.
Und Joſeph und Maria
ruf’ ich an.
Adam.
Nun weiter will ja auch die Jungfer —
Walter.
Herr Richter!
Adam.
Ew. Gnaden? — Was ſagt er? — Nicht, Herzens-Evchen?
Ew. Gnaden? — Was ſagt er? —
Nicht, Evchen?
Ew. Gnaden? — Was ſagt
er? — Nicht, Herzens-Evchen?
Ew. Gnaden? — Was sagt
er? — Nicht, Herzens-Evchen?
Ew. Gnaden? — Was ſagt
er? Nicht, Herzens-Evchen?
Frau Marthe
Heraus damit! Haſt du’s
mir nicht geſagt?
Hinaus damit! Hast du's
mir nicht gesagt?
Heraus damit! Haſt du’s
mir nicht geſagt?
Haſt du’s mir geſtern nicht, mir nicht
geſagt?
Eve.
Wer läugnet euch, daß ich’s
geſagt —
Wer leugnet euch, daſs
ich’ gesagt —
Wer laͤugnet euch, daß
ich’s geſagt —
Adam.
Da habt ihr’s.
Ruprecht.
Die Metze, die!
Adam.
Schreibt auf.
Veit.
Pfui, ſchäm’ ſie ſich.
47.
Walter.
Von eurer Aufführung, Herr Richter Adam,
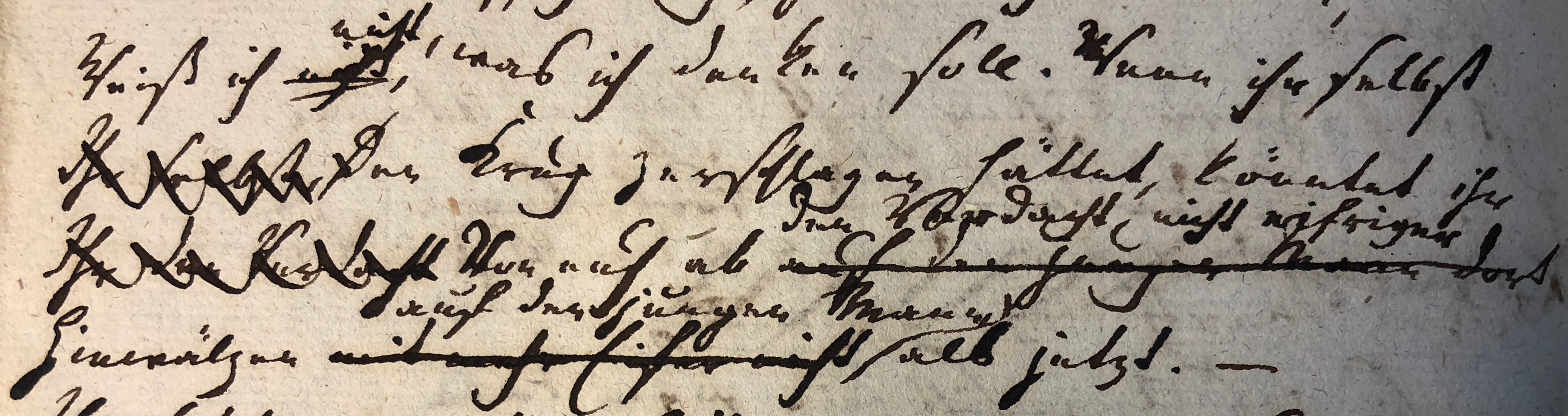 Weiß ich nicht,
nicht, was ich denken ſoll. Wenn ihr ſelbſt
Weiß ich nicht, was ich
denken ſoll. Wenn
Weiß ich nicht, was
ich denken ſoll. Wenn ihr ſelbſt
Weiſs ich nicht, was ich
denken soll. Wenn ihr selbst
Weiß ich nicht, was ich
denken ſoll. Wenn ihr ſelbſt
Ihr ſelbſt,
dDen Krug zerſchlagen hättet,
könntet ihr
Ihr ſelbſt,
den Krug zerſchlagen hättet, könntet
Den Krug
zerſchlagen hättet, könntet ihr
Den Krug zerschlagen
hättet, könntet ihr
Den Krug zerſchlagen
haͤttet, koͤnntet ihr
Ihr den Verdacht
vVon euch ab auf den jungen Mann dort
den Verdacht nicht
eifriger
Ihr den Verdacht
von euch ab auf den jungen Mann
dort
Von euch ab
den Verdacht nicht eifriger
Von euch ab den Verdacht
nicht eifriger
Von euch ab den Verdacht
nicht eifriger
Hinwälzen mit mehr Eifer
nicht
auf den jungen Mann,
als jetzt. —
Hinwälzen mit mehr
Eifer nicht als jetzt. —
Hinwälzen auf
den jungen Mann, als jetzt. —
Hinwälzen auf den jungen
Mann als jetzt. —
Hinwaͤlzen auf den
jungen Mann, als jetzt. —
Ihr ſetzt nicht mehr in’s
Protokoll, Herr Schreiber,
Ihr setzt nicht mehr
in insNicht
korrigierter Satzfehler im ›Phöbus‹.
Protokoll, Herr Schreiber,
Ihr ſetzt nicht mehr ins
Protokoll, Herr Schreiber,
Als nur der Jungfer Eingeſtändniß, hoff’
ich,
Vom geſtrigen
EingGeſtändniß,
hoff’ ich, nicht vom
Facto.
Vom
Eingeſtändniß, hoff’ ich, nicht vom
Facto.
Vom
geſtrigen
Geſtändniß, nicht vom Facto.
Vom gestrigen
Geständniſs, nicht vom Facto.
Vom geſtrigen
Geſtaͤndniß, nicht vom Facto.
— Iſt’s an die Jungfer jetzt ſchon
auszuſagen?
Adam.
Weiß ich nicht,
nicht, was ich denken ſoll. Wenn ihr ſelbſt
Weiß ich nicht, was ich
denken ſoll. Wenn
Weiß ich nicht, was
ich denken ſoll. Wenn ihr ſelbſt
Weiſs ich nicht, was ich
denken soll. Wenn ihr selbst
Weiß ich nicht, was ich
denken ſoll. Wenn ihr ſelbſt
Ihr ſelbſt,
dDen Krug zerſchlagen hättet,
könntet ihr
Ihr ſelbſt,
den Krug zerſchlagen hättet, könntet
Den Krug
zerſchlagen hättet, könntet ihr
Den Krug zerschlagen
hättet, könntet ihr
Den Krug zerſchlagen
haͤttet, koͤnntet ihr
Ihr den Verdacht
vVon euch ab auf den jungen Mann dort
den Verdacht nicht
eifriger
Ihr den Verdacht
von euch ab auf den jungen Mann
dort
Von euch ab
den Verdacht nicht eifriger
Von euch ab den Verdacht
nicht eifriger
Von euch ab den Verdacht
nicht eifriger
Hinwälzen mit mehr Eifer
nicht
auf den jungen Mann,
als jetzt. —
Hinwälzen mit mehr
Eifer nicht als jetzt. —
Hinwälzen auf
den jungen Mann, als jetzt. —
Hinwälzen auf den jungen
Mann als jetzt. —
Hinwaͤlzen auf den
jungen Mann, als jetzt. —
Ihr ſetzt nicht mehr in’s
Protokoll, Herr Schreiber,
Ihr setzt nicht mehr
in insNicht
korrigierter Satzfehler im ›Phöbus‹.
Protokoll, Herr Schreiber,
Ihr ſetzt nicht mehr ins
Protokoll, Herr Schreiber,
Als nur der Jungfer Eingeſtändniß, hoff’
ich,
Vom geſtrigen
EingGeſtändniß,
hoff’ ich, nicht vom
Facto.
Vom
Eingeſtändniß, hoff’ ich, nicht vom
Facto.
Vom
geſtrigen
Geſtändniß, nicht vom Facto.
Vom gestrigen
Geständniſs, nicht vom Facto.
Vom geſtrigen
Geſtaͤndniß, nicht vom Facto.
— Iſt’s an die Jungfer jetzt ſchon
auszuſagen?
Adam.
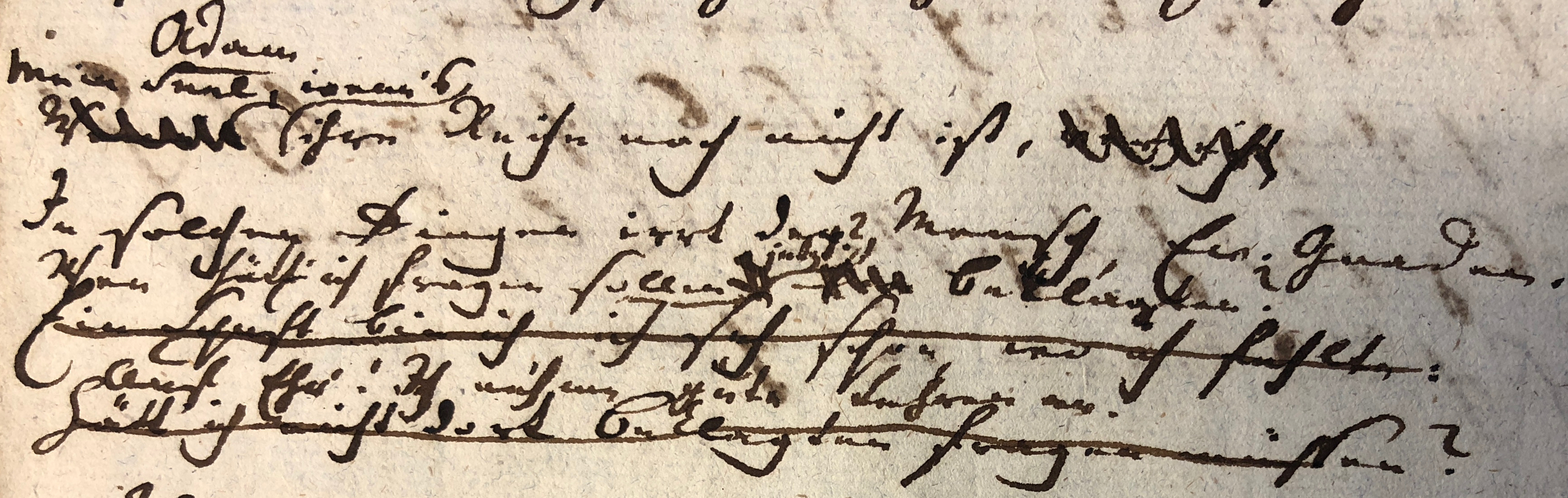 Wenn’s
Mein Seel, wenn’s ihre
Reihe noch nicht iſt, verzeiht,
Wenn’s ihre Reihe
noch nicht iſt, verzeiht,
Mein Seel, wenn’s ihre Reihe noch nicht
iſt,
Mein Seel, wenn’s ihre
Reihe noch nicht ist,
Mein Seel, wenn’s ihre
Reihe noch nicht iſt,
In ſolchen Dingen irrt der
Menſch, Ew. Gnaden.
In solchen Dingen irrt
der Mensch, Ew. Gnaden!
In ſolchen Dingen irrt
der Menſch, Ew. Gnaden.
Ein Schuft bin ich, ich
ſeh
Liest ›ſeh’‹. BKA liest ›ſeh’‹.
Das Artefakt scheint eher durch
Tintendurchschlag bedingt zu sein.
ſchon, wo ich fehlte:
Wen hätt’ ich fragen
ſollen?
jetzt?
Den Beklagten?
Ein Schuft bin ich, ich ſeh
ſchon wo ich fehlte:
Wen hätt’ ich fragen
ſollen?
Den Beklagten?
Wen hätt’ ich
fragen ſollen jetzt? Beklagten?
Wen hätt’ ich fragen
sollen jetzt? Beklagten?
Wen haͤtt’ ich fragen
ſollen jetzt? Beklagten?
Hätt’ ich nicht dort
Beklagten fragen müſſen?
Auf Ehr’! Ich nehme gute
Lehren an.
Hätt’ ich nicht dort
Beklagten fragen müſſen?
Auf Ehr’! Ich
nehme gute Lehren an.
Auf Ehr’! ich nehme gute
Lehre an.
Auf Ehr’! Ich nehme gute
Lehre an.
Walter.
Wenn’s
Mein Seel, wenn’s ihre
Reihe noch nicht iſt, verzeiht,
Wenn’s ihre Reihe
noch nicht iſt, verzeiht,
Mein Seel, wenn’s ihre Reihe noch nicht
iſt,
Mein Seel, wenn’s ihre
Reihe noch nicht ist,
Mein Seel, wenn’s ihre
Reihe noch nicht iſt,
In ſolchen Dingen irrt der
Menſch, Ew. Gnaden.
In solchen Dingen irrt
der Mensch, Ew. Gnaden!
In ſolchen Dingen irrt
der Menſch, Ew. Gnaden.
Ein Schuft bin ich, ich
ſeh
Liest ›ſeh’‹. BKA liest ›ſeh’‹.
Das Artefakt scheint eher durch
Tintendurchschlag bedingt zu sein.
ſchon, wo ich fehlte:
Wen hätt’ ich fragen
ſollen?
jetzt?
Den Beklagten?
Ein Schuft bin ich, ich ſeh
ſchon wo ich fehlte:
Wen hätt’ ich fragen
ſollen?
Den Beklagten?
Wen hätt’ ich
fragen ſollen jetzt? Beklagten?
Wen hätt’ ich fragen
sollen jetzt? Beklagten?
Wen haͤtt’ ich fragen
ſollen jetzt? Beklagten?
Hätt’ ich nicht dort
Beklagten fragen müſſen?
Auf Ehr’! Ich nehme gute
Lehren an.
Hätt’ ich nicht dort
Beklagten fragen müſſen?
Auf Ehr’! Ich
nehme gute Lehren an.
Auf Ehr’! ich nehme gute
Lehre an.
Auf Ehr’! Ich nehme gute
Lehre an.
Walter.
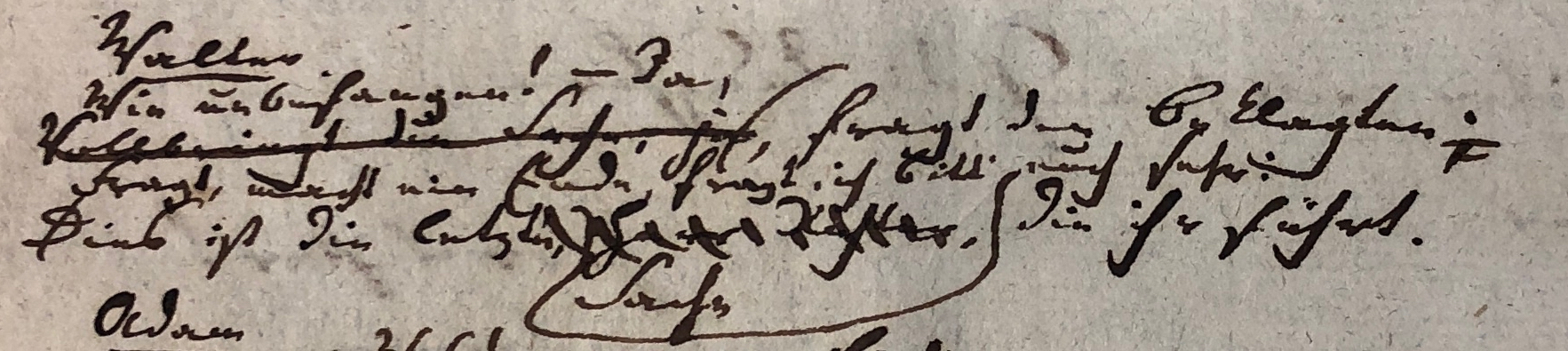 Vollbringt die Sache,
ja,
Wie unbefangen! — Ja, fragt
den Beklagten,.
Vollbringt die Sache,
ja, fragt den Beklagten,
Wie
unbefangen! — Ja, fragt den
Beklagten.
Wie unbefangen! — Ja,
fragt den Beklagten.
Wie unbefangen! — Ja,
fragt den Beklagten.
Fragt, macht ein
Ende, fragt, ich bitt’ euch ſehr:
[ ]
Fragt, macht
ein Ende, fragt, ich bitt’ euch ſehr:
Fragt, macht ein Ende,
fragt, ich bitt’ euch sehr:
Fragt, macht ein Ende,
fragt, ich bitt’ euch ſehr:
Dies
liest ›Die‹
iſt die letzt’e,
Herr Richter
Sache, die ihr führt.
Dies iſt die
letzt’,
Herr Richter, die ihr führt.
Dies iſt die
letzte
Sache, die ihr führt.
Dies ist die letzte
Sache, die ihr führt.
Dies iſt die letzte
Sache, die ihr fuͤhrt.
Adam.
Vollbringt die Sache,
ja,
Wie unbefangen! — Ja, fragt
den Beklagten,.
Vollbringt die Sache,
ja, fragt den Beklagten,
Wie
unbefangen! — Ja, fragt den
Beklagten.
Wie unbefangen! — Ja,
fragt den Beklagten.
Wie unbefangen! — Ja,
fragt den Beklagten.
Fragt, macht ein
Ende, fragt, ich bitt’ euch ſehr:
[ ]
Fragt, macht
ein Ende, fragt, ich bitt’ euch ſehr:
Fragt, macht ein Ende,
fragt, ich bitt’ euch sehr:
Fragt, macht ein Ende,
fragt, ich bitt’ euch ſehr:
Dies
liest ›Die‹
iſt die letzt’e,
Herr Richter
Sache, die ihr führt.
Dies iſt die
letzt’,
Herr Richter, die ihr führt.
Dies iſt die
letzte
Sache, die ihr führt.
Dies ist die letzte
Sache, die ihr führt.
Dies iſt die letzte
Sache, die ihr fuͤhrt.
Adam.
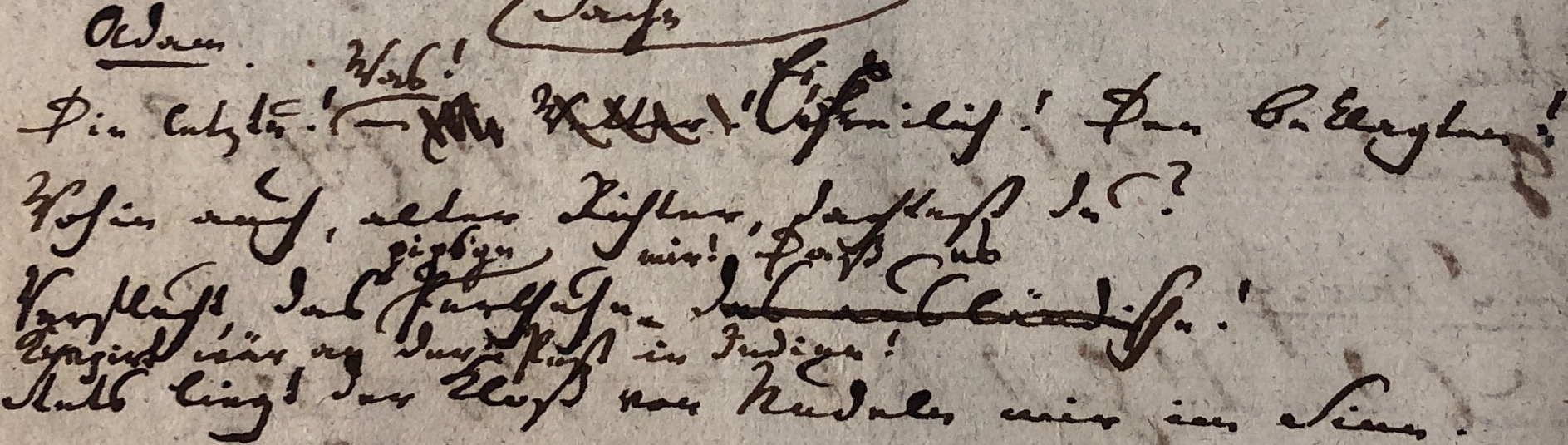 Die letzt’e! Was! — Ei, Wetter!
Ei,
Ffreilich! Den Beklagten!
Die letzt’! —
Ei, Wetter!
Freilich! Den Beklagten!
Die
letzte! Was! —
Ei,
freilich! Den Beklagten!
Die letzte! Was! Ei,
freilich! Den Beklagten!
Die letzte! Was! Ei
freilich! Den Beklagten!
Wohin auch, alter Richter, dachteſt du?
Verflucht, das pips’ge Perlhuhn,
das ausländiſche!
mir! Daß es
Verflucht, das
Perlhuhn, das ausländiſche!
Verflucht, das
pips’ge Perlhuhn mir! Daß
es
Verflucht, das pips’ge
Perlhuhn mir! Daſs es
Verflucht, das pips’ge
Perlhuhn mir! Daß es
Krepirt wär an der
Peſt in Indien!
[ ]
Krepirt wär an
der Peſt in Indien!
Krepirt wär’ an der Pest
in Indien!
Krepirt waͤr an der Peſt
in Indien!
Stets liegt der Kloß von Nudeln mir im
Sinn.
Walter.
Die letzt’e! Was! — Ei, Wetter!
Ei,
Ffreilich! Den Beklagten!
Die letzt’! —
Ei, Wetter!
Freilich! Den Beklagten!
Die
letzte! Was! —
Ei,
freilich! Den Beklagten!
Die letzte! Was! Ei,
freilich! Den Beklagten!
Die letzte! Was! Ei
freilich! Den Beklagten!
Wohin auch, alter Richter, dachteſt du?
Verflucht, das pips’ge Perlhuhn,
das ausländiſche!
mir! Daß es
Verflucht, das
Perlhuhn, das ausländiſche!
Verflucht, das
pips’ge Perlhuhn mir! Daß
es
Verflucht, das pips’ge
Perlhuhn mir! Daſs es
Verflucht, das pips’ge
Perlhuhn mir! Daß es
Krepirt wär an der
Peſt in Indien!
[ ]
Krepirt wär an
der Peſt in Indien!
Krepirt wär’ an der Pest
in Indien!
Krepirt waͤr an der Peſt
in Indien!
Stets liegt der Kloß von Nudeln mir im
Sinn.
Walter.
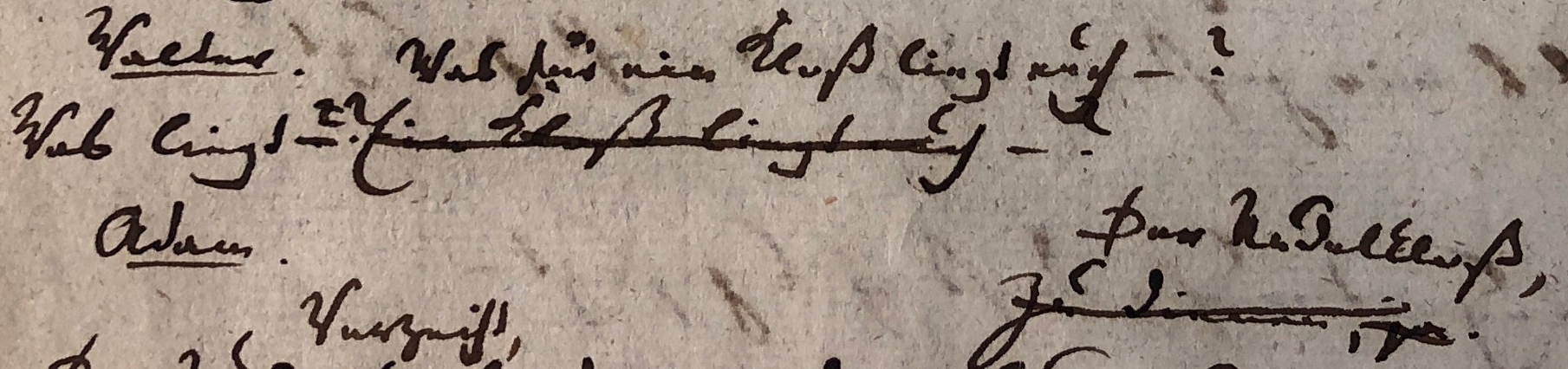 Was liegt?
—?
Ein Kloß liegt euch —?
Was für ein Kloß liegt euch
—?
Was liegt?
Ein Kloß liegt euch —?
Was liegt
—?
Was für ein Kloß liegt euch —?
Was liegt — Was für ein
Kloſs liegt euch—? Adam.
Was liegt? Was fuͤr ein
Kloß liegt euch —?
Adam.
Zu dienen,
ja. +Der
Nudelkloß,+
Zu dienen,
ja.
Der
Nudelkloß,
Der Nudelkloſs,
Der Nudelkloß,
Was liegt?
—?
Ein Kloß liegt euch —?
Was für ein Kloß liegt euch
—?
Was liegt?
Ein Kloß liegt euch —?
Was liegt
—?
Was für ein Kloß liegt euch —?
Was liegt — Was für ein
Kloſs liegt euch—? Adam.
Was liegt? Was fuͤr ein
Kloß liegt euch —?
Adam.
Zu dienen,
ja. +Der
Nudelkloß,+
Zu dienen,
ja.
Der
Nudelkloß,
Der Nudelkloſs,
Der Nudelkloß,
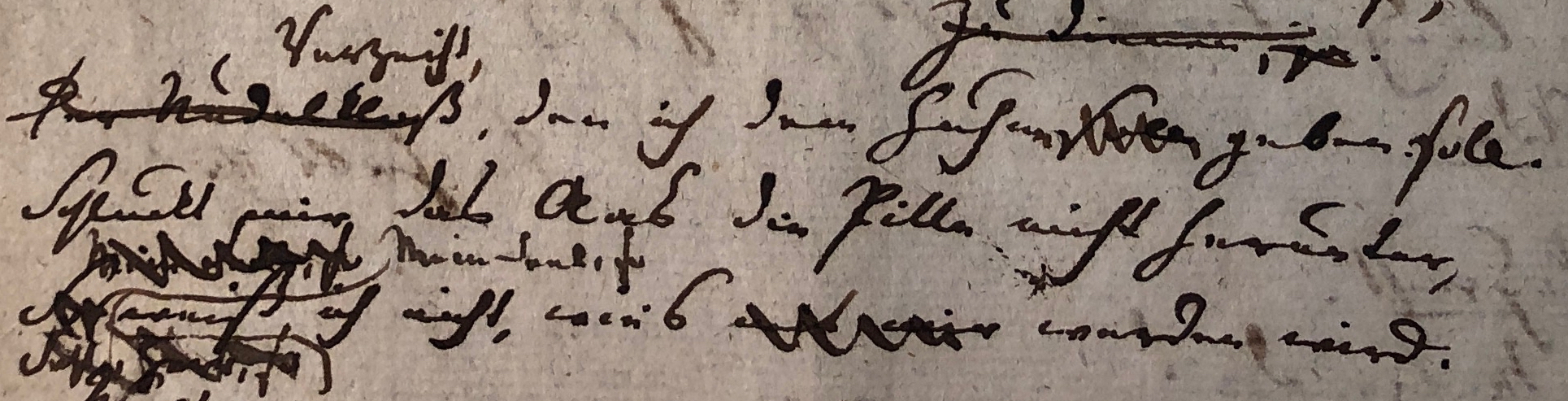 Der Nudelkloß,
Verzeiht, den ich dem
Huhne
ſoll geben.
ſoll.
Der Nudelkloß,
den ich dem Huhn ſoll geben.
Verzeiht, den ich dem Huhne
geben ſoll.
Verzeiht, den ich dem
Huhne geben soll.
Verzeiht, den ich dem
Huhne geben ſoll.
Schluckt mir das Aas die Pille nicht
herunter,
So
Mein Seel, ſo
Seht, Herr, ſo
Mein Seel, ſo weiß ich
nicht, wie’s mit mir werden
wird.
So weiß ich
nicht, wie’s mit mir werden wird.
Mein Seel,
ſoweiß ich nicht, wie’s werden
wird.
Seht, Herr,
ſo weiß ich nicht, wie’s werden
wird.
Mein Seel, ſo weiß ich
nicht, wie’s werden wird.
Mein Seel, so weiſs ich
nicht, wie’s werden wird.
Mein Seel, ſo weiß ich
nicht, wie’s werden wird.
Walter.
Der Nudelkloß,
Verzeiht, den ich dem
Huhne
ſoll geben.
ſoll.
Der Nudelkloß,
den ich dem Huhn ſoll geben.
Verzeiht, den ich dem Huhne
geben ſoll.
Verzeiht, den ich dem
Huhne geben soll.
Verzeiht, den ich dem
Huhne geben ſoll.
Schluckt mir das Aas die Pille nicht
herunter,
So
Mein Seel, ſo
Seht, Herr, ſo
Mein Seel, ſo weiß ich
nicht, wie’s mit mir werden
wird.
So weiß ich
nicht, wie’s mit mir werden wird.
Mein Seel,
ſoweiß ich nicht, wie’s werden
wird.
Seht, Herr,
ſo weiß ich nicht, wie’s werden
wird.
Mein Seel, ſo weiß ich
nicht, wie’s werden wird.
Mein Seel, so weiſs ich
nicht, wie’s werden wird.
Mein Seel, ſo weiß ich
nicht, wie’s werden wird.
Walter.
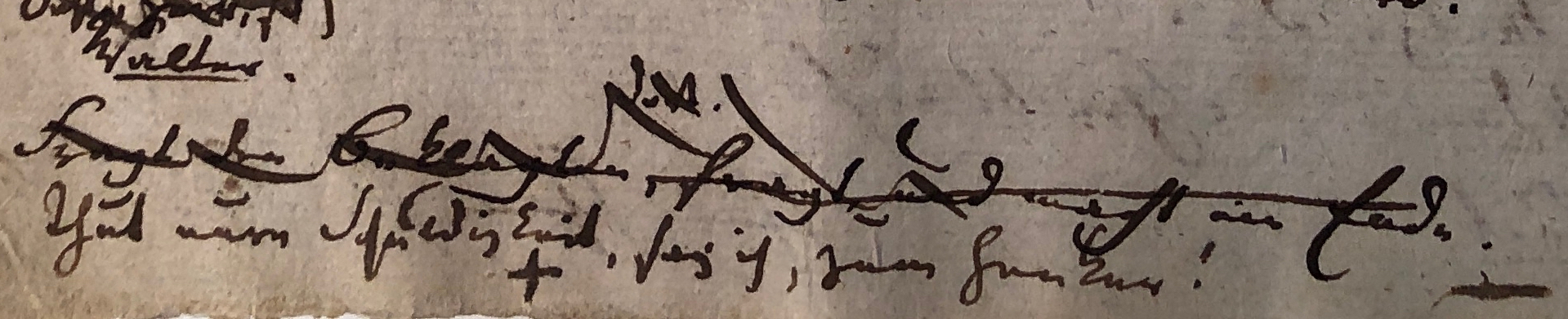 Fragt den
Beklagten,
dort.
fragt, und macht ein Ende.
Thut eure Schuldigkeit,
ſag’ ich, zum Henker!Zur
Diskussion, ob der letzte, unten auf Seite 47
eingefügte Vers 845 im Rahmen der sonstigen
Korrekturen auf dieser Seite, also schon 1806, oder
erst 1808 im Rahmen der ›Phöbus‹-Korrekturen
niedergeschrieben wurde, gibt es eine kontroverse
Diskussion (vgl. Günter Dunz-Wolff, Kleists Arbeit am
Vers (wie Anm. xxx), S. xxx). Die Summe der
Schriftmerkmale, aber auch andere Indikatoren sprechen
eher dafür, dass der Vers von Kleist schon im Jahr
1806 im Rahmen der sonstigen Korrekturen notiert
worden ist (ebd. S. xxx).
Fragt den Beklagten,
fragt, und macht ein Ende.
Fragt den Beklagten,
dort.
Thut eure
Schuldigkeit, ſag’ ich, zum Henker!
Thut eure Schuldigkeit,
sag’ ich, zum Henker!
Thut eure Schuldigkeit,
ſag ich, zum Henker!
48.
Adam.
Beklagter trete vor.
Ruprecht.
Hier, Herr Dorfrichter.
Ruprecht, Veits, des
Koſſäthen, Sohn, aus Huiſum.
Ruprecht, Veits des
Koſſaͤthen Sohn, aus Huiſum.
Adam.
Vernahm er dort, was vor
Gericht ſo eben,
Vernahm er dort, was vor Gericht
ſo eben,
Vernahm er dort, was
vor Gericht ſo eben
Vernahm er dort, was vor
Gericht ſo eben
Frau Marthe gegen ihn hat angebracht.?
Frau Marthe gegen ihn hat
angebracht.
Frau Marthe gegen ihn
hat angebracht?
Frau Marthe gegen ihn
hat angebracht?
Ruprecht.
Ja, Herr Dorfrichter, das hab’ ich.
Adam.
Getraut er ſich
Etwas dagegen aufzubringen, was?
Bekennt er, oder unterfängt er ſich,
Hier wie ein gottvergeſſner Menſch zu
läugnen?
Ruprecht.
Was ich dagegen aufzubringen habe,
Herr Richter? Ei! Mit euerer Erlaubniß,
Daß ſie kein wahres Wort geſprochen hat.
Adam.
So? Und das denkt er zu beweiſen?
Ruprecht.
O ja.
Adam.
Die würdige Frau Marthe, die.
Beruhige ſie ſich,.
eEs wird ſich finden.
Beruhige ſie ſich,
es wird ſich finden.
Beruhige ſie
ſich.
Es wird ſich finden.
Beruhige ſie ſich. Es
wird ſich finden.
Walter.
Was geht ihm die Frau
Marthe an, Herr Richter?
Was geht ihn die Frau
Marthe an, Herr Richter?
Adam.
Was mir —? Bei Gott! Soll ich als Chriſt —?
Walter
Bericht’
Er, was er für ſich anzuführen hat. —
Herr Schreiber, wißt ihr den Proceß zu
führen?
49.
Adam.
Ach, was!
Licht.
Ob ich — ei nun, wenn Ew. Gnaden
—
Adam.
Was glotzt er da? Was hat er
aufzubringen?
Steht nicht der Eſel, wie ein Ochſe, da?
Was hat er aufzubringen?
Ruprecht.
Was ich aufzubringen?
Walter.
Er ja, er ſoll den Hergang jetzt
erzählen.
Ruprecht.
Mein Seel, wenn man zu
Wort mich kom̄en ließe.
Mein Seel’, wenn man zu
Wort mich kommen ließe.
Walter.
S’ iſt in der That, Herr Richter, nicht zu
dulden.
Ruprecht.
Fragt den
Beklagten,
dort.
fragt, und macht ein Ende.
Thut eure Schuldigkeit,
ſag’ ich, zum Henker!Zur
Diskussion, ob der letzte, unten auf Seite 47
eingefügte Vers 845 im Rahmen der sonstigen
Korrekturen auf dieser Seite, also schon 1806, oder
erst 1808 im Rahmen der ›Phöbus‹-Korrekturen
niedergeschrieben wurde, gibt es eine kontroverse
Diskussion (vgl. Günter Dunz-Wolff, Kleists Arbeit am
Vers (wie Anm. xxx), S. xxx). Die Summe der
Schriftmerkmale, aber auch andere Indikatoren sprechen
eher dafür, dass der Vers von Kleist schon im Jahr
1806 im Rahmen der sonstigen Korrekturen notiert
worden ist (ebd. S. xxx).
Fragt den Beklagten,
fragt, und macht ein Ende.
Fragt den Beklagten,
dort.
Thut eure
Schuldigkeit, ſag’ ich, zum Henker!
Thut eure Schuldigkeit,
sag’ ich, zum Henker!
Thut eure Schuldigkeit,
ſag ich, zum Henker!
48.
Adam.
Beklagter trete vor.
Ruprecht.
Hier, Herr Dorfrichter.
Ruprecht, Veits, des
Koſſäthen, Sohn, aus Huiſum.
Ruprecht, Veits des
Koſſaͤthen Sohn, aus Huiſum.
Adam.
Vernahm er dort, was vor
Gericht ſo eben,
Vernahm er dort, was vor Gericht
ſo eben,
Vernahm er dort, was
vor Gericht ſo eben
Vernahm er dort, was vor
Gericht ſo eben
Frau Marthe gegen ihn hat angebracht.?
Frau Marthe gegen ihn hat
angebracht.
Frau Marthe gegen ihn
hat angebracht?
Frau Marthe gegen ihn
hat angebracht?
Ruprecht.
Ja, Herr Dorfrichter, das hab’ ich.
Adam.
Getraut er ſich
Etwas dagegen aufzubringen, was?
Bekennt er, oder unterfängt er ſich,
Hier wie ein gottvergeſſner Menſch zu
läugnen?
Ruprecht.
Was ich dagegen aufzubringen habe,
Herr Richter? Ei! Mit euerer Erlaubniß,
Daß ſie kein wahres Wort geſprochen hat.
Adam.
So? Und das denkt er zu beweiſen?
Ruprecht.
O ja.
Adam.
Die würdige Frau Marthe, die.
Beruhige ſie ſich,.
eEs wird ſich finden.
Beruhige ſie ſich,
es wird ſich finden.
Beruhige ſie
ſich.
Es wird ſich finden.
Beruhige ſie ſich. Es
wird ſich finden.
Walter.
Was geht ihm die Frau
Marthe an, Herr Richter?
Was geht ihn die Frau
Marthe an, Herr Richter?
Adam.
Was mir —? Bei Gott! Soll ich als Chriſt —?
Walter
Bericht’
Er, was er für ſich anzuführen hat. —
Herr Schreiber, wißt ihr den Proceß zu
führen?
49.
Adam.
Ach, was!
Licht.
Ob ich — ei nun, wenn Ew. Gnaden
—
Adam.
Was glotzt er da? Was hat er
aufzubringen?
Steht nicht der Eſel, wie ein Ochſe, da?
Was hat er aufzubringen?
Ruprecht.
Was ich aufzubringen?
Walter.
Er ja, er ſoll den Hergang jetzt
erzählen.
Ruprecht.
Mein Seel, wenn man zu
Wort mich kom̄en ließe.
Mein Seel’, wenn man zu
Wort mich kommen ließe.
Walter.
S’ iſt in der That, Herr Richter, nicht zu
dulden.
Ruprecht.
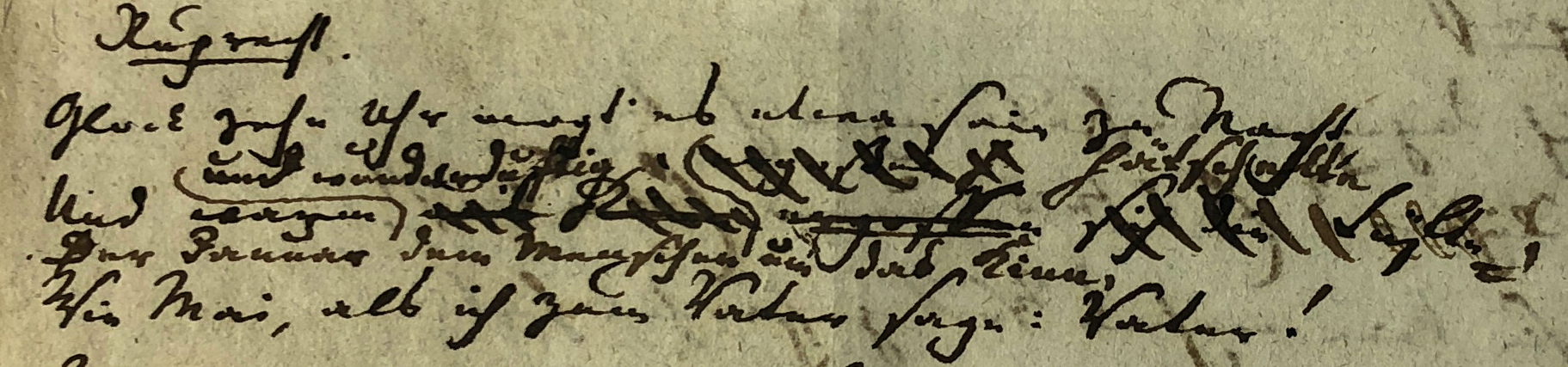 Glock zehn Uhr mogt’ es
etwa ſein zu Nacht
Glock zehn Uhr mogt’ es
etwa ſein zu Nacht, —
Und warm und
wunderduftig
um’s Kinn
ergoßen h
ergoſſen
ſich die Lüfte.
hätſchelte,Die Versgenese erschließt
sich durch die Kombination von Schriftbild,
unterschiedlich ausgeführten Streichungen
(horizontale Doppelstreichung, sonst Schraffur)
und metrischen Anforderungen. Zunächst wird
offensichtlich ›ergoſſen‹ gestrichen und über der
Zeile durch ›ergoßen h‹ ersetzt (Variante b). Es
bleibt unklar, wie Kleist fortfahren wollte, da er
die Korrektur abbricht. Stattdessen wird die
ursprüngliche Vers-Variante 872ɑ zugunsten von
zwei Versen aufgelöst (872b, 872+1b). Für E hat
auch diese Korrektur keinen Bestand, aus zwei
Versen wird wieder einer und dieser neu
formuliert: ›Und warm, juſt dieſe Nacht des
Januars‹.
Und warm um’s Kinn
ergoſſen ſich die Lüfte.
Und warm um’s Kinn
ergoßen h
ſich die Lüfte.
Und warm und
wunderduftig
hätſchelte,
Und warm, juſt dieſe
Nacht des Januars
Der Januar dem Menſchen um das
Kinn,
Der Januar dem
Menſchen um das Kinn,
[ ]
Wie Mai, als ich zum Vater ſage: Vater!
Ich will ein Biſſel noch zur Eve gehn.
Denn heuern wollt’ ich
ſie, das müßt ihr wiſſen,
Denn heuren wollt’ ich
ſie, das muͤßt ihr wiſſen,
Ein rüſtig Mädel iſt’s, ich hab’s beim
Erndten
Geſehn, wo Alles von der Fauſt ihr gieng.,
Geſehn, wo Alles von der
Fauſt ihr gieng.
Geſehn, wo Alles
von der Fauſt ihr gieng,
Geſehn, wo Alles von der
Fauſt ihr ging,
Und ihr das Heu man flog, als
wie gemauſet.
[ ]
Und ihr das
Heu man flog, als wie gemauſet.
Und ihr das Heu man
flog, als wie gemauſ’t.
Da ſagt’ ich,: willſt du? Und ſie ſagte: ach!
Da ſagt’ ich,
willſt du? Und ſie ſagte: ach!
Da ſagt’
ich: willſt du? Und ſie ſagte: ach!
Da ſagt’ ich: willſt du?
Und ſie ſagte: ach!
Was du da gakelſt. — Und nachher ſagt ſie,
ja.
Was du da gakelſt.
Und nachher ſagt ſie, ja.
Was du da gakelſt.
— Und nachher ſagt ſie, ja.
Was du da gakelſt. Und
nachher ſagt’ ſie, ja.
Adam.
Bleib er bei ſeiner Sache. Gakeln! Was!
Ich ſagte, willſt du? Und ſie ſagte, ja.
Ruprecht.
Ja, meiner Treu, Herr Richter.
Walter.
Weiter!
Weiter! Weiter!
50.
Ruprecht
Nun
—Da
Kleist das Mittelglied der Analepse ›Weiter!‹ im
Erstdruck ändert in ›Weiter! Weiter!‹, hätte er dort
Ruperts ›Nun —‹ eigentlich streichen müssen, um im
fünffüßigen Versmaß zu bleiben.
Da ſagt’ ich: Vater, hört er? Laß er
mich.
Wir ſchwatzen noch am Fenſter was
zuſam̄en.
Na, ſagt er, lauf; bleibſt du auch draußen,
ſagt er?
Ja, meiner Seel’, ſag’ ich, das iſt
geſchworen.
Na, ſagt er,: lauf,Komma nicht gestrichen. In E
nicht durch Doppelpunkt ersetzt. um eilfe biſt
du hier.
Na, ſagt er, lauf, um eilfe biſt
du hier.
Na, ſagt er, lauf: um
eilfe biſt du hier.
Na, ſagt’ er, lauf, um
eilfe biſt du hier.
Adam.
Na, ſo ſag du, und gakle, und kein Ende.
Na, hat er bald ſich ausgeſagt?
Ruprecht.
Na, ſag’ ich,
Das iſt ein Wort, und ſetz’ die Mütze
auf,
Und geh’, undDie
handschriftliche Abkürzung für ›und‹ (u.) wird
korrigiert in ein ausgeschriebenes ›und‹.
über’n Steig will ich, und muß
Und geh; und uͤber’n
Steig will ich, und muß
Durch’s Dorf zurückgehn, weil der Bach
geſchwollen.
Ei, alle Wetter, denk’ ich, Ruprecht,
Schlag!
Nun iſt die Garthenthür bei Marthens zu:
Denn bis um Zehne
nur, läßt’s
ſie
Mädel ſie nur offen,
Denn bis um Zehne
nur, läßt ſie ſie offen,
Denn bis um Zehn
läßt’s
Mädel ſie nur offen,
Denn bis um zehn laͤßt’s
Maͤdel ſie nur offen,
Wenn ich um
Zehn
BKA liest hier kleines ›z‹ im
Gegensatz zu vorigem Vers. Hier eher noch größer.
Allerdings ist die Majuskel Z von der Minuskel bei
Kleist schwer zu unterscheiden. In E wird in
beiden Versen die Minuskel z gesetzt.
nicht da bin, kom̄ ich
nicht.
Adam.
Die liederliche Wirthſchafft, die.
RWalter.
Drauf —
weiter?
Drauf weiter?
Ruprecht.
DraufAb hier Federwechsel — wie ich über’n
Lindengang mich näh’re,
Bei Marthens, wo die
Reihen dichtgewölbt,
Bei Marthens, wo die
Reihen dicht gewoͤlbt,
Und dunkel, wie der Dom zu Utrecht,
ſind,
Hör’ ich die Garthenthüre fernher
knarren.
Sieh da! Da iſt die Eve noch! ſag’ ich,
Und ſchicke freudig euch, von wo die
Ohren
Mir Kundſchafft brachten, meine Augen nach
—
— Und ſchelte ſie, da ſie mir
wiederkom̄en,
BKA liest ›wieder kom̄en,‹
Hamacher liest ›wieder
kommen,‹
Für blind, und ſchicke auf der Stelle
ſie
51.
Zum zweitenmal, ſich beſſer umzuſehen,
Und ſchimpfe ſie nichtswürdige
Verläumder,
Aufhetzer, niederträcht’ge Ohrenbläſer,
Und ſchicke ſie zum drittenmal, und
denke,
Sie werden, weil ſie ihre Pflicht
gethan,
Unwillig los ſich aus dem Kopf mir
reißen,
Und ſich in einen andern Dienſt begeben:
Die Eve iſt’s, am Latz
erkenn’ ich ſie,
Die Eve iſt’s, am Latz
erkenn ich ſie,
Und Einer iſt’s noch obenein.
Adam.
So? Einer noch? Und wer, er
Klugſchwätzer?
Ruprecht.
Wer? Ja, mein Seel, da fragt ihr mich —
Adam.
Nun alſo!
Und nicht gefangen, denk’
ich, nicht gehangen.
Und nicht gefangen, denk
ich, nicht gehangen.
Walter.
Fort! Weiter in der Rede! Laßt ihn doch!
Was unterbrecht ihr ihn, Herr
Dorfrichter?
Ruprecht.
Ich kann das Abendmahl darauf nicht
nehmen,
Stockfinſter war’s, und
alle Katzen grau:
Stockfinſter war’s, und
alle Katzen grau.
Doch müßt ihr wiſſen, daß der
Flickſchuſter,
Der Lebrecht, den man kürzlich
losgeſprochen,
Dem Mädel längſt mir auf die Fährte
gieng.
Ich ſagte vor’gen Herbſt ſchon, Eve,
höre,
Der Schuft ſchleicht mir
um’s Haus, das mag ich nicht,
Der Schuft ſchleicht mir
um’s Haus, das mag ich nicht;
Sag’ ihm, daß du kein Braten biſt für
ihn,
Mein Seel’, ſonſt werf’
ich ihn vom Hof’ herunter.
Mein Seel’, ſonſt werf
ich ihn vom Hof herunter.
Die ſpricht, ich glaub’,
du ſchierſt mich, ſagt ihm was,
Die ſpricht: ich glaub’,
du ſchierſt mich, ſagt ihm was,
Das iſt nicht hin, nicht her, nicht Fiſch,
nicht Fleiſch:
Drauf geh ich hin, und werf’ den Schlingel
herunter.
52.
Adam.
So? Lebrecht heißt der Kerl?
Ruprecht.
Ja, Lebrecht.
Adam.
Gut.
Das iſt ein Nam’. Es wird ſich Alles
finden.
— Habt ihr’s bemerkt im Protokoll, Herr
Schreiber?
Licht.
O ja, und alles Andere, Herr Richter.
Adam.
Sprich weiter, Ruprecht, jetzt, mein Sohn.
—
Sprich weiter, Ruprecht, jetzt,
mein Sohn.
Sprich weiter,
Ruprecht, jetzt, mein Sohn—
Sprich weiter,
Ruprecht, jetzt, mein Sohn.
Ruprecht.
Nun ſchießt,
Da ich Glock eilf das Pärchen hier
begegne,
— Glock zehn Uhr zog ich im̄er ab — das Blatt mir.
Ich denke, halt, jetzt iſt’s noch Zeit, o
Ruprecht,
Noch wachſen dir die
Hirſchgeweihe nicht:
Noch wachſen dir die
Hirſchgeweihe nicht: —
Glock zehn Uhr mogt’ es
etwa ſein zu Nacht
Glock zehn Uhr mogt’ es
etwa ſein zu Nacht, —
Und warm und
wunderduftig
um’s Kinn
ergoßen h
ergoſſen
ſich die Lüfte.
hätſchelte,Die Versgenese erschließt
sich durch die Kombination von Schriftbild,
unterschiedlich ausgeführten Streichungen
(horizontale Doppelstreichung, sonst Schraffur)
und metrischen Anforderungen. Zunächst wird
offensichtlich ›ergoſſen‹ gestrichen und über der
Zeile durch ›ergoßen h‹ ersetzt (Variante b). Es
bleibt unklar, wie Kleist fortfahren wollte, da er
die Korrektur abbricht. Stattdessen wird die
ursprüngliche Vers-Variante 872ɑ zugunsten von
zwei Versen aufgelöst (872b, 872+1b). Für E hat
auch diese Korrektur keinen Bestand, aus zwei
Versen wird wieder einer und dieser neu
formuliert: ›Und warm, juſt dieſe Nacht des
Januars‹.
Und warm um’s Kinn
ergoſſen ſich die Lüfte.
Und warm um’s Kinn
ergoßen h
ſich die Lüfte.
Und warm und
wunderduftig
hätſchelte,
Und warm, juſt dieſe
Nacht des Januars
Der Januar dem Menſchen um das
Kinn,
Der Januar dem
Menſchen um das Kinn,
[ ]
Wie Mai, als ich zum Vater ſage: Vater!
Ich will ein Biſſel noch zur Eve gehn.
Denn heuern wollt’ ich
ſie, das müßt ihr wiſſen,
Denn heuren wollt’ ich
ſie, das muͤßt ihr wiſſen,
Ein rüſtig Mädel iſt’s, ich hab’s beim
Erndten
Geſehn, wo Alles von der Fauſt ihr gieng.,
Geſehn, wo Alles von der
Fauſt ihr gieng.
Geſehn, wo Alles
von der Fauſt ihr gieng,
Geſehn, wo Alles von der
Fauſt ihr ging,
Und ihr das Heu man flog, als
wie gemauſet.
[ ]
Und ihr das
Heu man flog, als wie gemauſet.
Und ihr das Heu man
flog, als wie gemauſ’t.
Da ſagt’ ich,: willſt du? Und ſie ſagte: ach!
Da ſagt’ ich,
willſt du? Und ſie ſagte: ach!
Da ſagt’
ich: willſt du? Und ſie ſagte: ach!
Da ſagt’ ich: willſt du?
Und ſie ſagte: ach!
Was du da gakelſt. — Und nachher ſagt ſie,
ja.
Was du da gakelſt.
Und nachher ſagt ſie, ja.
Was du da gakelſt.
— Und nachher ſagt ſie, ja.
Was du da gakelſt. Und
nachher ſagt’ ſie, ja.
Adam.
Bleib er bei ſeiner Sache. Gakeln! Was!
Ich ſagte, willſt du? Und ſie ſagte, ja.
Ruprecht.
Ja, meiner Treu, Herr Richter.
Walter.
Weiter!
Weiter! Weiter!
50.
Ruprecht
Nun
—Da
Kleist das Mittelglied der Analepse ›Weiter!‹ im
Erstdruck ändert in ›Weiter! Weiter!‹, hätte er dort
Ruperts ›Nun —‹ eigentlich streichen müssen, um im
fünffüßigen Versmaß zu bleiben.
Da ſagt’ ich: Vater, hört er? Laß er
mich.
Wir ſchwatzen noch am Fenſter was
zuſam̄en.
Na, ſagt er, lauf; bleibſt du auch draußen,
ſagt er?
Ja, meiner Seel’, ſag’ ich, das iſt
geſchworen.
Na, ſagt er,: lauf,Komma nicht gestrichen. In E
nicht durch Doppelpunkt ersetzt. um eilfe biſt
du hier.
Na, ſagt er, lauf, um eilfe biſt
du hier.
Na, ſagt er, lauf: um
eilfe biſt du hier.
Na, ſagt’ er, lauf, um
eilfe biſt du hier.
Adam.
Na, ſo ſag du, und gakle, und kein Ende.
Na, hat er bald ſich ausgeſagt?
Ruprecht.
Na, ſag’ ich,
Das iſt ein Wort, und ſetz’ die Mütze
auf,
Und geh’, undDie
handschriftliche Abkürzung für ›und‹ (u.) wird
korrigiert in ein ausgeschriebenes ›und‹.
über’n Steig will ich, und muß
Und geh; und uͤber’n
Steig will ich, und muß
Durch’s Dorf zurückgehn, weil der Bach
geſchwollen.
Ei, alle Wetter, denk’ ich, Ruprecht,
Schlag!
Nun iſt die Garthenthür bei Marthens zu:
Denn bis um Zehne
nur, läßt’s
ſie
Mädel ſie nur offen,
Denn bis um Zehne
nur, läßt ſie ſie offen,
Denn bis um Zehn
läßt’s
Mädel ſie nur offen,
Denn bis um zehn laͤßt’s
Maͤdel ſie nur offen,
Wenn ich um
Zehn
BKA liest hier kleines ›z‹ im
Gegensatz zu vorigem Vers. Hier eher noch größer.
Allerdings ist die Majuskel Z von der Minuskel bei
Kleist schwer zu unterscheiden. In E wird in
beiden Versen die Minuskel z gesetzt.
nicht da bin, kom̄ ich
nicht.
Adam.
Die liederliche Wirthſchafft, die.
RWalter.
Drauf —
weiter?
Drauf weiter?
Ruprecht.
DraufAb hier Federwechsel — wie ich über’n
Lindengang mich näh’re,
Bei Marthens, wo die
Reihen dichtgewölbt,
Bei Marthens, wo die
Reihen dicht gewoͤlbt,
Und dunkel, wie der Dom zu Utrecht,
ſind,
Hör’ ich die Garthenthüre fernher
knarren.
Sieh da! Da iſt die Eve noch! ſag’ ich,
Und ſchicke freudig euch, von wo die
Ohren
Mir Kundſchafft brachten, meine Augen nach
—
— Und ſchelte ſie, da ſie mir
wiederkom̄en,
BKA liest ›wieder kom̄en,‹
Hamacher liest ›wieder
kommen,‹
Für blind, und ſchicke auf der Stelle
ſie
51.
Zum zweitenmal, ſich beſſer umzuſehen,
Und ſchimpfe ſie nichtswürdige
Verläumder,
Aufhetzer, niederträcht’ge Ohrenbläſer,
Und ſchicke ſie zum drittenmal, und
denke,
Sie werden, weil ſie ihre Pflicht
gethan,
Unwillig los ſich aus dem Kopf mir
reißen,
Und ſich in einen andern Dienſt begeben:
Die Eve iſt’s, am Latz
erkenn’ ich ſie,
Die Eve iſt’s, am Latz
erkenn ich ſie,
Und Einer iſt’s noch obenein.
Adam.
So? Einer noch? Und wer, er
Klugſchwätzer?
Ruprecht.
Wer? Ja, mein Seel, da fragt ihr mich —
Adam.
Nun alſo!
Und nicht gefangen, denk’
ich, nicht gehangen.
Und nicht gefangen, denk
ich, nicht gehangen.
Walter.
Fort! Weiter in der Rede! Laßt ihn doch!
Was unterbrecht ihr ihn, Herr
Dorfrichter?
Ruprecht.
Ich kann das Abendmahl darauf nicht
nehmen,
Stockfinſter war’s, und
alle Katzen grau:
Stockfinſter war’s, und
alle Katzen grau.
Doch müßt ihr wiſſen, daß der
Flickſchuſter,
Der Lebrecht, den man kürzlich
losgeſprochen,
Dem Mädel längſt mir auf die Fährte
gieng.
Ich ſagte vor’gen Herbſt ſchon, Eve,
höre,
Der Schuft ſchleicht mir
um’s Haus, das mag ich nicht,
Der Schuft ſchleicht mir
um’s Haus, das mag ich nicht;
Sag’ ihm, daß du kein Braten biſt für
ihn,
Mein Seel’, ſonſt werf’
ich ihn vom Hof’ herunter.
Mein Seel’, ſonſt werf
ich ihn vom Hof herunter.
Die ſpricht, ich glaub’,
du ſchierſt mich, ſagt ihm was,
Die ſpricht: ich glaub’,
du ſchierſt mich, ſagt ihm was,
Das iſt nicht hin, nicht her, nicht Fiſch,
nicht Fleiſch:
Drauf geh ich hin, und werf’ den Schlingel
herunter.
52.
Adam.
So? Lebrecht heißt der Kerl?
Ruprecht.
Ja, Lebrecht.
Adam.
Gut.
Das iſt ein Nam’. Es wird ſich Alles
finden.
— Habt ihr’s bemerkt im Protokoll, Herr
Schreiber?
Licht.
O ja, und alles Andere, Herr Richter.
Adam.
Sprich weiter, Ruprecht, jetzt, mein Sohn.
—
Sprich weiter, Ruprecht, jetzt,
mein Sohn.
Sprich weiter,
Ruprecht, jetzt, mein Sohn—
Sprich weiter,
Ruprecht, jetzt, mein Sohn.
Ruprecht.
Nun ſchießt,
Da ich Glock eilf das Pärchen hier
begegne,
— Glock zehn Uhr zog ich im̄er ab — das Blatt mir.
Ich denke, halt, jetzt iſt’s noch Zeit, o
Ruprecht,
Noch wachſen dir die
Hirſchgeweihe nicht:
Noch wachſen dir die
Hirſchgeweihe nicht: —
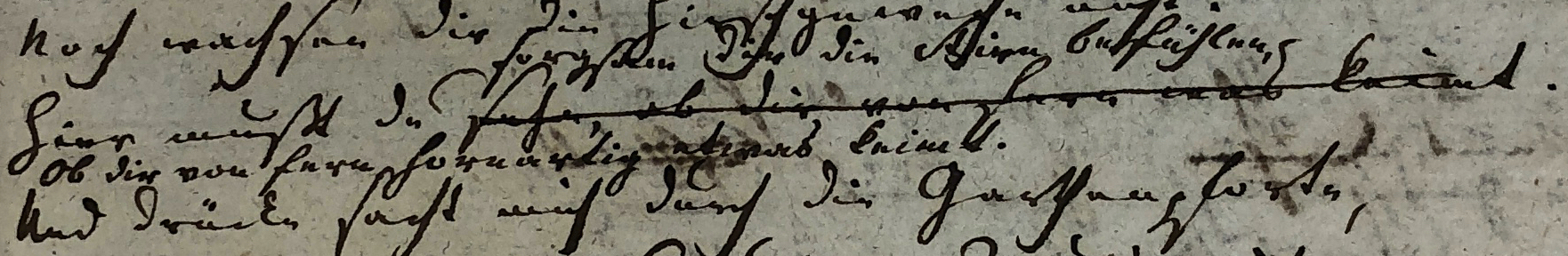 Hier mußt du ſehn, ob
dir von fern was keimt.
ſorgſam dir die Stirn
befühlen,
Hier mußt du ſehn, ob
dir von fern was keimt.
Hier mußt du
ſorgſam dir die Stirn befühlen,
Hier mußt du ſorgſam dir
die Stirn befuͤhlen,
Ob dir von fern hornartig etwas
keimt.
[ ]
Ob dir von
fern hornartig etwas keimt.
Ob dir von fern
hornartig etwas keimt.
Und drücke ſacht mich durch die
Garthenpforte,
Und berg’ in einen Strauch von Taxus
mich,:
Und berg’ in einen Strauch von
Taxus mich,
Und berg’ in einen
Strauch von Taxus mich:
Und berg’ in einen
Strauch von Taxus mich:
Und hör’ euch ein Gefipspre hier, ein Scherzen,
Und hoͤr euch ein
Gefispre hier, ein Scherzen,
Ein Zerren hin, Herr Richter, Zerren
her,
Mein Seel, ich denk’, ich ſoll vor Luſt —
Eve.
Du Bösſ’wicht!
Kleist
ändert das runde s in ›Bös’wicht‹ in ein langes, als
elidierte Form von ›Böſewicht‹ eine zwingende
Korrektur.
Was das o ſchändlich iſt von
dir!
Was das, o ſchaͤndlich
iſt von dir!
Frau Marthe
Hallunke!
Dir weiſ’ ich noch einmal, wenn wir allein
ſind,
Die Zähne! Wart! Du weißt noch nicht, wo
mir
Die Haare wachſen! Du ſollſt’s erfahren!
Ruprecht.
Ein Viertelſtündchen dauert’s ſo, ich
denke,
53.
Was wird’s doch werden, iſt doch heut nicht
Hochzeit?
Und eh ich den Gedanken
ausgedacht,
Und eh’ ich den Gedanken
ausgedacht,
Huſch! ſind ſie beid’ in’s Haus ſchon, vor
dem Paſtor.
Eve.
Geht, Mutter, mag es werden, wie es will
—
Adam.
Schweig du mir dort, rath’ ich, das
Donnerwetter
Schlägt über dich ein,
unberufne Schwätz’rinn!
Schlaͤgt uͤber dich ein,
unberufne Schwaͤtzerin!
Wart, bis ich auf zur Red’ dich rufen
werde.
Walter.
Sehr ſonderbar, bei Gott!
Ruprecht.
Jetzt hebt, Herr Richter Adam,
Hier mußt du ſehn, ob
dir von fern was keimt.
ſorgſam dir die Stirn
befühlen,
Hier mußt du ſehn, ob
dir von fern was keimt.
Hier mußt du
ſorgſam dir die Stirn befühlen,
Hier mußt du ſorgſam dir
die Stirn befuͤhlen,
Ob dir von fern hornartig etwas
keimt.
[ ]
Ob dir von
fern hornartig etwas keimt.
Ob dir von fern
hornartig etwas keimt.
Und drücke ſacht mich durch die
Garthenpforte,
Und berg’ in einen Strauch von Taxus
mich,:
Und berg’ in einen Strauch von
Taxus mich,
Und berg’ in einen
Strauch von Taxus mich:
Und berg’ in einen
Strauch von Taxus mich:
Und hör’ euch ein Gefipspre hier, ein Scherzen,
Und hoͤr euch ein
Gefispre hier, ein Scherzen,
Ein Zerren hin, Herr Richter, Zerren
her,
Mein Seel, ich denk’, ich ſoll vor Luſt —
Eve.
Du Bösſ’wicht!
Kleist
ändert das runde s in ›Bös’wicht‹ in ein langes, als
elidierte Form von ›Böſewicht‹ eine zwingende
Korrektur.
Was das o ſchändlich iſt von
dir!
Was das, o ſchaͤndlich
iſt von dir!
Frau Marthe
Hallunke!
Dir weiſ’ ich noch einmal, wenn wir allein
ſind,
Die Zähne! Wart! Du weißt noch nicht, wo
mir
Die Haare wachſen! Du ſollſt’s erfahren!
Ruprecht.
Ein Viertelſtündchen dauert’s ſo, ich
denke,
53.
Was wird’s doch werden, iſt doch heut nicht
Hochzeit?
Und eh ich den Gedanken
ausgedacht,
Und eh’ ich den Gedanken
ausgedacht,
Huſch! ſind ſie beid’ in’s Haus ſchon, vor
dem Paſtor.
Eve.
Geht, Mutter, mag es werden, wie es will
—
Adam.
Schweig du mir dort, rath’ ich, das
Donnerwetter
Schlägt über dich ein,
unberufne Schwätz’rinn!
Schlaͤgt uͤber dich ein,
unberufne Schwaͤtzerin!
Wart, bis ich auf zur Red’ dich rufen
werde.
Walter.
Sehr ſonderbar, bei Gott!
Ruprecht.
Jetzt hebt, Herr Richter Adam,
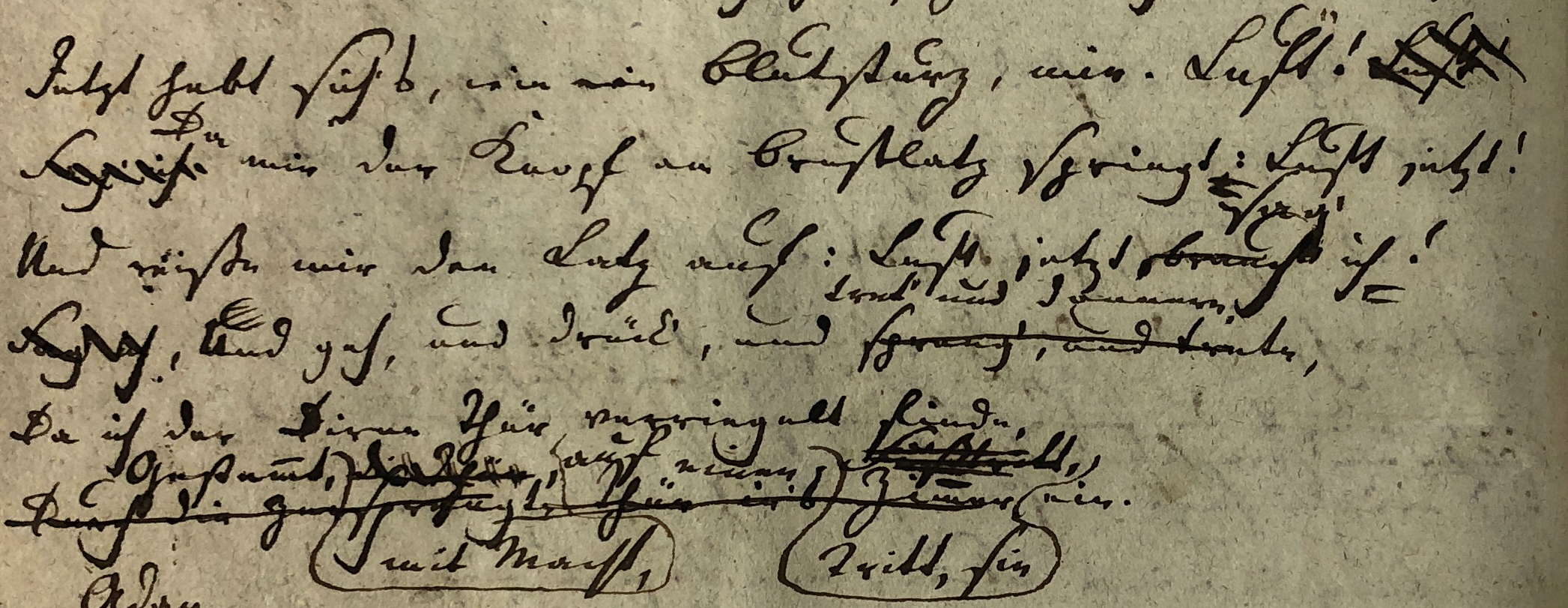 Jetzt hebt ſich’s, wie ein Blutſturz, mir.
Luft! Luft!
Jetzt hebt ſich’s, wie ein
Blutſturz, mir. Luft! Luft!
Jetzt hebt ſich’s,
wie ein Blutſturz, mir. Luft!
Jetzt hebt ſich’s, wie
ein Blutſturz, mir. Luft!
Sag’ ich
Da mir der
Knopf am Bruſtlatz ſpringt,: Luft jetzt!
Sag’ ich.
Da mir der Knopf am Bruſtlatz
ſpringt, Luft jetzt!
Da mir der Knopf am
Bruſtlatz ſpringt: Luft jetzt!
Da mir der Knopf am
Bruſtlatz ſpringt: Luft jetzt!
Und reiße mir den Latz auf: Luft jetzt, brauch’
ſag’
ich,!
Und reiße mir den Latz auf:
Luft jetzt, brauch’ ich,
Und reiße mir den
Latz auf: Luft jetzt, ſag’
ich!
Und reiße mir den Latz
auf: Luft jetzt ſag’ ich!
Sag’ ich,
uUnd geh, und drück’,
und ſpreng’, und trete,
tret’ und donnere,
Sag’ ich,
und geh, und drück’, und ſpreng’, und
trete,
Und geh,
und drück’, und tret’ und donnere,
Und geh, und druͤck, und
tret’ und donnere,
Da ich der Dirne Thür
verriegelt finde,
Da ich der Dirne Thuͤr,
verriegelt finde,
Durch die zerſprengte
Thür in’s Zim̄er
Geſtem̄t, die Thür
mit Macht,
auf einen
Fußtritt,
Tritt, ſie ein.
Durch die zerſprengte
Thür in’s Zim̄er ein.
Geſtem̄t, die Thür,
auf einen Fußtritt, ein.
Geſtem̄t, mit
Macht, auf einen Tritt, ſie
ein.
Geſtemmt, mit Macht, auf
einen Tritt, ſie ein.
Adam.
Das nenn’ ich ¿ flink.
Blitzjunge,
du!
Das nenn’ ich flink.
Blitzjunge,
du!
Blitzjunge, du!
Ruprecht.
Juſt, da ſie auf
jetzt raſſelt,
Juſt da ſie auf jetzt
raſſelt,
Stürzt dort der Krug vom
Simſ’ ins Zim̄er hin,
Stuͤrzt dort der Krug
vom Sims ins Zimmer hin,
Und husch! springt Einer
aus dem Fenster euch,
Und huſch! ſpringt Einer
aus dem Fenſter euch:
Ich ſeh die Schöße noch vom Rocke wehn.
Adam.
War das der Leberecht?
Ruprecht.
Wer ſonſt, Herr Richter?
Das Mädchen ſteht, die werf’ ich über’n
Haufen,
Zum Fenſter eil’ ich hin, und find’ den
Kerl
Noch in den Pfälen hangen, am Spalier,
54.
Jetzt hebt ſich’s, wie ein Blutſturz, mir.
Luft! Luft!
Jetzt hebt ſich’s, wie ein
Blutſturz, mir. Luft! Luft!
Jetzt hebt ſich’s,
wie ein Blutſturz, mir. Luft!
Jetzt hebt ſich’s, wie
ein Blutſturz, mir. Luft!
Sag’ ich
Da mir der
Knopf am Bruſtlatz ſpringt,: Luft jetzt!
Sag’ ich.
Da mir der Knopf am Bruſtlatz
ſpringt, Luft jetzt!
Da mir der Knopf am
Bruſtlatz ſpringt: Luft jetzt!
Da mir der Knopf am
Bruſtlatz ſpringt: Luft jetzt!
Und reiße mir den Latz auf: Luft jetzt, brauch’
ſag’
ich,!
Und reiße mir den Latz auf:
Luft jetzt, brauch’ ich,
Und reiße mir den
Latz auf: Luft jetzt, ſag’
ich!
Und reiße mir den Latz
auf: Luft jetzt ſag’ ich!
Sag’ ich,
uUnd geh, und drück’,
und ſpreng’, und trete,
tret’ und donnere,
Sag’ ich,
und geh, und drück’, und ſpreng’, und
trete,
Und geh,
und drück’, und tret’ und donnere,
Und geh, und druͤck, und
tret’ und donnere,
Da ich der Dirne Thür
verriegelt finde,
Da ich der Dirne Thuͤr,
verriegelt finde,
Durch die zerſprengte
Thür in’s Zim̄er
Geſtem̄t, die Thür
mit Macht,
auf einen
Fußtritt,
Tritt, ſie ein.
Durch die zerſprengte
Thür in’s Zim̄er ein.
Geſtem̄t, die Thür,
auf einen Fußtritt, ein.
Geſtem̄t, mit
Macht, auf einen Tritt, ſie
ein.
Geſtemmt, mit Macht, auf
einen Tritt, ſie ein.
Adam.
Das nenn’ ich ¿ flink.
Blitzjunge,
du!
Das nenn’ ich flink.
Blitzjunge,
du!
Blitzjunge, du!
Ruprecht.
Juſt, da ſie auf
jetzt raſſelt,
Juſt da ſie auf jetzt
raſſelt,
Stürzt dort der Krug vom
Simſ’ ins Zim̄er hin,
Stuͤrzt dort der Krug
vom Sims ins Zimmer hin,
Und husch! springt Einer
aus dem Fenster euch,
Und huſch! ſpringt Einer
aus dem Fenſter euch:
Ich ſeh die Schöße noch vom Rocke wehn.
Adam.
War das der Leberecht?
Ruprecht.
Wer ſonſt, Herr Richter?
Das Mädchen ſteht, die werf’ ich über’n
Haufen,
Zum Fenſter eil’ ich hin, und find’ den
Kerl
Noch in den Pfälen hangen, am Spalier,
54.
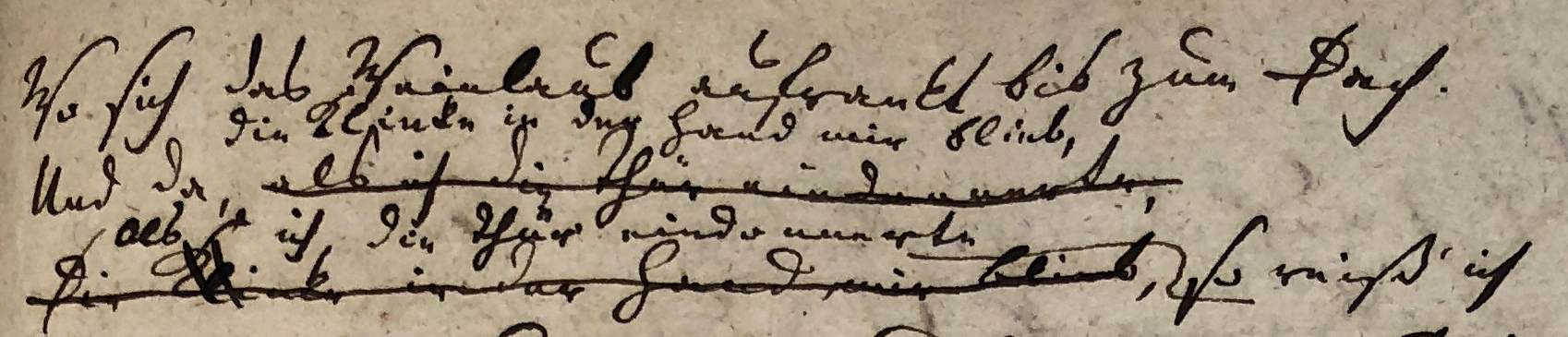 Wo ſich das Weinlaub aufrankt bis zum
Dach.
Und da, als ich die Thür
eindonnerte,
die Klinke in der Hand mir
blieb,
Und da, als ich die
Thür eindonnerte,
Und da,
die Klinke in der Hand mir blieb,
Und da die Klinke in der
Hand mir blieb,
Die Klinke in der Hand
mir blieb
Als ich die Thür
eindonnerte, ſo reiß’ ich
Die Klinke in der Hand
mir blieb, ſo reiß’ ich
Als ich die
Thür eindonnerte, ſo reiß’ ich
Als ich die Thuͤr
eindonnerte, ſo reiß’ ich
Jetzt mit dem Stahl Eins pfundſchwer über’n
Detz ihm,:
Jetzt mit dem Stahl Eins
pfundſchwer über’n Detz ihm,
Jetzt mit dem Stahl
Eins pfundſchwer über’n Detz ihm:
Jetzt mit dem Stahl Eins
pfundſchwer uͤber’n Detz ihm:
Den juſt Herr Richter
konnt’ ich noch erreichen.
Den juſt, Herr Richter,
konnt’ ich noch erreichen.
Adam.
War’s eine Klinke?
Wars eine Klinke?
Wo ſich das Weinlaub aufrankt bis zum
Dach.
Und da, als ich die Thür
eindonnerte,
die Klinke in der Hand mir
blieb,
Und da, als ich die
Thür eindonnerte,
Und da,
die Klinke in der Hand mir blieb,
Und da die Klinke in der
Hand mir blieb,
Die Klinke in der Hand
mir blieb
Als ich die Thür
eindonnerte, ſo reiß’ ich
Die Klinke in der Hand
mir blieb, ſo reiß’ ich
Als ich die
Thür eindonnerte, ſo reiß’ ich
Als ich die Thuͤr
eindonnerte, ſo reiß’ ich
Jetzt mit dem Stahl Eins pfundſchwer über’n
Detz ihm,:
Jetzt mit dem Stahl Eins
pfundſchwer über’n Detz ihm,
Jetzt mit dem Stahl
Eins pfundſchwer über’n Detz ihm:
Jetzt mit dem Stahl Eins
pfundſchwer uͤber’n Detz ihm:
Den juſt Herr Richter
konnt’ ich noch erreichen.
Den juſt, Herr Richter,
konnt’ ich noch erreichen.
Adam.
War’s eine Klinke?
Wars eine Klinke?
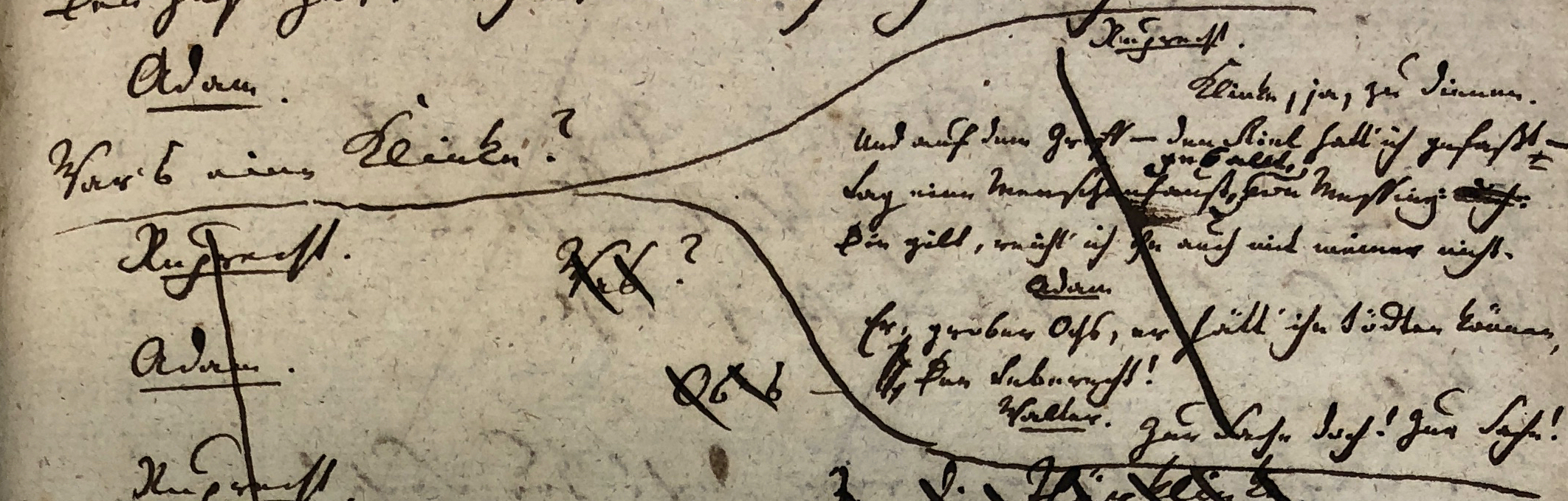 Ruprecht.Kleist hat zunächst die folgenden
fünfzehn Verse bis Vers 997 gestrichen und
durch die Verse (982+1 bis 982+6) ersetzt.
Später wird die gesamte Streichung durch eine
gestrichelte Linie am rechten Rand wieder
aufgehoben und stattdessen werden die neu
eingefügten Verse wieder
gestrichen.
Klinke, ja, zu dienen.
Und auf
dem Griff — den Stiel hatt’ ich
gefaßt,—
Lag eine
Menſchenfauſt, geballt, von
Meſſing:
auch:
Die
gilt, reicht’ ich ihn auch mit meiner
nicht.
Adam
Er, grober
Ochs, er hätt’ ihn tödten können,
Den
Leberecht!
Walter.
Zur
Sache doch! Zur Sache!
Ruprecht.
Was?
Adam.
Ob’s —?
Ob’s —?
Ob’s —
Ob’s —
Ruprecht.
Ja, die Thürklinke.
Adam.
Darum.
Licht.
Ihr glaubtet wohl, es war ein
Degen?
Adam.
Ein Degen? Ich — wie ſo?
Ruprecht.
Ein Degen!
Licht.
Je nun!
Man kann ſich wohl verhören. Eine Klinke
Hat ſehr viel Ähnlichkeit mit einem
Degen.
Adam.
Ich glaub’ —!
Licht.
Bei meiner Treu! Der Stiel, Herr
Richter?
Rupre
Adam.
Der Stiel!
Ruprecht.
Der Stiel! Der
war’s nun aber nicht.
Der Stiel! Der wars nun
aber nicht.
Das
Der Klinke umgekehrtes Ende war’s.
Adam.
Das umgekehrte Ende war’s der Klinke!
Licht.
So! So!
55.
Ruprecht.
Doch auf dem Griffe lag ein
Klumpen
Blei, wie ein Degengriff, das muß ich
ſagen.
Adam.
Ja, wie ein Griff.
Licht.
Gut. Wie ein Degengriff.
Doch irgend eine tückſche
Waffe mußt es
Doch irgend eine
tuͤckſche Waffe mußt’ es
Geweſen ſein. Das wußt’ ich wohl.
Walter.
Zur Sache ſtets, ihr
Herren, doch! Zur Sache!
Zur Sache ſtets, ihr
Herrn, doch! Zur Sache!
Adam.
Nichts als Allotrien, Herr Schreiber! — Er,
weiter!
Ruprecht.Ab hier wieder Federwechsel.
Die wieder rückgängig gemachte Überarbeitung der Verse
982ff ist eine Sofortkorrektur Kleists gewesen, zu der
er sich nach Abschrift der (uns unbekannten)
Vorlage(n) bis Vers 997 entschlossen hatte. Nach
Streichung der Überarbeitung (982+1 bis 982+6) und
Wiederherstellung der ursprünglichen Version setzt
Kleist die Abschrift mit neuer Feder
fort.
Jetzt ſtürzt der Kerl, und ich ſchon will
mich wenden,
Als ich’s im Dunkeln auf ſich rappeln
ſehe.
Ruprecht.Kleist hat zunächst die folgenden
fünfzehn Verse bis Vers 997 gestrichen und
durch die Verse (982+1 bis 982+6) ersetzt.
Später wird die gesamte Streichung durch eine
gestrichelte Linie am rechten Rand wieder
aufgehoben und stattdessen werden die neu
eingefügten Verse wieder
gestrichen.
Klinke, ja, zu dienen.
Und auf
dem Griff — den Stiel hatt’ ich
gefaßt,—
Lag eine
Menſchenfauſt, geballt, von
Meſſing:
auch:
Die
gilt, reicht’ ich ihn auch mit meiner
nicht.
Adam
Er, grober
Ochs, er hätt’ ihn tödten können,
Den
Leberecht!
Walter.
Zur
Sache doch! Zur Sache!
Ruprecht.
Was?
Adam.
Ob’s —?
Ob’s —?
Ob’s —
Ob’s —
Ruprecht.
Ja, die Thürklinke.
Adam.
Darum.
Licht.
Ihr glaubtet wohl, es war ein
Degen?
Adam.
Ein Degen? Ich — wie ſo?
Ruprecht.
Ein Degen!
Licht.
Je nun!
Man kann ſich wohl verhören. Eine Klinke
Hat ſehr viel Ähnlichkeit mit einem
Degen.
Adam.
Ich glaub’ —!
Licht.
Bei meiner Treu! Der Stiel, Herr
Richter?
Rupre
Adam.
Der Stiel!
Ruprecht.
Der Stiel! Der
war’s nun aber nicht.
Der Stiel! Der wars nun
aber nicht.
Das
Der Klinke umgekehrtes Ende war’s.
Adam.
Das umgekehrte Ende war’s der Klinke!
Licht.
So! So!
55.
Ruprecht.
Doch auf dem Griffe lag ein
Klumpen
Blei, wie ein Degengriff, das muß ich
ſagen.
Adam.
Ja, wie ein Griff.
Licht.
Gut. Wie ein Degengriff.
Doch irgend eine tückſche
Waffe mußt es
Doch irgend eine
tuͤckſche Waffe mußt’ es
Geweſen ſein. Das wußt’ ich wohl.
Walter.
Zur Sache ſtets, ihr
Herren, doch! Zur Sache!
Zur Sache ſtets, ihr
Herrn, doch! Zur Sache!
Adam.
Nichts als Allotrien, Herr Schreiber! — Er,
weiter!
Ruprecht.Ab hier wieder Federwechsel.
Die wieder rückgängig gemachte Überarbeitung der Verse
982ff ist eine Sofortkorrektur Kleists gewesen, zu der
er sich nach Abschrift der (uns unbekannten)
Vorlage(n) bis Vers 997 entschlossen hatte. Nach
Streichung der Überarbeitung (982+1 bis 982+6) und
Wiederherstellung der ursprünglichen Version setzt
Kleist die Abschrift mit neuer Feder
fort.
Jetzt ſtürzt der Kerl, und ich ſchon will
mich wenden,
Als ich’s im Dunkeln auf ſich rappeln
ſehe.
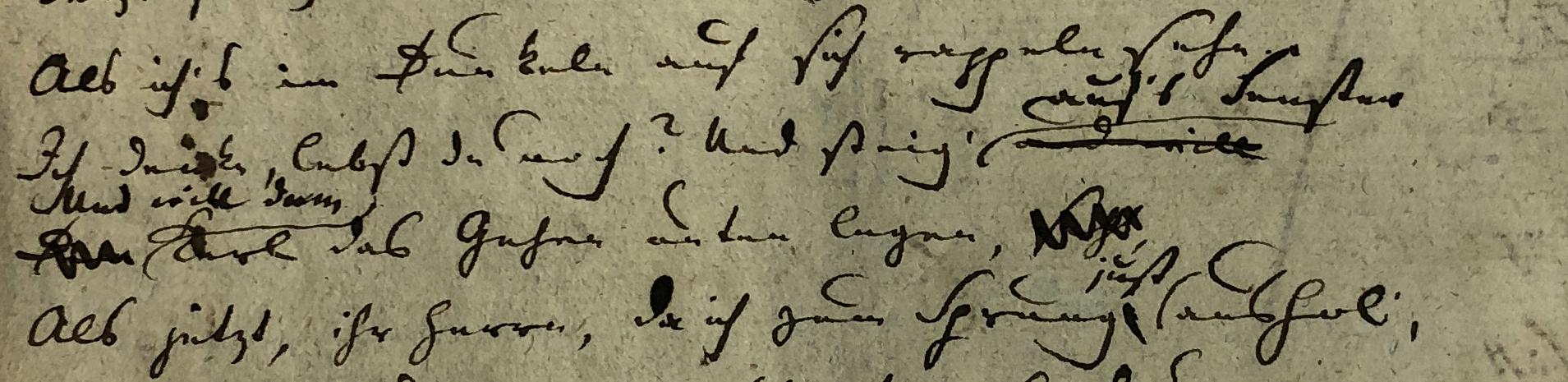 Ich denke, lebſt du noch? Und ſteig’ und will
auf’s Fenſter
Ich denke, lebſt du noch?
Und ſteig’ und will
Ich denke, lebſt
du noch? Und ſteig’ auf’s Fenſter
Ich denke, lebſt du
noch? und ſteig auf’s Fenſter
Dem
Und will dem Kerl das
Gehen unten legen, ſeht,
Dem Kerl das
Gehen unten legen, ſeht,
Und will
dem Kerl das Gehen unten legen,
Und will dem Kerl das
Gehen unten legen:
Als jetzt, ihr Herrn, da ich zum Sprunge
juſt
aushol’,
Als jetzt, ihr Herrn, da
ich zum Sprunge aushol’,
Als jetzt, ihr
Herrn, da ich zum Sprung juſt aushol’,
Als jetzt, ihr Herrn,
da ich zum Sprung juſt aushol’,
Mir eine Handvoll grobgekörnten Sandes
—
— Und Kerl und Nacht und Welt und
Fenſterbrett,
Worauf ich ſteh, denk’ ich nicht, ſtraf
mich Gott,
Das Alles fällt in einen Sack zuſam̄en
—
Wie Hagel, ſtiebend, in die Augen
fliegt.
Adam.
Verflucht! Sieh da! Wer that das?
Ruprecht.
Wer? Der Lebrecht.
Adam.
Hallunke!
Ruprecht.
Meiner Treu! Wenn er’s
geweſen.
Adam.
Wer ſonſt?
Wer ſonſt!
56.
Ruprecht.
Als ſtürzte mich ein Schloſſenregen
Von eines Bergs zehn Klaftern
hohen Abhang,
Ich denke, lebſt du noch? Und ſteig’ und will
auf’s Fenſter
Ich denke, lebſt du noch?
Und ſteig’ und will
Ich denke, lebſt
du noch? Und ſteig’ auf’s Fenſter
Ich denke, lebſt du
noch? und ſteig auf’s Fenſter
Dem
Und will dem Kerl das
Gehen unten legen, ſeht,
Dem Kerl das
Gehen unten legen, ſeht,
Und will
dem Kerl das Gehen unten legen,
Und will dem Kerl das
Gehen unten legen:
Als jetzt, ihr Herrn, da ich zum Sprunge
juſt
aushol’,
Als jetzt, ihr Herrn, da
ich zum Sprunge aushol’,
Als jetzt, ihr
Herrn, da ich zum Sprung juſt aushol’,
Als jetzt, ihr Herrn,
da ich zum Sprung juſt aushol’,
Mir eine Handvoll grobgekörnten Sandes
—
— Und Kerl und Nacht und Welt und
Fenſterbrett,
Worauf ich ſteh, denk’ ich nicht, ſtraf
mich Gott,
Das Alles fällt in einen Sack zuſam̄en
—
Wie Hagel, ſtiebend, in die Augen
fliegt.
Adam.
Verflucht! Sieh da! Wer that das?
Ruprecht.
Wer? Der Lebrecht.
Adam.
Hallunke!
Ruprecht.
Meiner Treu! Wenn er’s
geweſen.
Adam.
Wer ſonſt?
Wer ſonſt!
56.
Ruprecht.
Als ſtürzte mich ein Schloſſenregen
Von eines Bergs zehn Klaftern
hohen Abhang,
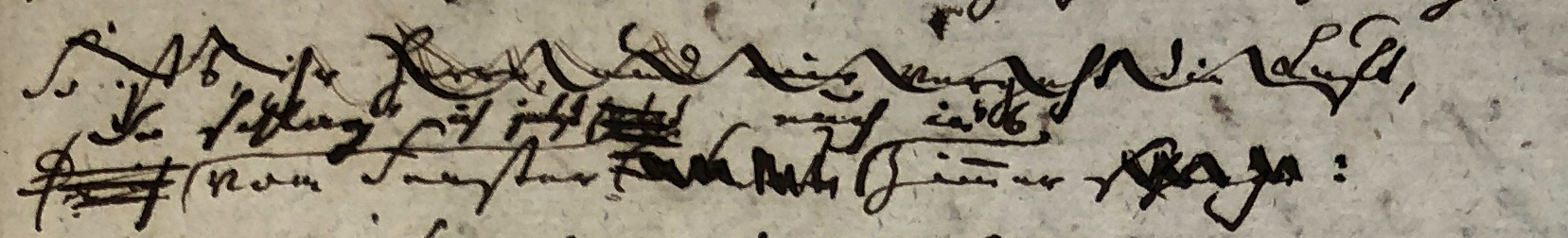 So iſt’s, ihr Herrn,
und mir vergeht die Luft,
So iſt’s, ihr Herrn, und
mir vergeht die Luft,
[gestrichen]
[in H
gestrichen]
Da ich
So ſchlag’ ich jetzt
vom Fenſter jetzt
in’s
das
euch
in’s Zim̄er ſchlage:
Da ich vom Fenſter in
das Zim̄er ſchlage:
Da ich vom Fenſter
jetzt
in’s Zim̄er
ſchlage:
So ſchlag’
ich jetzt vom Fenſter euch in’s
Zim̄er:
So ſchlag’ ich jetzt
vom Fenſter euch ins Zimmer:
Ich denk’, ich ſchmettere
den Boden ein.
Ich denk’ ich
ſchmettere den Boden ein.
Nun brech’ ich mir den Hals doch nicht,
auch nicht
Das Kreuz mir, auch die
Ribben nicht,
Hüften, oder ſonſt,
inzwiſchen
Das Kreuz mir, auch die
Ribben nicht, inzwiſchen
Das Kreuz mir,
Hüften, oder ſonſt, inzwiſchen
Das Kreuz mir, Huͤften,
oder ſonſt, inzwiſchen
Konnt’ ich des Kerls doch nicht mehr
habhaft werden,
Und ſitze auf, und wiſche mir die
Augen.
Die kom̄t, und ach, Herr Gott! ruft ſie,
und Ruprecht!
Was iſt dir auch? Mein Seel’, ich hob den
Fuß,
Gut war’s, daß ich nicht ſah, wohin ich
ſtieß.
So iſt’s, ihr Herrn,
und mir vergeht die Luft,
So iſt’s, ihr Herrn, und
mir vergeht die Luft,
[gestrichen]
[in H
gestrichen]
Da ich
So ſchlag’ ich jetzt
vom Fenſter jetzt
in’s
das
euch
in’s Zim̄er ſchlage:
Da ich vom Fenſter in
das Zim̄er ſchlage:
Da ich vom Fenſter
jetzt
in’s Zim̄er
ſchlage:
So ſchlag’
ich jetzt vom Fenſter euch in’s
Zim̄er:
So ſchlag’ ich jetzt
vom Fenſter euch ins Zimmer:
Ich denk’, ich ſchmettere
den Boden ein.
Ich denk’ ich
ſchmettere den Boden ein.
Nun brech’ ich mir den Hals doch nicht,
auch nicht
Das Kreuz mir, auch die
Ribben nicht,
Hüften, oder ſonſt,
inzwiſchen
Das Kreuz mir, auch die
Ribben nicht, inzwiſchen
Das Kreuz mir,
Hüften, oder ſonſt, inzwiſchen
Das Kreuz mir, Huͤften,
oder ſonſt, inzwiſchen
Konnt’ ich des Kerls doch nicht mehr
habhaft werden,
Und ſitze auf, und wiſche mir die
Augen.
Die kom̄t, und ach, Herr Gott! ruft ſie,
und Ruprecht!
Was iſt dir auch? Mein Seel’, ich hob den
Fuß,
Gut war’s, daß ich nicht ſah, wohin ich
ſtieß.
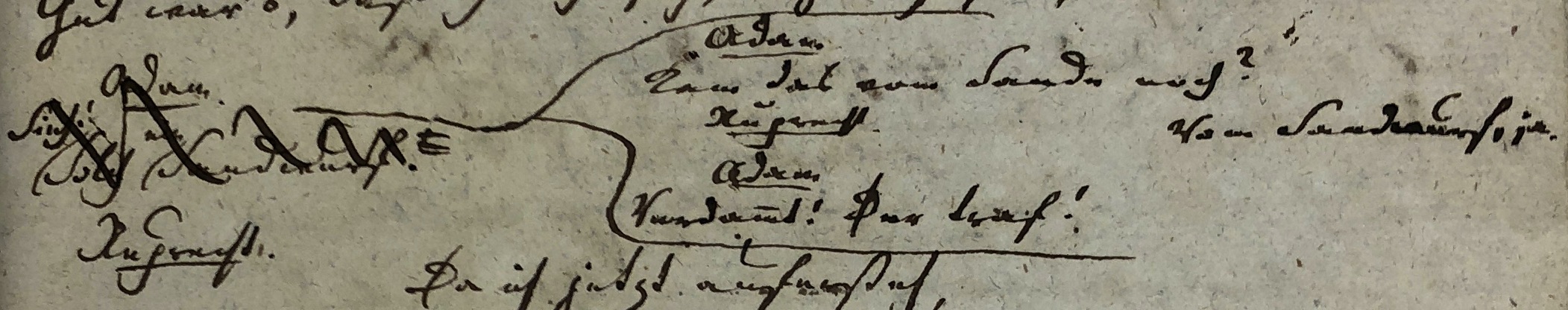 Adam.Die Korrekturen der Verse 1021f müssen im
Zusammenhang gelesen werden. Variante ɑ entspricht der
Grundschicht (›Adam. Solch Sandwurf! | Ruprecht. Da
ich jetzt auferſteh, ‹). Nach der Zwischenvariante β
korrigiert Kleist nochmals in Variante ɣ mit zwei
zusätzlichen Halbversen (Fassung E).
Sieh! Solch ein
Sandwurf!
Solch Sandwurf!
Sieh!
Solch ein Sandwurf!
Adam
Kam das vom Sande
noch?
Kam das vom Sande
noch?
Kam das vom Sande
noch?
Ruprecht.
Vom
Sandwurf, ja.
Vom Sandwurf,
ja.
Vom Sandwurf, ja.
Adam
Verdam̄t! Der
traf!
Verdam̄t! Der
traf!
Verdammt! Der
traf!
Ruprecht.
Da ich jetzt auferſteh,
Da ich jetzt
auferſteh,
Da ich jetzt
auferſteh’
Was ſollt’ ich auch die Fäuſte hier mir
ſchänden?
So ſchimpf’ ich ſie, und ſage liederliche
Metze,
Und denke, das iſt gut genug für ſie.
Adam.Die Korrekturen der Verse 1021f müssen im
Zusammenhang gelesen werden. Variante ɑ entspricht der
Grundschicht (›Adam. Solch Sandwurf! | Ruprecht. Da
ich jetzt auferſteh, ‹). Nach der Zwischenvariante β
korrigiert Kleist nochmals in Variante ɣ mit zwei
zusätzlichen Halbversen (Fassung E).
Sieh! Solch ein
Sandwurf!
Solch Sandwurf!
Sieh!
Solch ein Sandwurf!
Adam
Kam das vom Sande
noch?
Kam das vom Sande
noch?
Kam das vom Sande
noch?
Ruprecht.
Vom
Sandwurf, ja.
Vom Sandwurf,
ja.
Vom Sandwurf, ja.
Adam
Verdam̄t! Der
traf!
Verdam̄t! Der
traf!
Verdammt! Der
traf!
Ruprecht.
Da ich jetzt auferſteh,
Da ich jetzt
auferſteh,
Da ich jetzt
auferſteh’
Was ſollt’ ich auch die Fäuſte hier mir
ſchänden?
So ſchimpf’ ich ſie, und ſage liederliche
Metze,
Und denke, das iſt gut genug für ſie.
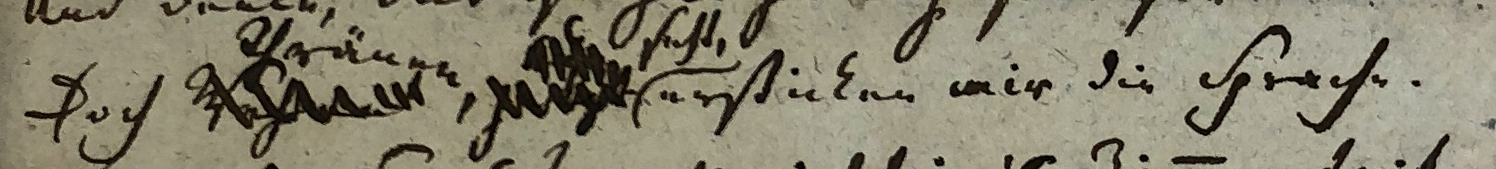 Doch Wehen
Thränen
,
jetzt
nun
ſeht,
erſticken mir die Sprache.
Doch Wehen
jetzt erſticken mir die Sprache.
Doch
Thränen
nun erſticken mir die Sprache.
Doch
Thränen, ſeht, erſticken mir
die Sprache.
Doch Thraͤnen, ſeht,
erſticken mir die Sprache.
Denn da Frau Marthe jetzt in’s Zim̄er
trit,
Doch Wehen
Thränen
,
jetzt
nun
ſeht,
erſticken mir die Sprache.
Doch Wehen
jetzt erſticken mir die Sprache.
Doch
Thränen
nun erſticken mir die Sprache.
Doch
Thränen, ſeht, erſticken mir
die Sprache.
Doch Thraͤnen, ſeht,
erſticken mir die Sprache.
Denn da Frau Marthe jetzt in’s Zim̄er
trit,
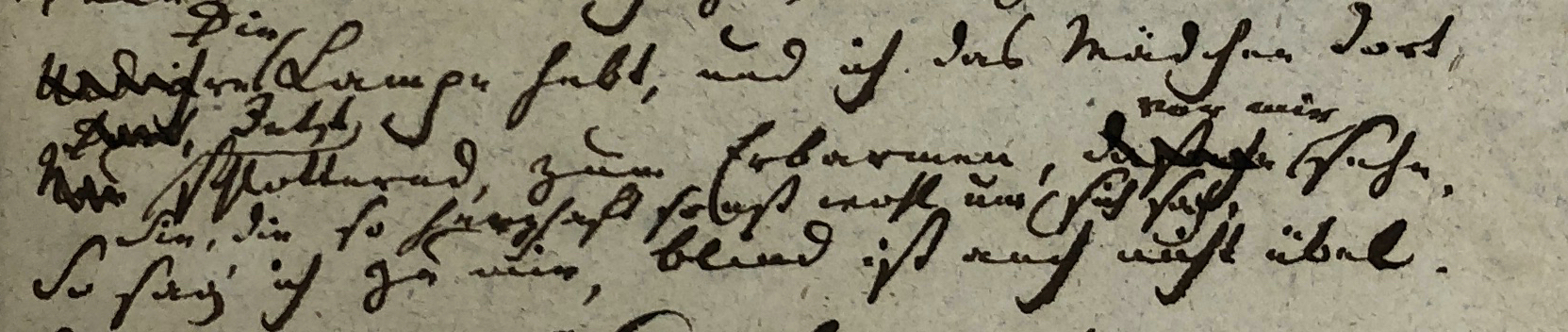 Und ihre
Die
Lampe hebt, und ich das Mädchen dort,
Und ihre Lampe
hebt, und ich das Mädchen
Die
Lampe hebt, und ich das Mädchen dort,
Die Lampe hebt, und ich
das Maͤdchen dort
Nun
Dort,
Jetzt
ſchlotternd, zum Erbarmen, daſtehn
vor
mir ſehe,
Nun ſchlotternd,
zum Erbarmen, daſtehn ſehe,
Dort,
ſchlotternd, zum Erbarmen, daſtehn
ſehe,
Jetzt
ſchlotternd, zum Erbarmen, vor mir
ſehe,
Jetzt ſchlotternd, zum
Erbarmen vor mir ſehe,
Sie, die ſo herzhaft
ſonſt wohl um ſich ſah,
[ ]
Sie, die ſo
herzhaft ſonſt wohl um ſich ſah,
Sie, die ſo herzhaft
ſonſt wohl um ſich ſah,
So ſag’ ich zu mir, blind iſt auch nicht
übel.
Ich hätte meine Augen hingegeben,
Knippkügelchen,
wer will, damit zu
ſpielen.
Eve.
Er iſt nicht werth, der Böſ’wicht —
Adam.
Sie ſoll ſchweigen!
Ruprecht.
Das Weitre wißt ihr.
Adam.
Wie, das Weitere?
Ruprecht.
Nun ja, Frau Marthe kam, und geiferte,
57.
Und Ralf, der Nachbar, kam, und Hinz, der
Nachbar,
Und Muhme Suſ’ und Muhme Lieſe kamen,
Und Knecht’ und Mägd’ und
Hund’ und Katzen kamen,
Und Knecht und Maͤgd’
und Hund’ und Katzen kamen,
S’ war ein Spektakel, und Frau Marthe
fragte
Die Jungfer dort, wer ihr den Krug
zerſchlagen,
Und die, die ſprach, ihr wißt’s, daß ich’s
geweſen.
Mein Seel, ſie hat ſo
Unrecht nicht, ihr Herren.
Mein Seel’, ſie hat ſo
Unrecht nicht, ihr Herren.
Den Krug, den ſie zu Waſſer trug, zerſchlug
ich,
Und der Flickſchuſter hat
im Kopf ein Loch.
Und der Flickſchuſter
hat im Kopf ein Loch. —Der Gedankenstrich, der
sich in E am Ende des Verses findet, verdankt sich
möglicherweise einem Abschreibfehler. In H hat
Kleist hier einen horizontalen Markierungsstrich
gesetzt (für eine mögliche spätere
Szeneneinteilung). Auszuschließen ist aber nicht,
daß Kleist für E in der Korrektur einen expliziten
Gedankenstrich gesetzt hat, da die Aussage
Ruprechts hier endet.
Adam.
Und ihre
Die
Lampe hebt, und ich das Mädchen dort,
Und ihre Lampe
hebt, und ich das Mädchen
Die
Lampe hebt, und ich das Mädchen dort,
Die Lampe hebt, und ich
das Maͤdchen dort
Nun
Dort,
Jetzt
ſchlotternd, zum Erbarmen, daſtehn
vor
mir ſehe,
Nun ſchlotternd,
zum Erbarmen, daſtehn ſehe,
Dort,
ſchlotternd, zum Erbarmen, daſtehn
ſehe,
Jetzt
ſchlotternd, zum Erbarmen, vor mir
ſehe,
Jetzt ſchlotternd, zum
Erbarmen vor mir ſehe,
Sie, die ſo herzhaft
ſonſt wohl um ſich ſah,
[ ]
Sie, die ſo
herzhaft ſonſt wohl um ſich ſah,
Sie, die ſo herzhaft
ſonſt wohl um ſich ſah,
So ſag’ ich zu mir, blind iſt auch nicht
übel.
Ich hätte meine Augen hingegeben,
Knippkügelchen,
wer will, damit zu
ſpielen.
Eve.
Er iſt nicht werth, der Böſ’wicht —
Adam.
Sie ſoll ſchweigen!
Ruprecht.
Das Weitre wißt ihr.
Adam.
Wie, das Weitere?
Ruprecht.
Nun ja, Frau Marthe kam, und geiferte,
57.
Und Ralf, der Nachbar, kam, und Hinz, der
Nachbar,
Und Muhme Suſ’ und Muhme Lieſe kamen,
Und Knecht’ und Mägd’ und
Hund’ und Katzen kamen,
Und Knecht und Maͤgd’
und Hund’ und Katzen kamen,
S’ war ein Spektakel, und Frau Marthe
fragte
Die Jungfer dort, wer ihr den Krug
zerſchlagen,
Und die, die ſprach, ihr wißt’s, daß ich’s
geweſen.
Mein Seel, ſie hat ſo
Unrecht nicht, ihr Herren.
Mein Seel’, ſie hat ſo
Unrecht nicht, ihr Herren.
Den Krug, den ſie zu Waſſer trug, zerſchlug
ich,
Und der Flickſchuſter hat
im Kopf ein Loch.
Und der Flickſchuſter
hat im Kopf ein Loch. —Der Gedankenstrich, der
sich in E am Ende des Verses findet, verdankt sich
möglicherweise einem Abschreibfehler. In H hat
Kleist hier einen horizontalen Markierungsstrich
gesetzt (für eine mögliche spätere
Szeneneinteilung). Auszuschließen ist aber nicht,
daß Kleist für E in der Korrektur einen expliziten
Gedankenstrich gesetzt hat, da die Aussage
Ruprechts hier endet.
Adam.
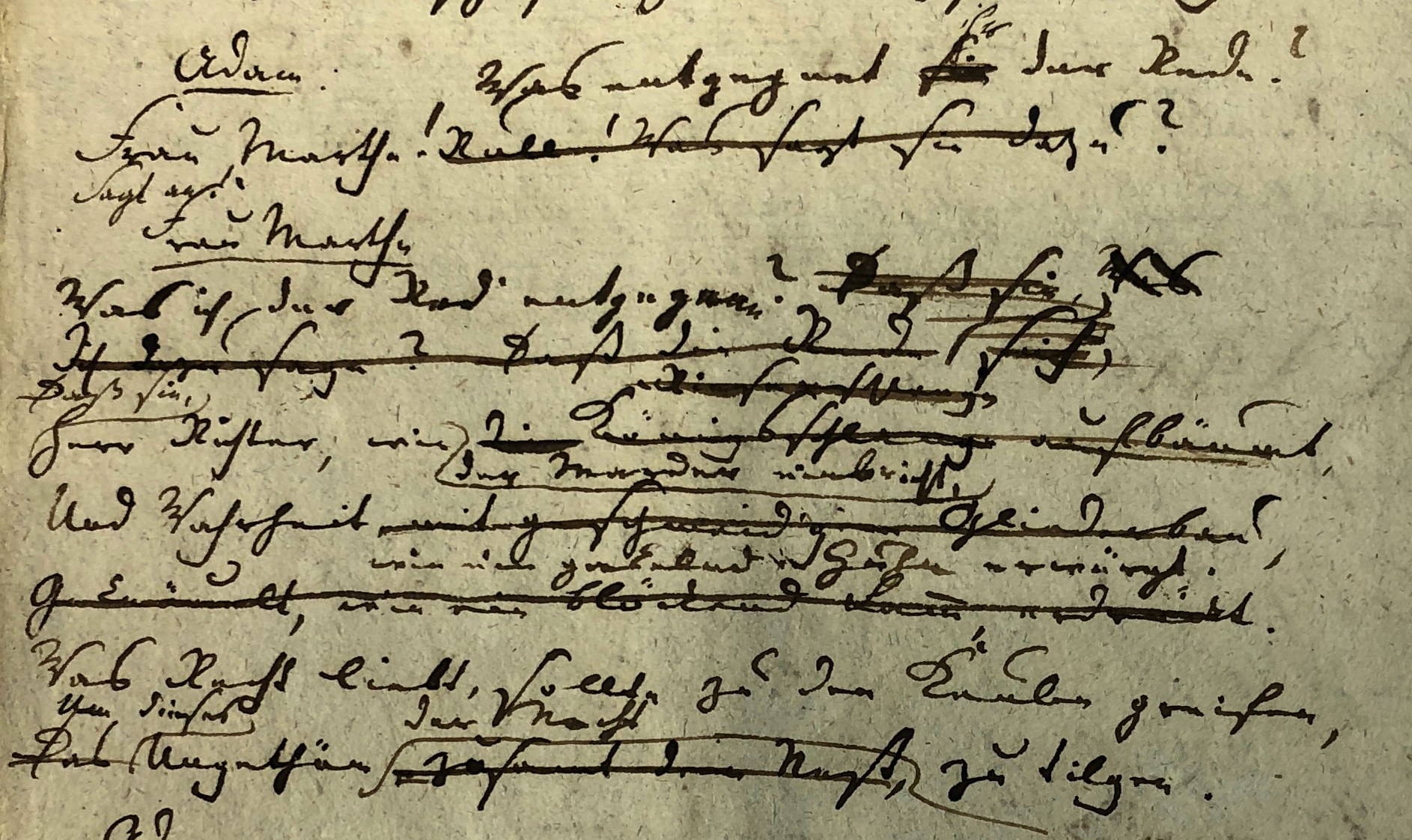 Frau Marthe!
Rull! Was ſagt ſie dazu?
Was entgegnet ſie
ihr der Rede?Vers
1046 bildet zunächst mit 1046-F eine Analepse und wird
nach Streichung von 1046-F zu einem Vollvers
erweitert.
Frau Marthe Rull! Was
ſagt ſie dazu?
Frau Marthe!
Was entgegnet ſie der Rede?
Frau Marthe! Was
entgegnet ihr der Rede?
Frau Marthe! Was
entgegnet ihr der Rede?
Sagt
an!Der Halbvers ›Sagt an!‹ wird notwendig im
Zusammenhang der Korrektur von Vers 1047, der von
Kleist im versübergreifenden Textstand δ auf einen
vierfüßigen Halbvers gekürzt wird. Vgl. Diskussion der
Verse 1046ff in Dunz-Wolff, Kleists Arbeit am Vers
(wie Anm. xx) S. xxx
[ ]
Sagt an!
Sagt an!
Frau Marthe
Was
Was
[ ]
[ ]
Ich dazu ſage?
Daß die Rede
Was ich der Red’ entgegneene? Daß
ſie,
ſich,
Ich dazu ſage? Daß die
Rede ſich,
Was ich der Red’
entgegne? Daß ſie
ſich,
Was ich der Red’ entgegne?
Daß ſie,
Was ich der Red’
entgegene?
Was ich der Red
entgegene?
Daß
ſie, Herr Richter, wie die
Königsſchlange
Rieſenſchlange
aufbäumt,
der Marder
einbricht,
Herr Richter, wie die
Königsſchlange aufbäumt,
Herr Richter, wie die
Rieſenſchlange aufbäumt,
Herr Richter, wie der
Marder einbricht,
Daß
ſie, Herr Richter, wie der Marder
einbricht,
Daß ſie, Herr Richter,
wie der Marder einbricht,
Und Wahrheit, mit
geſchmeid’gem Gliederbau,
wie ein gakelnd Huhn
erwürgt.
Und Wahrheit, mit
geſchmeid’gem Gliederbau,
Und Wahrheit
wie ein gakelnd Huhn erwürgt.
Und Wahrheit wie ein
gakelnd Huhn erwuͤrgt.
Geknäuelt, wie ein
blöckend Lam̄, erdrückt.
Geknäuelt, wie ein
blöckend Lam̄, erdrückt.
[ ]
[ ]
Was Recht liebt, ſollte zu den Keulen
greifen,
Das
Um dieſes Ungethüm,
zuſamt dem Neſt,
der Nacht zu
tilgen.
Das
Ungethüm,
zuſamt dem Neſt, zu tilgen.
Das Ungethüm der
Nacht zu tilgen.Es
ist nicht zu entscheiden, ob ›Um dieſes‹
gleichzeitig mit ›der Nacht‹ oder nachträglich
eingefügt worden ist. Die Schriftmerkmale sprechen
eher dagegen. Bei gleichzeitiger Korrektur würde
Variante b entfallen. Vgl. Dunz-Wolff, Kleists
Arbeit am Vers (wie Anm. xx), S. xxx.
Um
dieſes Ungethüm der Nacht zu tilgen.
Um dieſes Ungethuͤm der
Nacht zu tilgen.
Adam.
Da wird ſie den Beweis uns führen
müſſen.
Frau Marthe.
O ja, ſehr gern. Hier iſt
mein Zeuge — Rede!
O ja, ſehr gern. Hier
iſt mein Zeuge. — Rede!
Adam
Die Tochter? Nein, Frau Marthe.
Walter.
Nein? Warum nicht?
Adam.
Als Zeuginn, gnäd’ger Herr? Steht
ihm
im
Geſetzbuch
Nicht, titulo, iſt’s quarto? oder quinto?
Nicht titulo, iſt’s quarto? oder quinto?
Wenn Krüge, oder ſonſt,
was weiß ich?
Wenn Kruͤge oder ſonſt,
was weiß ich?
Von jungen Bengeln ſind zerſchlagen
worden,
So zeugen Töchter ihren Müttern nicht?
58.
Walter.
In eurem Kopf liegt Wiſſenſchafft und
Irrthum
Geknetet, innig, wie ein Teig,
zuſam̄en;
Mit jedem Schnitte gebt ihr mir von
beidem.
Die Jungfer zeugt noch nicht, ſie deklarirt
jetzt;
Ob, und für wen, ſie
zeugen will, und kann,
Ob, und fuͤr wen, ſie
zeugen will und kann,
Wird erſt aus der Erklärung ſich
ergeben.
Adam.
Ja, deklariren,.
gGut. Titulo secto.
Ja, deklariren,
gut. Titulo
secto.
Ja,
deklariren.
Gut. Titulo
secto.
Ja, deklariren. Gut.
Titulo sexto.
Doch was ſie ſagt, das glaubt man
nicht.
Walter.
Trit vor, mein junges Kind.
Adam.
He! Liſ’ —! — Erlaubt!
Die Zunge wird ſehr trocken mir —
Margrethe!
Eine Magd /: trit auf :/
Ein Glas mit Waſſer! — Kann
ich gleichfalls dienen?
Ein Glas mit Waſſer! —
Kann ich gleichfalls dienen?
Ein Glas mit Waſſer!
—
Ein Glas mit Waſſer!
—
Die Magd.
Gleich.
Gleich!
Adam.
Kann ich euch gleichfalls euch —?
Kann ich gleichfalls
euch —?
Kann ich
euch gleichfalls —?
Kann ich euch
gleichfalls —!
Walter.
Ich danke.
Adam.
Franz? Oder
Moſ’ler? Was ihr wollt.
Franz? oder Moſ’ler?
Was ihr wollt.
Walter
/: verneigt ſich,
:/
und die Magd geht ab,
:/ und bringt Waſſer
:/
AdamOffensichtlich wollte Kleist zunächst nach ›Adam‹
mit Vers 1072 fortfahren, entschied sich aber für
die Einfügung einer Regieanweisung. Diese wurde
von Kleist jedoch gar nicht beendet, sondern
gestrichen und stattdessen die vorher stehende
Regieanweisung (Walter) in zwei Schritten ergänzt.
In E ändert Kleist in ›Walter (verneigt ſich; die
Magd bringt Waſſer und entfernt ſich.)‹,
anschließend folgt der ›Neunte
Auftritt‹.
Die Magd
/: geht und bringt
Waſſer
Adam
— Wenn ich freimüthig reden darf, Ihr
Gnaden,
Die Sache eignet gut ſich zum
Vergleich.
Walter.
Sich zum Vergleich? Das iſt nicht klar,
Herr Richter.
Vernünft’ge Leute können ſich
vergleichen;
59.
Doch wie ihr den Vergleich ſchon wollt bewirken,
Da noch durchaus die Sache nicht
entworren,
Das hätt’ ich wohl von euch zu hören
Luſt.
Wie denkt ihr’s anzuſtellen, ſagt mir
an?
Habt ihr ein Urtheil ſchon gefaßt?
Adam.
Mein Seel!
Wenn ich, da das Geſetz im Stich mich
läßt,
Philoſophie zu Hülfe nehmen ſoll,
So war’s — der Leberecht
—
Walter.
Wer?
Adam.
Oder Ruprecht —
Walter.
Wer?
Adam.
Oder Lebrecht, der den Krug
zerſchlug.
Walter.
Wer alſo war’s? Der Lebrecht oder
Ruprecht?
Ihr greift, ich ſeh, mit eurem Urtheil
ein,
Wie eine Hand in einen Sack voll
Erbſen.
Adam
Erlaubt!
Walter.
Schweigt, ſchweigt, ich bitt’ euch.
Adam.
Wie ihr wollt.
Auf meine Ehre, ſeht, mir
wär’s
es
vollkom̄en recht,
Auf meine Ehre, mir wär’s
recht,
Auf meine Ehre,
ſeht, mir wär’ es recht,
Auf meine Ehre, mir
wär’ vollkom̄en recht,
Auf meine Ehr, mir
waͤr’s vollkommen recht,
Wenn ſie es alle beid’ geweſen wären.
Frau Marthe!
Rull! Was ſagt ſie dazu?
Was entgegnet ſie
ihr der Rede?Vers
1046 bildet zunächst mit 1046-F eine Analepse und wird
nach Streichung von 1046-F zu einem Vollvers
erweitert.
Frau Marthe Rull! Was
ſagt ſie dazu?
Frau Marthe!
Was entgegnet ſie der Rede?
Frau Marthe! Was
entgegnet ihr der Rede?
Frau Marthe! Was
entgegnet ihr der Rede?
Sagt
an!Der Halbvers ›Sagt an!‹ wird notwendig im
Zusammenhang der Korrektur von Vers 1047, der von
Kleist im versübergreifenden Textstand δ auf einen
vierfüßigen Halbvers gekürzt wird. Vgl. Diskussion der
Verse 1046ff in Dunz-Wolff, Kleists Arbeit am Vers
(wie Anm. xx) S. xxx
[ ]
Sagt an!
Sagt an!
Frau Marthe
Was
Was
[ ]
[ ]
Ich dazu ſage?
Daß die Rede
Was ich der Red’ entgegneene? Daß
ſie,
ſich,
Ich dazu ſage? Daß die
Rede ſich,
Was ich der Red’
entgegne? Daß ſie
ſich,
Was ich der Red’ entgegne?
Daß ſie,
Was ich der Red’
entgegene?
Was ich der Red
entgegene?
Daß
ſie, Herr Richter, wie die
Königsſchlange
Rieſenſchlange
aufbäumt,
der Marder
einbricht,
Herr Richter, wie die
Königsſchlange aufbäumt,
Herr Richter, wie die
Rieſenſchlange aufbäumt,
Herr Richter, wie der
Marder einbricht,
Daß
ſie, Herr Richter, wie der Marder
einbricht,
Daß ſie, Herr Richter,
wie der Marder einbricht,
Und Wahrheit, mit
geſchmeid’gem Gliederbau,
wie ein gakelnd Huhn
erwürgt.
Und Wahrheit, mit
geſchmeid’gem Gliederbau,
Und Wahrheit
wie ein gakelnd Huhn erwürgt.
Und Wahrheit wie ein
gakelnd Huhn erwuͤrgt.
Geknäuelt, wie ein
blöckend Lam̄, erdrückt.
Geknäuelt, wie ein
blöckend Lam̄, erdrückt.
[ ]
[ ]
Was Recht liebt, ſollte zu den Keulen
greifen,
Das
Um dieſes Ungethüm,
zuſamt dem Neſt,
der Nacht zu
tilgen.
Das
Ungethüm,
zuſamt dem Neſt, zu tilgen.
Das Ungethüm der
Nacht zu tilgen.Es
ist nicht zu entscheiden, ob ›Um dieſes‹
gleichzeitig mit ›der Nacht‹ oder nachträglich
eingefügt worden ist. Die Schriftmerkmale sprechen
eher dagegen. Bei gleichzeitiger Korrektur würde
Variante b entfallen. Vgl. Dunz-Wolff, Kleists
Arbeit am Vers (wie Anm. xx), S. xxx.
Um
dieſes Ungethüm der Nacht zu tilgen.
Um dieſes Ungethuͤm der
Nacht zu tilgen.
Adam.
Da wird ſie den Beweis uns führen
müſſen.
Frau Marthe.
O ja, ſehr gern. Hier iſt
mein Zeuge — Rede!
O ja, ſehr gern. Hier
iſt mein Zeuge. — Rede!
Adam
Die Tochter? Nein, Frau Marthe.
Walter.
Nein? Warum nicht?
Adam.
Als Zeuginn, gnäd’ger Herr? Steht
ihm
im
Geſetzbuch
Nicht, titulo, iſt’s quarto? oder quinto?
Nicht titulo, iſt’s quarto? oder quinto?
Wenn Krüge, oder ſonſt,
was weiß ich?
Wenn Kruͤge oder ſonſt,
was weiß ich?
Von jungen Bengeln ſind zerſchlagen
worden,
So zeugen Töchter ihren Müttern nicht?
58.
Walter.
In eurem Kopf liegt Wiſſenſchafft und
Irrthum
Geknetet, innig, wie ein Teig,
zuſam̄en;
Mit jedem Schnitte gebt ihr mir von
beidem.
Die Jungfer zeugt noch nicht, ſie deklarirt
jetzt;
Ob, und für wen, ſie
zeugen will, und kann,
Ob, und fuͤr wen, ſie
zeugen will und kann,
Wird erſt aus der Erklärung ſich
ergeben.
Adam.
Ja, deklariren,.
gGut. Titulo secto.
Ja, deklariren,
gut. Titulo
secto.
Ja,
deklariren.
Gut. Titulo
secto.
Ja, deklariren. Gut.
Titulo sexto.
Doch was ſie ſagt, das glaubt man
nicht.
Walter.
Trit vor, mein junges Kind.
Adam.
He! Liſ’ —! — Erlaubt!
Die Zunge wird ſehr trocken mir —
Margrethe!
Eine Magd /: trit auf :/
Ein Glas mit Waſſer! — Kann
ich gleichfalls dienen?
Ein Glas mit Waſſer! —
Kann ich gleichfalls dienen?
Ein Glas mit Waſſer!
—
Ein Glas mit Waſſer!
—
Die Magd.
Gleich.
Gleich!
Adam.
Kann ich euch gleichfalls euch —?
Kann ich gleichfalls
euch —?
Kann ich
euch gleichfalls —?
Kann ich euch
gleichfalls —!
Walter.
Ich danke.
Adam.
Franz? Oder
Moſ’ler? Was ihr wollt.
Franz? oder Moſ’ler?
Was ihr wollt.
Walter
/: verneigt ſich,
:/
und die Magd geht ab,
:/ und bringt Waſſer
:/
AdamOffensichtlich wollte Kleist zunächst nach ›Adam‹
mit Vers 1072 fortfahren, entschied sich aber für
die Einfügung einer Regieanweisung. Diese wurde
von Kleist jedoch gar nicht beendet, sondern
gestrichen und stattdessen die vorher stehende
Regieanweisung (Walter) in zwei Schritten ergänzt.
In E ändert Kleist in ›Walter (verneigt ſich; die
Magd bringt Waſſer und entfernt ſich.)‹,
anschließend folgt der ›Neunte
Auftritt‹.
Die Magd
/: geht und bringt
Waſſer
Adam
— Wenn ich freimüthig reden darf, Ihr
Gnaden,
Die Sache eignet gut ſich zum
Vergleich.
Walter.
Sich zum Vergleich? Das iſt nicht klar,
Herr Richter.
Vernünft’ge Leute können ſich
vergleichen;
59.
Doch wie ihr den Vergleich ſchon wollt bewirken,
Da noch durchaus die Sache nicht
entworren,
Das hätt’ ich wohl von euch zu hören
Luſt.
Wie denkt ihr’s anzuſtellen, ſagt mir
an?
Habt ihr ein Urtheil ſchon gefaßt?
Adam.
Mein Seel!
Wenn ich, da das Geſetz im Stich mich
läßt,
Philoſophie zu Hülfe nehmen ſoll,
So war’s — der Leberecht
—
Walter.
Wer?
Adam.
Oder Ruprecht —
Walter.
Wer?
Adam.
Oder Lebrecht, der den Krug
zerſchlug.
Walter.
Wer alſo war’s? Der Lebrecht oder
Ruprecht?
Ihr greift, ich ſeh, mit eurem Urtheil
ein,
Wie eine Hand in einen Sack voll
Erbſen.
Adam
Erlaubt!
Walter.
Schweigt, ſchweigt, ich bitt’ euch.
Adam.
Wie ihr wollt.
Auf meine Ehre, ſeht, mir
wär’s
es
vollkom̄en recht,
Auf meine Ehre, mir wär’s
recht,
Auf meine Ehre,
ſeht, mir wär’ es recht,
Auf meine Ehre, mir
wär’ vollkom̄en recht,
Auf meine Ehr, mir
waͤr’s vollkommen recht,
Wenn ſie es alle beid’ geweſen wären.
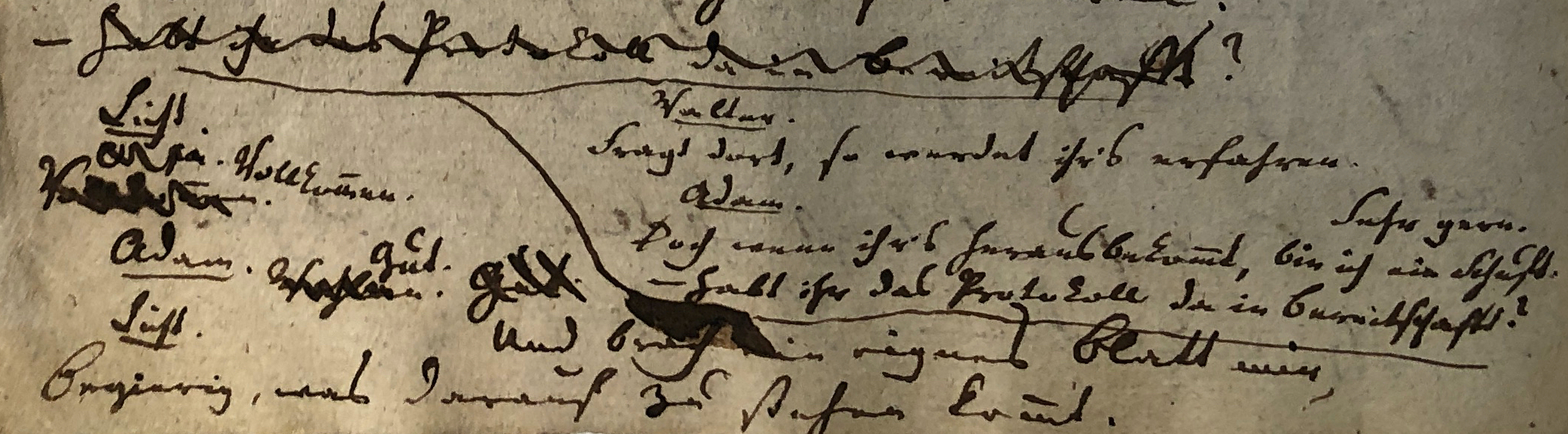 — Habt ihr das
Protokoll da in Bereitſchafft?
— Habt ihr das
Protokoll da in Bereitſchafft?
[ ]
[ ]
Walter.Der Dialog Walter-Adam Verse 1091 bis
1093 würde nachträglich einfügt, in dem sich auch
der oben gestrichene Verse 1090+1
wiederfindet.
Fragt dort, ſo werdet ihr’s
erfahren.
Adam.
Sehr
gern.
Doch wenn ihr’s herausbekom̄t, bin ich ein
Schuft.
Doch wenn ihr’s heraus
bekommt, bin ich ein Schuft.
— Habt ihr das
Protokoll da in Bereitſchafft?
Licht.
Vollkom̄en.Die
Versgenese ist nicht eindeutig zu rekonstruieren,
wenn auch die hier ausgewiesene sehr
wahrscheinlich ist. Vgl. Dunz-Wolff, Kleists
Arbeit am Vers (wie Anm. xx), S. xxx.
O
ja.
Vollkom̄en.
Vollkom̄en.
Vollkom̄en.
O
ja.
Vollkom̄en.
Vollkommen.
Adam.
Wohlan.
Gut.
Gut.
Wohlan.
Gut.
Gut.
Gut.
Gut.
Gut.
Licht.
Und brach ein
eignes Blatt mir,
Und brech’ ein eignes
Blatt mir,
Begierig, was darauf zu
ſtehen kom̄t.
60.
Adam.
Ein eignes Blatt? Auch gut.
Walter.
Sprich dort, mein Kind.
Adam.
Sprich, Evchen, hörſt du, ſprich jetzt,
Jungfer Evchen!
Gieb Gotte, hörſt du, Herzchen, gieb, mein
Seel,
Ihm und der Welt, gieb ihm was von der
Wahrheit.
Denk, daß du hier vor Gottes Richtſtuhl
biſt,
Und daß du deinen Richter nicht mit
Läugnen,
Und Plappern, was zur Sache nicht
gehört,
Betrüben mußt. Ach, was! Du biſt
vernünftig.
Ein Richter im̄er, weißt du, iſt ein
Richter,
Und Einer
brauhtbraucht
ihn heut, und Einer morgen.
Sagſt du, daß es der Lebrecht war: nun
gut;
Und ſagſt du, daß es Ruprecht war: auch
gut!
Sprich ſo, ſprich ſo, ich bin kein
ehrlicher Kerl,
Es wird ſich Alle¿s, wie du’s wünſcheſt
finden.
Willſt du mir hier von einem Andern
trätſchen,
Und Dritten etwa, dum̄e Namen nennen:
Sieh, Kind, nim dich in Acht, ich ſag’
nichts weiter.
In Huiſum, hol’s der Henker, glaubt dir’s
Keiner,
Und Keiner, Evchen, in den
Niederlanden,
Du weißt, die weißen Wände zeugen
nicht,
Der auch wird zu vertheidigen ſich
wiſſen:
Und deinen Ruprecht holt die
Schwerenoth!
Walter.
Wenn ihr doch eure Reden laſſen
wolltet.
Geſchwätz, gehauen nicht und nicht
geſtochen.
Adam.
Verſtehen’s Ew. Gnaden nicht?
Walter.
Macht fort.
jetzt;
Macht fort jetzt;
Macht fort.
Macht fort!
Ihr habt zulängſt hier auf dem Stuhl
geſprochen.
61.
Adam.
Auf Ehr’! Ich habe nicht
ſtudirt, Ew. Gnaden.
Auf Ehr! Ich habe nicht
ſtudirt, Ew. Gnaden.
Bin ich euch Herrn aus Utrecht nicht
verſtändlich,
Mit dieſem Volk vielleicht verhält ſich’s
anders:
Die Jungfer weiß, ich wette, was ich
will.
Frau Marthe
Was ſoll das? Dreiſt heraus jetzt mit der
Sprache!
Eve.
O liebſte Mutter!
Frau Marthe
Du —! Ich rathe dir!
Ruprecht.
Mein Seel, ſ’iſt ſchwer, Frau Marthe,
dreiſt zu ſprechen,
— Habt ihr das
Protokoll da in Bereitſchafft?
— Habt ihr das
Protokoll da in Bereitſchafft?
[ ]
[ ]
Walter.Der Dialog Walter-Adam Verse 1091 bis
1093 würde nachträglich einfügt, in dem sich auch
der oben gestrichene Verse 1090+1
wiederfindet.
Fragt dort, ſo werdet ihr’s
erfahren.
Adam.
Sehr
gern.
Doch wenn ihr’s herausbekom̄t, bin ich ein
Schuft.
Doch wenn ihr’s heraus
bekommt, bin ich ein Schuft.
— Habt ihr das
Protokoll da in Bereitſchafft?
Licht.
Vollkom̄en.Die
Versgenese ist nicht eindeutig zu rekonstruieren,
wenn auch die hier ausgewiesene sehr
wahrscheinlich ist. Vgl. Dunz-Wolff, Kleists
Arbeit am Vers (wie Anm. xx), S. xxx.
O
ja.
Vollkom̄en.
Vollkom̄en.
Vollkom̄en.
O
ja.
Vollkom̄en.
Vollkommen.
Adam.
Wohlan.
Gut.
Gut.
Wohlan.
Gut.
Gut.
Gut.
Gut.
Gut.
Licht.
Und brach ein
eignes Blatt mir,
Und brech’ ein eignes
Blatt mir,
Begierig, was darauf zu
ſtehen kom̄t.
60.
Adam.
Ein eignes Blatt? Auch gut.
Walter.
Sprich dort, mein Kind.
Adam.
Sprich, Evchen, hörſt du, ſprich jetzt,
Jungfer Evchen!
Gieb Gotte, hörſt du, Herzchen, gieb, mein
Seel,
Ihm und der Welt, gieb ihm was von der
Wahrheit.
Denk, daß du hier vor Gottes Richtſtuhl
biſt,
Und daß du deinen Richter nicht mit
Läugnen,
Und Plappern, was zur Sache nicht
gehört,
Betrüben mußt. Ach, was! Du biſt
vernünftig.
Ein Richter im̄er, weißt du, iſt ein
Richter,
Und Einer
brauhtbraucht
ihn heut, und Einer morgen.
Sagſt du, daß es der Lebrecht war: nun
gut;
Und ſagſt du, daß es Ruprecht war: auch
gut!
Sprich ſo, ſprich ſo, ich bin kein
ehrlicher Kerl,
Es wird ſich Alle¿s, wie du’s wünſcheſt
finden.
Willſt du mir hier von einem Andern
trätſchen,
Und Dritten etwa, dum̄e Namen nennen:
Sieh, Kind, nim dich in Acht, ich ſag’
nichts weiter.
In Huiſum, hol’s der Henker, glaubt dir’s
Keiner,
Und Keiner, Evchen, in den
Niederlanden,
Du weißt, die weißen Wände zeugen
nicht,
Der auch wird zu vertheidigen ſich
wiſſen:
Und deinen Ruprecht holt die
Schwerenoth!
Walter.
Wenn ihr doch eure Reden laſſen
wolltet.
Geſchwätz, gehauen nicht und nicht
geſtochen.
Adam.
Verſtehen’s Ew. Gnaden nicht?
Walter.
Macht fort.
jetzt;
Macht fort jetzt;
Macht fort.
Macht fort!
Ihr habt zulängſt hier auf dem Stuhl
geſprochen.
61.
Adam.
Auf Ehr’! Ich habe nicht
ſtudirt, Ew. Gnaden.
Auf Ehr! Ich habe nicht
ſtudirt, Ew. Gnaden.
Bin ich euch Herrn aus Utrecht nicht
verſtändlich,
Mit dieſem Volk vielleicht verhält ſich’s
anders:
Die Jungfer weiß, ich wette, was ich
will.
Frau Marthe
Was ſoll das? Dreiſt heraus jetzt mit der
Sprache!
Eve.
O liebſte Mutter!
Frau Marthe
Du —! Ich rathe dir!
Ruprecht.
Mein Seel, ſ’iſt ſchwer, Frau Marthe,
dreiſt zu ſprechen,
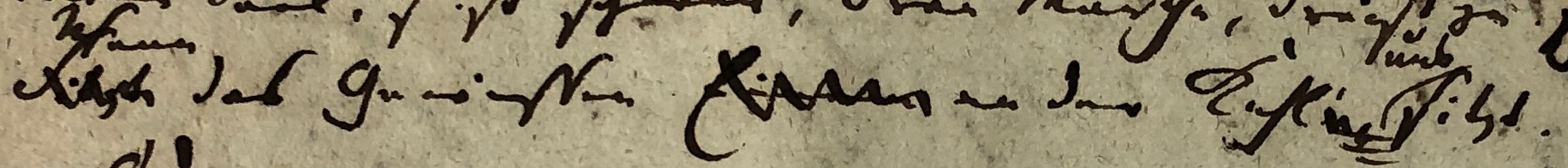 Sitzt
Wenn
das Gewiſſen Einem an der
Kehle.’
uns
ſitzt.
Sitzt das Gewiſſen
Einem an der Kehle.
Wenn das Gewiſſen an
der Kehle
ſitzt.
Wenn das Gewiſſen an
der Kehl’
uns
ſitzt.
Wenn das Gewiſſen an
der Kehl’ uns ſitzt.
Adam.
Schweig’ er jetzt, Naſ’weis, muckſ’ er nicht.
Frau Marthe.
Wer war’s?
Eve.
O Jeſus!
Frau Marthe.
Maulaffe, der! Der
niederträchtige!
O Jeſus! Als ob ſie eine Hure wäre.
War’s der Herr Jeſus?
Adam.
Sitzt
Wenn
das Gewiſſen Einem an der
Kehle.’
uns
ſitzt.
Sitzt das Gewiſſen
Einem an der Kehle.
Wenn das Gewiſſen an
der Kehle
ſitzt.
Wenn das Gewiſſen an
der Kehl’
uns
ſitzt.
Wenn das Gewiſſen an
der Kehl’ uns ſitzt.
Adam.
Schweig’ er jetzt, Naſ’weis, muckſ’ er nicht.
Frau Marthe.
Wer war’s?
Eve.
O Jeſus!
Frau Marthe.
Maulaffe, der! Der
niederträchtige!
O Jeſus! Als ob ſie eine Hure wäre.
War’s der Herr Jeſus?
Adam.
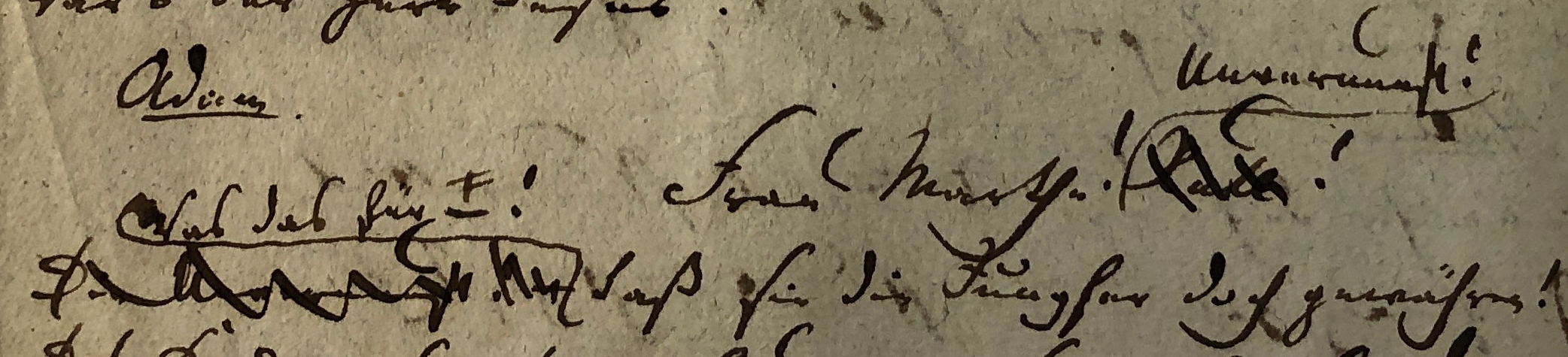 Frau Marthe!
Rull!
Unvernunft!
Frau Marthe
Rull!
Frau
Marthe!
Unvernunft!
Frau Marthe!
Unvernunft!
Die Unvernunft! —
Was das
für!
—!
Laß ſie die Jungfer doch gewähren!
Die Unvernunft!
— Laß ſie die Jungfer doch gewähren!
Was das für
—! Laß ſie die Jungfer doch gewähren!
Was das fuͤr —! Laß ſie
die Jungfer doch gewaͤhren!
Das Kind einſchrecken — Hure —
Schaafsgeſicht!
So wird’s uns nichts. Sie wird ſich ſchon
beſinnen.
Ruprecht.
O ja, beſinnen.
Adam.
Flaps dort,
ſchweig’ er jetzt.
Flaps dort, ſchweig er
jetzt.
62
Ruprecht.
Dier Flickſchuſter heißt
wird
ihr ſchon einfallen.
Der Flickſchuſter
heißt ihr ſchon einfallen.
Der Flickſchuſter
wird ihr ſchon einfallen.
Der Flickſchuſter wird
ihr ſchon einfallen.
Adam.
Der Satan! Ruft den Büttel! He!
Hanfriede!
Ruprecht.
Nun, nun! Ich ſchweig’, Herr Richter,
laßt’s nur ſein.
Sie wird
euch
Sie
wird euch ſchon auf meinen Namen
kom̄en.
Sie wird euch
ſchon auf meinen Namen kom̄en.
Sie wird euch ſchon auf meinen Namen
kom̄en.
Sie wird euch ſchon auf
meinen Nahmen kommen.
Frau Marthe.
Hör du, mach mir hier kein Spektakel, ſag’
ich.
Hör, neun und vierzig bin ich alt
geworden
In Ehren: funfzig mögt’ ich gern
erleben.
Den dritten Februar iſt
mein Geburtstag,
Den dritten Februar iſt
mein Geburtstag;
Heut iſt der erſte. Mach es kurz. Wer
war’s?
Adam.
Gut, meinethalben! Gut,
Frau Marthe, ſo!
Gut, meinethalben! Gut,
Frau Marthe Rull!
Frau Marthe.
Der Vater ſprach, als er verſchied,:
hHör’,BKA liest Korrektur in versales H nicht:
›verschied: hör‘,‹. Marthe,
Der Vater ſprach, als er
verſchied,
hör’, Marthe,
Der Vater ſprach, als
er verſchied:
Hör’, Marthe,
Der Vater ſprach, als
er verſchied: Hoͤr’, Marthe,
Dem Mädel ſchaff mir einen wackern
Mann;
Und wird ſie eine liederliche Metze,
So gieb dem Todtengräber einen
Groſchen,
Und laß mich wieder auf den Rücken
legen:
Mein Seel, ich glaub’, ich kehr’ im Grab mich um.
Mein Seel, ich glaub’, ich
kehr’ im Grab mich um.
Mein Seel, ich glaub’,
ich kehr’ mich um.
Mein Seel, ich glaub
ich kehr’ im Grab mich um.
Adam.
Nun! Das iſt auch nicht
übel.
Nun, das iſt auch
nicht uͤbel.
Frau Marthe
Willſt du Vater
Und Mutter jetzt, mein Evchen, nach dem
vierten
Gebot hochehren, gut, ſo
ſprich: in meine Kam̄er
Gebot hoch ehren, gut,
ſo ſprichIn E
folgt hinter dem ›sprich‹ kein Doppelpunkt wie in
H. Es wird in der Regel entsprechend emendiert
(BKA, Reclam/Hamacher). Ganz auszuschließen ist
eine Streichung des Doppelpunktes aus rhythmischen
Gründen allerdings nicht. in meine
Kammer
Ließ ich den Schuſter, oder einen
Dritten,
Hörſt du? Der Bräutgam
aber war es nicht.
Hoͤrſt du? Der
Braͤut’gam aber war es nicht.
Ruprecht.
Sie jam̄ert mich. Laßt doch den Krug, ich
bitt’ euch.
Ich will’n nach Utrecht
tragen. Solch’ ein Krug!
Ich will’n nach Utrecht
tragen. Solch’ ein Krug —.
Ich wollt’ ich hätt’ ihn nur entzwei
geſchlagen.
63.
Eve.
Unedelmüth’ger, du! Pfui, ſchäme dich,
Daß du nicht ſagſt, gut, ich zerſchlug den
Krug!
Pfui, Ruprecht, pfui, o ſchäme dich, daß
du
Mir nicht in meiner That vertrauen
kannſt.
Gab’ ich die Hand dir nicht, und ſagte,
ja,
Als du mich fragteſt, wirſt du treu mir ſein?
Eve, willſt du
mich?
Als du mich fragteſt,
wirſt du treu mir ſein?
Als du mich fragteſt,
Eve, willſt du mich?
Als du mich fragteſt,
Eve, willſt du mich?
Meinſt du, daß du den Flickſchuſter nicht
werth biſt?
Und hätteſt du durch’s Schlüſſelloch mich
mit
Dem Lebrecht aus dem Kruge trinken
ſehen,
Du hätteſt denken ſollen: Ev’ iſt brav,
Es wird ſich Alles ihr zum Ruhme löſen,
Und iſt’s im Leben nicht, ſo iſt es
jenſeits,
Und wenn wir auferſtehn iſt auch ein
Tag.
Ruprecht.
Mein Seel, das dauert mir zu lange,
Evchen.
Was ich mit Händen greife, glaub’ ich
gern.
Eve.
Geſetzt, es wär der Leberecht geweſen,
Warum — des Todes will ich ewig
ſterben,
Hätt’ ich’s dir Einzigem nicht gleich
vertraut;
Jedoch warum vor
Nachbarn, Knecht’ und Mägden,
Jedoch warum vor
Nachbarn, Knecht und Maͤgden —
Geſetzt, ich hätte
Gründ’, es zu verbergen,
Geſetzt, ich haͤtte
Grund, es zu verbergen,
Warum, o Ruprecht, ſprich, warum nicht
ſollt’ ich,
Auf dein Vertraun hin ſagen, daß du’s
warſt?
Warum nicht ſollt’ ich’s? Warum ſollt’
ich’s nicht?
Ruprecht.
Ei, ſo zum Henker, ſag’s, es iſt mir
Recht,
Wenn du die Fiedel dir erſparen kannſt.
Eve.
O du Abſcheulicher! Du Undankbarer!
64.
Werth, daß ich mir die Fiedel ſpare!
Werth,
Daß ich mit einem Wort zu Ehren mich,
Und dich in ewiges Verderben bringe.
Walter.
Nun —? Und dies einz’ge Wort —? Was ſoll man davon denken?!
Halt uns nicht auf.
Nun —? Und dies Wort —? Was
ſoll man davon denken?
Nun —? Und dies Wort —?
Was ſoll man davon
denken!
Nun —? Und dies
einz’ge Wort —? Halt uns nicht auf.
Nun —? Und dies einz’ge
Wort —? Halt uns nicht auf.
Der Ruprecht alſo war es nicht?
Eve.
Nein, gnäd’ger Herr, weil
er’s denn ſelbſt ſo will,
Nein gnaͤd’ger Herr,
weil ers denn ſelbſt ſo will,
Um ſeinetwillen nur verſchwieg ich es:
Den irdnen Krug zerſchlug der Ruprecht
nicht,
Wenn er’s euch ſelber läugnet, könnt ihr’s
glauben.
Frau Marthe
Eve! Der Ruprecht nicht?
Eve.
Nein, Mutter, nein!
Und wenn ich’s geſtern ſagte, war’s
gelogen.
Frau Marthe.
Hör, dir zerſchlag’ ich alle Knochen!
/: ſie ſetzt den Krug nieder
:/
Eve.
Thut, was ihr wollt.
Walter
/: drohend :/
Frau Marthe!
Adam.
He! Der Büttel! —
Schmeißt ſie heraus dort, die
verwünſchte Vettel!
Warum ſoll’s Ruprecht
juſt geweſen ſein?
Warum ſoll’s Ruprecht
juſt geweſen ſein.
Hat ſie das Licht dabei gehalten, was?
Die Jungfer, denk ich, wird es wiſſen
müſſen,:
Die Jungfer, denk ich, wird es
wiſſen müſſen,
Die Jungfer, denk ich,
wird es wiſſen müſſen:
Die Jungfer, denk’ ich,
wird es wiſſen muͤſſen:
Ich bin ein Schelm, wenn’s nicht der
Lebrecht war.
Frau Marthe
Wäar es der Lebrecht etwa? War’s der
Lebrecht?
Adam.
Sprich, Evchen, war’s
nicht Leberecht, mein Herzchen?
Sprich, Evchen, war’s
der Lebrecht nicht, mein Herzchen?
65.
Eve.
Er Unverſchämter, er! Er
Niederträcht’ger!
Wie kann er ſagen, daß es Lebrecht —
Walter.
Jungfer!
Was unterſteht ſie ſich? Iſt das mir
der
Reſpeckt, den d ſie
dem Richter ſchuldig iſt?
Eve.
Ei, was! Der Richter dort! Werth, ſelbſt
vor dem
Gericht, ein armer Sünder, dazuſtehn —
— Er, der wohl beſſer weiß, wer es
geweſen!
/: ſich zum Dorfrichter wendend
:/
W¿ —
Hat er den Lebrecht in die Stadt nicht geſtern
— Hat er den
Lebrecht in die Stadt nicht geſtern
Hat er den Lebrecht in
die Stadt nicht geſtern
Hat er den Lebrecht in
die Stadt nicht geſtern
Geſchickt nach Utrecht, vor die
Com̄iſſion,
Mit dem Atteſt, die die Rekruten
aushebt?
Wie kann er ſagen, daß es Lebrecht war,
Wenn er wohl weiß, daß der in Utrecht
iſt?
Adam
Nun, wer denn ſonſt?
Wenn’s Lebrecht nicht, zum Henker —
Nun wer denn ſonſt?
Wenn’s Lebrecht nicht, zum Henker —
Nicht Ruprecht iſt, nicht
Lebrecht iſt — — dWas
machſt du?
Ruprecht.
Mein Seel, Herr Richter
Adam, laßt euch ſagen,
Mein Seel’, Herr
Richter Adam, laßt euch ſagen,
Hierin mag doch die Jungfer juſt nicht
lügen.
Den Lebrecht hab’ ich
ſelbſt begegnet geſtern,
Dem Lebrecht bin ich
ſelbſt begegnet geſtern,
Als er nach Utrecht gieng, früh war’s Glock
ſechsacht,
Als er nach Utrecht gieng, früh
war’s Glock ſechs
Als er nach Utrecht
gieng, früh war’s Glock acht,
Als er nach Utrecht
ging, fruͤh war’s Glock acht,
Und wenn er auf ein Fuhrwerk ſich nicht
lud,
Hat ſich der Kerl,
krum̄beinig, wie er iſt,
Hat ſich der Kerl,
krumbeinig wie er iſt,
Glock zehn Uhr Nachts noch nicht zurück
gehaspelt.
Es kann ein Dritter wohl
geweſen ſein.
Adam.
Ach, was! Krum̄beinig! Schaafsgeſicht! Der
Kerl,
Ach, was! Krum̄beinig!
Schaafsgeſicht! Der Kerl,
Ach, was! Krum̄beinig!
Schaafsgeſicht! Der Kerl
Ach, was! Krumbeinig!
Schaafsgeſicht! Der Kerl
Geht ſeinen Stiefel, wie ein Anderer.
der, trotz Einem.
Geht ſeinen Stiefel, wie
ein Anderer.
Geht ſeinen Stiefel,
der, trotz Einem.
Geht ſeinen Stiefel,
der, trotz Einem.
Ich will von ungeſpaltnem Leibe ſein,
66.
Wenn nicht ein Schäferhund von mäß’ger
Größe
Muß ſeinen Trab gehn, mit ihm
fortzukom̄en.
Walter.
Erzähl den Hergang uns.
Eve.Kleist intendierte zunächst einen Halbvers
für Eve (1235+1) einzufügen, strich die
Ergänzung nach mehreren Korrekturen wieder und
setzte den schon gestrichenen zweiten
Halbvers 1235 ›Verzeihn, Ew Gnaden.‹ durch
Unterpunktierung wieder in Kraft, ergänzt um
einen
Gedankenstrich.
Frau Marthe!
Rull!
Unvernunft!
Frau Marthe
Rull!
Frau
Marthe!
Unvernunft!
Frau Marthe!
Unvernunft!
Die Unvernunft! —
Was das
für!
—!
Laß ſie die Jungfer doch gewähren!
Die Unvernunft!
— Laß ſie die Jungfer doch gewähren!
Was das für
—! Laß ſie die Jungfer doch gewähren!
Was das fuͤr —! Laß ſie
die Jungfer doch gewaͤhren!
Das Kind einſchrecken — Hure —
Schaafsgeſicht!
So wird’s uns nichts. Sie wird ſich ſchon
beſinnen.
Ruprecht.
O ja, beſinnen.
Adam.
Flaps dort,
ſchweig’ er jetzt.
Flaps dort, ſchweig er
jetzt.
62
Ruprecht.
Dier Flickſchuſter heißt
wird
ihr ſchon einfallen.
Der Flickſchuſter
heißt ihr ſchon einfallen.
Der Flickſchuſter
wird ihr ſchon einfallen.
Der Flickſchuſter wird
ihr ſchon einfallen.
Adam.
Der Satan! Ruft den Büttel! He!
Hanfriede!
Ruprecht.
Nun, nun! Ich ſchweig’, Herr Richter,
laßt’s nur ſein.
Sie wird
euch
Sie
wird euch ſchon auf meinen Namen
kom̄en.
Sie wird euch
ſchon auf meinen Namen kom̄en.
Sie wird euch ſchon auf meinen Namen
kom̄en.
Sie wird euch ſchon auf
meinen Nahmen kommen.
Frau Marthe.
Hör du, mach mir hier kein Spektakel, ſag’
ich.
Hör, neun und vierzig bin ich alt
geworden
In Ehren: funfzig mögt’ ich gern
erleben.
Den dritten Februar iſt
mein Geburtstag,
Den dritten Februar iſt
mein Geburtstag;
Heut iſt der erſte. Mach es kurz. Wer
war’s?
Adam.
Gut, meinethalben! Gut,
Frau Marthe, ſo!
Gut, meinethalben! Gut,
Frau Marthe Rull!
Frau Marthe.
Der Vater ſprach, als er verſchied,:
hHör’,BKA liest Korrektur in versales H nicht:
›verschied: hör‘,‹. Marthe,
Der Vater ſprach, als er
verſchied,
hör’, Marthe,
Der Vater ſprach, als
er verſchied:
Hör’, Marthe,
Der Vater ſprach, als
er verſchied: Hoͤr’, Marthe,
Dem Mädel ſchaff mir einen wackern
Mann;
Und wird ſie eine liederliche Metze,
So gieb dem Todtengräber einen
Groſchen,
Und laß mich wieder auf den Rücken
legen:
Mein Seel, ich glaub’, ich kehr’ im Grab mich um.
Mein Seel, ich glaub’, ich
kehr’ im Grab mich um.
Mein Seel, ich glaub’,
ich kehr’ mich um.
Mein Seel, ich glaub
ich kehr’ im Grab mich um.
Adam.
Nun! Das iſt auch nicht
übel.
Nun, das iſt auch
nicht uͤbel.
Frau Marthe
Willſt du Vater
Und Mutter jetzt, mein Evchen, nach dem
vierten
Gebot hochehren, gut, ſo
ſprich: in meine Kam̄er
Gebot hoch ehren, gut,
ſo ſprichIn E
folgt hinter dem ›sprich‹ kein Doppelpunkt wie in
H. Es wird in der Regel entsprechend emendiert
(BKA, Reclam/Hamacher). Ganz auszuschließen ist
eine Streichung des Doppelpunktes aus rhythmischen
Gründen allerdings nicht. in meine
Kammer
Ließ ich den Schuſter, oder einen
Dritten,
Hörſt du? Der Bräutgam
aber war es nicht.
Hoͤrſt du? Der
Braͤut’gam aber war es nicht.
Ruprecht.
Sie jam̄ert mich. Laßt doch den Krug, ich
bitt’ euch.
Ich will’n nach Utrecht
tragen. Solch’ ein Krug!
Ich will’n nach Utrecht
tragen. Solch’ ein Krug —.
Ich wollt’ ich hätt’ ihn nur entzwei
geſchlagen.
63.
Eve.
Unedelmüth’ger, du! Pfui, ſchäme dich,
Daß du nicht ſagſt, gut, ich zerſchlug den
Krug!
Pfui, Ruprecht, pfui, o ſchäme dich, daß
du
Mir nicht in meiner That vertrauen
kannſt.
Gab’ ich die Hand dir nicht, und ſagte,
ja,
Als du mich fragteſt, wirſt du treu mir ſein?
Eve, willſt du
mich?
Als du mich fragteſt,
wirſt du treu mir ſein?
Als du mich fragteſt,
Eve, willſt du mich?
Als du mich fragteſt,
Eve, willſt du mich?
Meinſt du, daß du den Flickſchuſter nicht
werth biſt?
Und hätteſt du durch’s Schlüſſelloch mich
mit
Dem Lebrecht aus dem Kruge trinken
ſehen,
Du hätteſt denken ſollen: Ev’ iſt brav,
Es wird ſich Alles ihr zum Ruhme löſen,
Und iſt’s im Leben nicht, ſo iſt es
jenſeits,
Und wenn wir auferſtehn iſt auch ein
Tag.
Ruprecht.
Mein Seel, das dauert mir zu lange,
Evchen.
Was ich mit Händen greife, glaub’ ich
gern.
Eve.
Geſetzt, es wär der Leberecht geweſen,
Warum — des Todes will ich ewig
ſterben,
Hätt’ ich’s dir Einzigem nicht gleich
vertraut;
Jedoch warum vor
Nachbarn, Knecht’ und Mägden,
Jedoch warum vor
Nachbarn, Knecht und Maͤgden —
Geſetzt, ich hätte
Gründ’, es zu verbergen,
Geſetzt, ich haͤtte
Grund, es zu verbergen,
Warum, o Ruprecht, ſprich, warum nicht
ſollt’ ich,
Auf dein Vertraun hin ſagen, daß du’s
warſt?
Warum nicht ſollt’ ich’s? Warum ſollt’
ich’s nicht?
Ruprecht.
Ei, ſo zum Henker, ſag’s, es iſt mir
Recht,
Wenn du die Fiedel dir erſparen kannſt.
Eve.
O du Abſcheulicher! Du Undankbarer!
64.
Werth, daß ich mir die Fiedel ſpare!
Werth,
Daß ich mit einem Wort zu Ehren mich,
Und dich in ewiges Verderben bringe.
Walter.
Nun —? Und dies einz’ge Wort —? Was ſoll man davon denken?!
Halt uns nicht auf.
Nun —? Und dies Wort —? Was
ſoll man davon denken?
Nun —? Und dies Wort —?
Was ſoll man davon
denken!
Nun —? Und dies
einz’ge Wort —? Halt uns nicht auf.
Nun —? Und dies einz’ge
Wort —? Halt uns nicht auf.
Der Ruprecht alſo war es nicht?
Eve.
Nein, gnäd’ger Herr, weil
er’s denn ſelbſt ſo will,
Nein gnaͤd’ger Herr,
weil ers denn ſelbſt ſo will,
Um ſeinetwillen nur verſchwieg ich es:
Den irdnen Krug zerſchlug der Ruprecht
nicht,
Wenn er’s euch ſelber läugnet, könnt ihr’s
glauben.
Frau Marthe
Eve! Der Ruprecht nicht?
Eve.
Nein, Mutter, nein!
Und wenn ich’s geſtern ſagte, war’s
gelogen.
Frau Marthe.
Hör, dir zerſchlag’ ich alle Knochen!
/: ſie ſetzt den Krug nieder
:/
Eve.
Thut, was ihr wollt.
Walter
/: drohend :/
Frau Marthe!
Adam.
He! Der Büttel! —
Schmeißt ſie heraus dort, die
verwünſchte Vettel!
Warum ſoll’s Ruprecht
juſt geweſen ſein?
Warum ſoll’s Ruprecht
juſt geweſen ſein.
Hat ſie das Licht dabei gehalten, was?
Die Jungfer, denk ich, wird es wiſſen
müſſen,:
Die Jungfer, denk ich, wird es
wiſſen müſſen,
Die Jungfer, denk ich,
wird es wiſſen müſſen:
Die Jungfer, denk’ ich,
wird es wiſſen muͤſſen:
Ich bin ein Schelm, wenn’s nicht der
Lebrecht war.
Frau Marthe
Wäar es der Lebrecht etwa? War’s der
Lebrecht?
Adam.
Sprich, Evchen, war’s
nicht Leberecht, mein Herzchen?
Sprich, Evchen, war’s
der Lebrecht nicht, mein Herzchen?
65.
Eve.
Er Unverſchämter, er! Er
Niederträcht’ger!
Wie kann er ſagen, daß es Lebrecht —
Walter.
Jungfer!
Was unterſteht ſie ſich? Iſt das mir
der
Reſpeckt, den d ſie
dem Richter ſchuldig iſt?
Eve.
Ei, was! Der Richter dort! Werth, ſelbſt
vor dem
Gericht, ein armer Sünder, dazuſtehn —
— Er, der wohl beſſer weiß, wer es
geweſen!
/: ſich zum Dorfrichter wendend
:/
W¿ —
Hat er den Lebrecht in die Stadt nicht geſtern
— Hat er den
Lebrecht in die Stadt nicht geſtern
Hat er den Lebrecht in
die Stadt nicht geſtern
Hat er den Lebrecht in
die Stadt nicht geſtern
Geſchickt nach Utrecht, vor die
Com̄iſſion,
Mit dem Atteſt, die die Rekruten
aushebt?
Wie kann er ſagen, daß es Lebrecht war,
Wenn er wohl weiß, daß der in Utrecht
iſt?
Adam
Nun, wer denn ſonſt?
Wenn’s Lebrecht nicht, zum Henker —
Nun wer denn ſonſt?
Wenn’s Lebrecht nicht, zum Henker —
Nicht Ruprecht iſt, nicht
Lebrecht iſt — — dWas
machſt du?
Ruprecht.
Mein Seel, Herr Richter
Adam, laßt euch ſagen,
Mein Seel’, Herr
Richter Adam, laßt euch ſagen,
Hierin mag doch die Jungfer juſt nicht
lügen.
Den Lebrecht hab’ ich
ſelbſt begegnet geſtern,
Dem Lebrecht bin ich
ſelbſt begegnet geſtern,
Als er nach Utrecht gieng, früh war’s Glock
ſechsacht,
Als er nach Utrecht gieng, früh
war’s Glock ſechs
Als er nach Utrecht
gieng, früh war’s Glock acht,
Als er nach Utrecht
ging, fruͤh war’s Glock acht,
Und wenn er auf ein Fuhrwerk ſich nicht
lud,
Hat ſich der Kerl,
krum̄beinig, wie er iſt,
Hat ſich der Kerl,
krumbeinig wie er iſt,
Glock zehn Uhr Nachts noch nicht zurück
gehaspelt.
Es kann ein Dritter wohl
geweſen ſein.
Adam.
Ach, was! Krum̄beinig! Schaafsgeſicht! Der
Kerl,
Ach, was! Krum̄beinig!
Schaafsgeſicht! Der Kerl,
Ach, was! Krum̄beinig!
Schaafsgeſicht! Der Kerl
Ach, was! Krumbeinig!
Schaafsgeſicht! Der Kerl
Geht ſeinen Stiefel, wie ein Anderer.
der, trotz Einem.
Geht ſeinen Stiefel, wie
ein Anderer.
Geht ſeinen Stiefel,
der, trotz Einem.
Geht ſeinen Stiefel,
der, trotz Einem.
Ich will von ungeſpaltnem Leibe ſein,
66.
Wenn nicht ein Schäferhund von mäß’ger
Größe
Muß ſeinen Trab gehn, mit ihm
fortzukom̄en.
Walter.
Erzähl den Hergang uns.
Eve.Kleist intendierte zunächst einen Halbvers
für Eve (1235+1) einzufügen, strich die
Ergänzung nach mehreren Korrekturen wieder und
setzte den schon gestrichenen zweiten
Halbvers 1235 ›Verzeihn, Ew Gnaden.‹ durch
Unterpunktierung wieder in Kraft, ergänzt um
einen
Gedankenstrich.
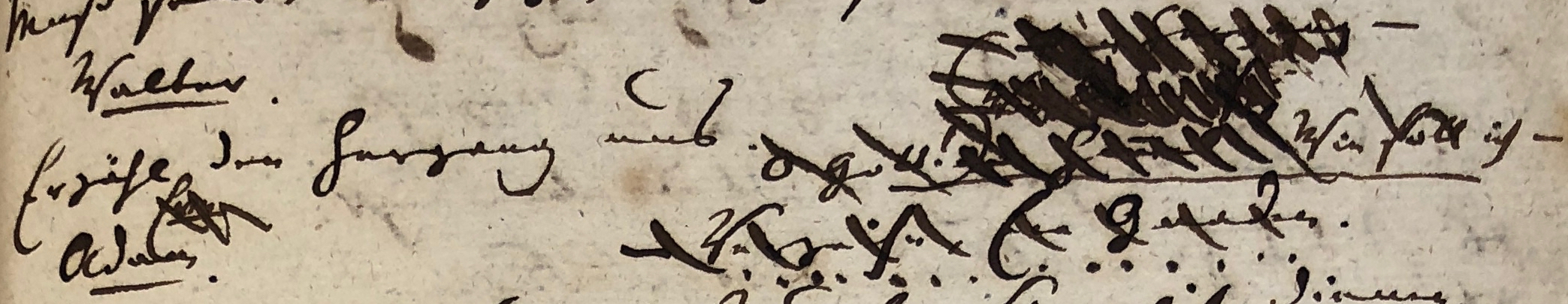 O Gott!
im Him̄el!
Wie kann ich?
Den Hergang —
Wie ſoll ich
—
O Gott im
Him̄el!
O Gott!
Wie kann ich?
O Gott! Den
Hergang —
O Gott! Wie ſoll
ich —
[ ]
[ ]
Adam.
—
Verzeihn, Ew Gnaden.
Verzeih’n Ew.
Gnaden!
— Hierauf wird
euch die Jungfer ſchwerlich dienen.
Walter.
Nicht dienen? Mir nicht dienen? Und warum
nicht?
Adam.
Ein twatſches Kind. Ihr ſeht’s. Gut, aber
twatſch.
Blutjung, gefirmelt kaum; das ſchämt ſich
noch,
Wenn’s einen Bart von Weitem ſieht. So’n
Volk,
Im Finſtern leiden ſie’s,
und wenn es Tag iſt,
Im Finſtern leiden
ſie’s, und wenn es Tag wird,
So läugnen ſie’s vor
ihren Richter ab.
So laͤugnen ſie’s vor
ihrem Richter ab.
Walter.
Ihr ſeid gar
ſeltſam
ſehr
nachſichtsvoll, Herr Richter,
Adam,
Ihr ſeid gar
ſeltſam nachſichtsvoll, Herr
Richter,
Ihr ſeid
ſehr nachſichtsvoll, Herr Richter
Adam,
Ihr ſeid ſehr
nachſichtsvoll, Herr Richter Adam,
Gar
Sehr
mild in Allem, was die Jungfer angeht.
Gar mild in
Allem, was die Jungfer angeht.
Sehr
mild in Allem, was die Jungfer angeht.
Sehr mild, in allem,
was die Jungfer angeht.
Adam.
Die Wahrheit euch zu ſagen, Herr
Gerichtsrath,
Ihr Vater war ¿¿
ein guter
Freund von mir.
Wollen Ew. Gnaden heute huldreich ſein,
O Gott!
im Him̄el!
Wie kann ich?
Den Hergang —
Wie ſoll ich
—
O Gott im
Him̄el!
O Gott!
Wie kann ich?
O Gott! Den
Hergang —
O Gott! Wie ſoll
ich —
[ ]
[ ]
Adam.
—
Verzeihn, Ew Gnaden.
Verzeih’n Ew.
Gnaden!
— Hierauf wird
euch die Jungfer ſchwerlich dienen.
Walter.
Nicht dienen? Mir nicht dienen? Und warum
nicht?
Adam.
Ein twatſches Kind. Ihr ſeht’s. Gut, aber
twatſch.
Blutjung, gefirmelt kaum; das ſchämt ſich
noch,
Wenn’s einen Bart von Weitem ſieht. So’n
Volk,
Im Finſtern leiden ſie’s,
und wenn es Tag iſt,
Im Finſtern leiden
ſie’s, und wenn es Tag wird,
So läugnen ſie’s vor
ihren Richter ab.
So laͤugnen ſie’s vor
ihrem Richter ab.
Walter.
Ihr ſeid gar
ſeltſam
ſehr
nachſichtsvoll, Herr Richter,
Adam,
Ihr ſeid gar
ſeltſam nachſichtsvoll, Herr
Richter,
Ihr ſeid
ſehr nachſichtsvoll, Herr Richter
Adam,
Ihr ſeid ſehr
nachſichtsvoll, Herr Richter Adam,
Gar
Sehr
mild in Allem, was die Jungfer angeht.
Gar mild in
Allem, was die Jungfer angeht.
Sehr
mild in Allem, was die Jungfer angeht.
Sehr mild, in allem,
was die Jungfer angeht.
Adam.
Die Wahrheit euch zu ſagen, Herr
Gerichtsrath,
Ihr Vater war ¿¿
ein guter
Freund von mir.
Wollen Ew. Gnaden heute huldreich ſein,
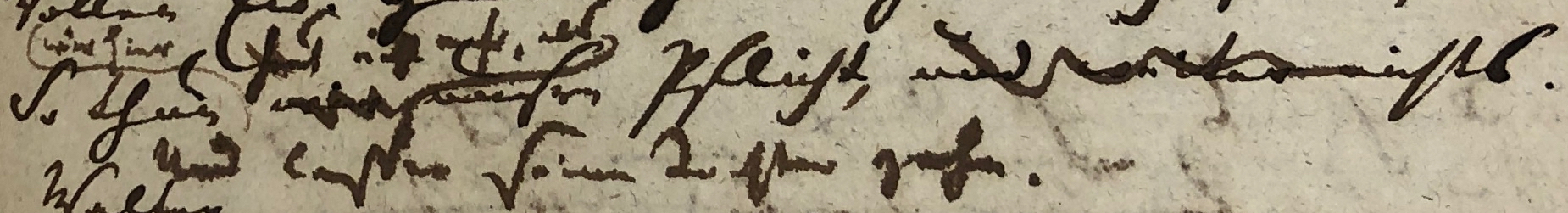 So thun wir
wir
hier
heut nicht mehr, als unſre
Pflicht, und weiter nichts.
So thun wir unſre Pflicht,
und weiter nichts.
So thun wir
heut nicht mehr, als unſre
Pflicht,
So thun wir
hier nicht mehr, als unſre Pflicht,
So thun wir hier nicht
mehr, als unſre Pflicht,
Und laſſen ſeine Tochter
gehn.
[ ]
Und laſſen ſeine
Tochter gehn.
Und laſſen ſeine
Tochter gehn.
Walter.
Ich aber ſpüre
große Luſt in mir, Herr Richter,
Ich aber ſpüre große
Luſt in mir, Herr Richter,
Ich ſpüre große Luſt
in mir, Herr Richter,
Ich ſpuͤre große Luſt
in mir, Herr Richter,
Der Sache völlig auf den Grund zu kom̄en.
—
So thun wir
wir
hier
heut nicht mehr, als unſre
Pflicht, und weiter nichts.
So thun wir unſre Pflicht,
und weiter nichts.
So thun wir
heut nicht mehr, als unſre
Pflicht,
So thun wir
hier nicht mehr, als unſre Pflicht,
So thun wir hier nicht
mehr, als unſre Pflicht,
Und laſſen ſeine Tochter
gehn.
[ ]
Und laſſen ſeine
Tochter gehn.
Und laſſen ſeine
Tochter gehn.
Walter.
Ich aber ſpüre
große Luſt in mir, Herr Richter,
Ich aber ſpüre große
Luſt in mir, Herr Richter,
Ich ſpüre große Luſt
in mir, Herr Richter,
Ich ſpuͤre große Luſt
in mir, Herr Richter,
Der Sache völlig auf den Grund zu kom̄en.
—
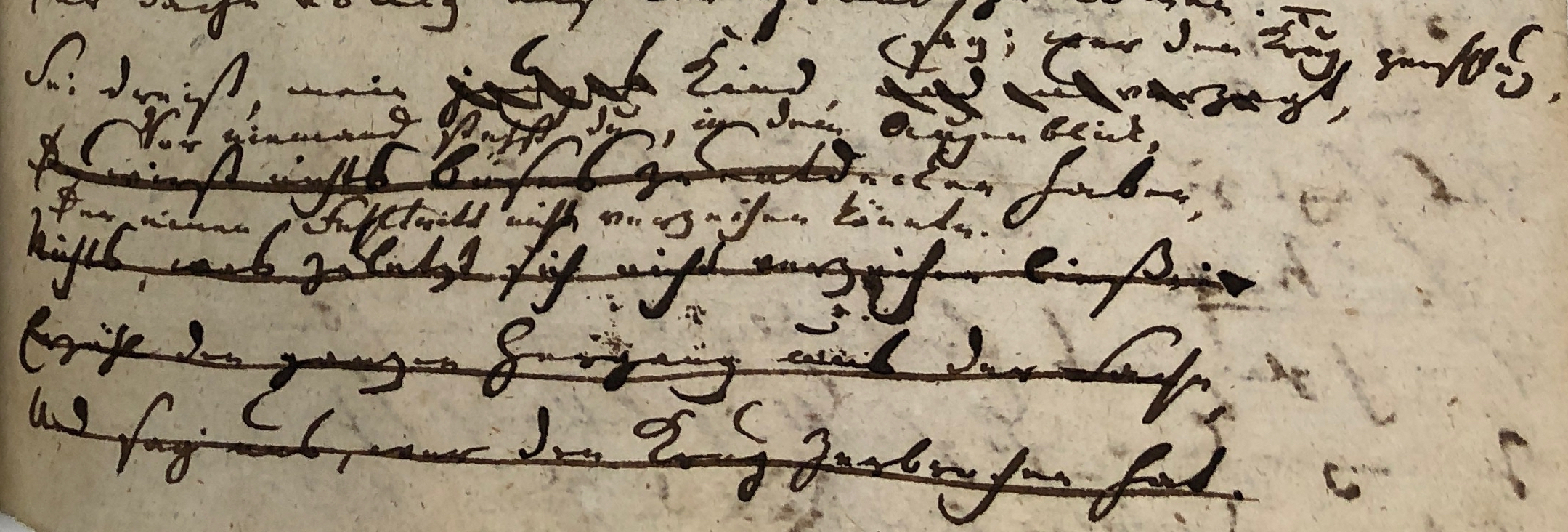 Sei dreiſt, mein junges Kind, und
unverzagt,
ſag’, wer den Krug
zerſchlug.
Sei dreiſt, mein
junges Kind, und
unverzagt,
Sei dreiſt, mein
Kind, ſag’, wer den Krug zerſchlug.
Sei dreiſt, mein Kind;
ſag, wer den Krug zerſchlagen.
Du wirſt nichts Böſes
zu entdecken haben,Vor
niemand ſtehſt du, in dem Augenblick,
Du wirſt nichts Böſes
zu entdecken haben,
Vor niemand
ſtehſt du, in dem Augenblick,
Vor niemand ſtehſt du,
in dem Augenblick,
Nichts, was zuletzt
ſich nicht verzeihen ließe:Der einen Fehltritt nicht
verzeihen könnte.
Nichts, was zuletzt
ſich nicht verzeihen ließe:
Der einen
Fehltritt nicht verzeihen könnte.
Der einen Fehltritt
nicht verzeihen koͤnnte.
Erzähl den ganzen
Hergang uns der Sache,
Erzähl den ganzen
Hergang uns der Sache,
[ ]
[ ]
Und ſag’ uns, wer
den Krug zerbrochen hat.
Und ſag’ uns, wer
den Krug zerbrochen hat.
[ ]
[ ]
66/67
Eve.
Mein lieber, würdiger,
und gnäd’ger Herr,
Mein lieber, wuͤrdiger
und gnaͤd’ger Herr,
Erlaßt mir, euch den Hergang zu
erzählen.
Von dieſer Weig’rung denkt uneben
nicht.
Es iſt des Him̄els wunderbare Fügung,
Die mir den Mund in dieſer Sache
ſchließt.
Daß Ruprecht jenen Krug
nicht traf, will ich,
Daß Ruprecht jenen Krug
nicht traf, will ich
Mit einem Eid, wenn ihr’s verläangt,
Auf heiligem Altar bekräfftigen.
Jedoch die geſtrige Begebenheit,
Mit jedem andern Zuge, iſt mein eigen,
Und nicht das ganze Garnſtück kann die
Mutter,
Um eines einz’gen Fadens willen,
fordern,
Der, ihr gehörig, durch’s Gewebe läuft.
Sei dreiſt, mein junges Kind, und
unverzagt,
ſag’, wer den Krug
zerſchlug.
Sei dreiſt, mein
junges Kind, und
unverzagt,
Sei dreiſt, mein
Kind, ſag’, wer den Krug zerſchlug.
Sei dreiſt, mein Kind;
ſag, wer den Krug zerſchlagen.
Du wirſt nichts Böſes
zu entdecken haben,Vor
niemand ſtehſt du, in dem Augenblick,
Du wirſt nichts Böſes
zu entdecken haben,
Vor niemand
ſtehſt du, in dem Augenblick,
Vor niemand ſtehſt du,
in dem Augenblick,
Nichts, was zuletzt
ſich nicht verzeihen ließe:Der einen Fehltritt nicht
verzeihen könnte.
Nichts, was zuletzt
ſich nicht verzeihen ließe:
Der einen
Fehltritt nicht verzeihen könnte.
Der einen Fehltritt
nicht verzeihen koͤnnte.
Erzähl den ganzen
Hergang uns der Sache,
Erzähl den ganzen
Hergang uns der Sache,
[ ]
[ ]
Und ſag’ uns, wer
den Krug zerbrochen hat.
Und ſag’ uns, wer
den Krug zerbrochen hat.
[ ]
[ ]
66/67
Eve.
Mein lieber, würdiger,
und gnäd’ger Herr,
Mein lieber, wuͤrdiger
und gnaͤd’ger Herr,
Erlaßt mir, euch den Hergang zu
erzählen.
Von dieſer Weig’rung denkt uneben
nicht.
Es iſt des Him̄els wunderbare Fügung,
Die mir den Mund in dieſer Sache
ſchließt.
Daß Ruprecht jenen Krug
nicht traf, will ich,
Daß Ruprecht jenen Krug
nicht traf, will ich
Mit einem Eid, wenn ihr’s verläangt,
Auf heiligem Altar bekräfftigen.
Jedoch die geſtrige Begebenheit,
Mit jedem andern Zuge, iſt mein eigen,
Und nicht das ganze Garnſtück kann die
Mutter,
Um eines einz’gen Fadens willen,
fordern,
Der, ihr gehörig, durch’s Gewebe läuft.
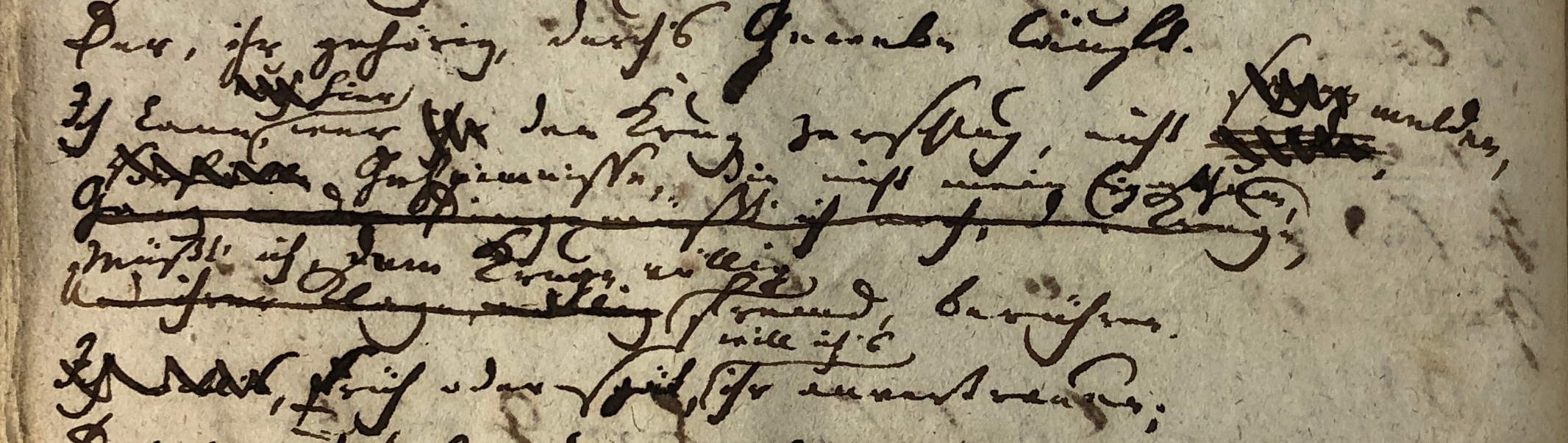 Ich kann euch
hier, wer ihr den Krug
zerſchlug, nicht melden,
ſagen,
melden,
Ich kann, wer
ihr den Krug zerſchlug, nicht
melden,
Ich kann euch
hierDie
Ergänzung ›euch hier‹ ist nicht getrennt,
sondern zusammen eingefügt worden, da
andernfalls die beide Worte umschließende
Einfügeklammer keinen Sinn ergibt. Für diesen
Befund sprechen auch Schriftmerkmale wie
Stricheigenschaften und die gemeinsame
Grundlinie. Aus metrischen Gründen hat Kleist
›euch‹ später wieder gestrichen.,
wer den Krug zerſchlug, nicht
ſagen,
Ich kann hier, wer
den Krug zerſchlug, nicht melden,
Ich kann hier, wer den
Krug zerſchlug, nicht melden,
Ganz andre Dinge müßt’
ich noch, dem Kruge,Vorfälle Geheimniſſe, die nicht mein
Eigenthum,
Ganz andre Dinge müßt’
ich noch, dem Kruge,
Vorfälle
Geheimniſſe, die
nicht mein Eigenthum,
Geheimniſſe, die nicht
mein Eigenthum,
Und ihrer Klage,
völlig
Müßt’ ich, dem Kruge
völlig fremd, berühren.
Und ihrer Klage,
völlig fremd, berühren.
Müßt’ ich,
dem Kruge völlig fremd, berühren.
Muͤßt’ ich, dem Kruge
voͤllig fremd, beruͤhren.
Ich will’s,
fFrüh oder ſpät, will ich’s
ihr anvertrauen;
Ich will’s,
früh oder ſpät, ihr anvertrauen;
Früh
oder ſpät, will ich’s ihr anvertrauen;
Fruͤh oder ſpaͤt, will
ich’s ihr anvertrauen,
Doch hier das Tribunal iſt nicht der
Ort.
Doch hier das Tribunal
iſt nicht der Ort,
Wo ſie das Recht hat,
mich danach zu fragen.
Wo ſie das Recht hat,
mich darnach zu fragen.
Adam.
Nein. Rechtens nicht. Auf meine Ehre
nicht.
Ich kann euch
hier, wer ihr den Krug
zerſchlug, nicht melden,
ſagen,
melden,
Ich kann, wer
ihr den Krug zerſchlug, nicht
melden,
Ich kann euch
hierDie
Ergänzung ›euch hier‹ ist nicht getrennt,
sondern zusammen eingefügt worden, da
andernfalls die beide Worte umschließende
Einfügeklammer keinen Sinn ergibt. Für diesen
Befund sprechen auch Schriftmerkmale wie
Stricheigenschaften und die gemeinsame
Grundlinie. Aus metrischen Gründen hat Kleist
›euch‹ später wieder gestrichen.,
wer den Krug zerſchlug, nicht
ſagen,
Ich kann hier, wer
den Krug zerſchlug, nicht melden,
Ich kann hier, wer den
Krug zerſchlug, nicht melden,
Ganz andre Dinge müßt’
ich noch, dem Kruge,Vorfälle Geheimniſſe, die nicht mein
Eigenthum,
Ganz andre Dinge müßt’
ich noch, dem Kruge,
Vorfälle
Geheimniſſe, die
nicht mein Eigenthum,
Geheimniſſe, die nicht
mein Eigenthum,
Und ihrer Klage,
völlig
Müßt’ ich, dem Kruge
völlig fremd, berühren.
Und ihrer Klage,
völlig fremd, berühren.
Müßt’ ich,
dem Kruge völlig fremd, berühren.
Muͤßt’ ich, dem Kruge
voͤllig fremd, beruͤhren.
Ich will’s,
fFrüh oder ſpät, will ich’s
ihr anvertrauen;
Ich will’s,
früh oder ſpät, ihr anvertrauen;
Früh
oder ſpät, will ich’s ihr anvertrauen;
Fruͤh oder ſpaͤt, will
ich’s ihr anvertrauen,
Doch hier das Tribunal iſt nicht der
Ort.
Doch hier das Tribunal
iſt nicht der Ort,
Wo ſie das Recht hat,
mich danach zu fragen.
Wo ſie das Recht hat,
mich darnach zu fragen.
Adam.
Nein. Rechtens nicht. Auf meine Ehre
nicht.
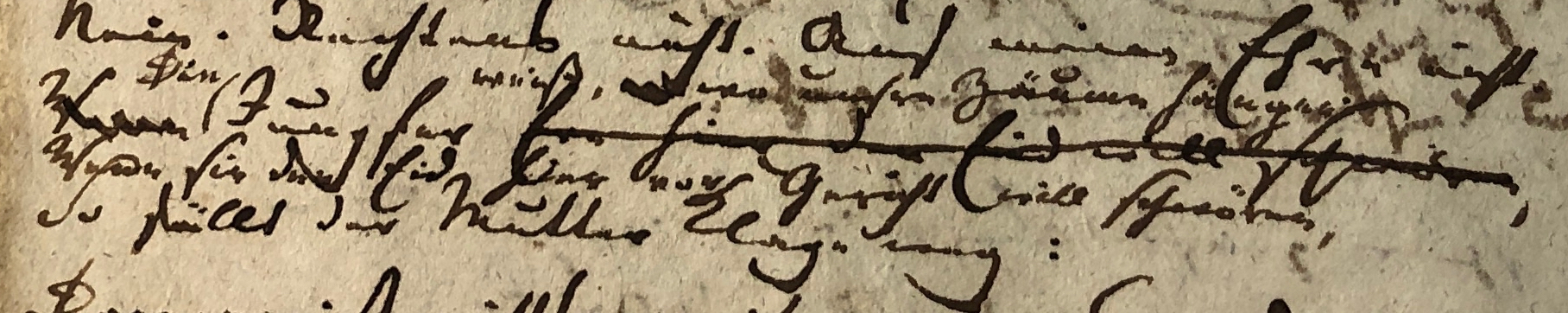 Wenn
Die
Jungfer Eve hier den Eid will
ſchwören,
weiß, w
wo unſre Zäume hängen.
Wenn Jungfer
Eve hier den Eid will ſchwören,
Die
Jungfer weiß, wo unſre Zäume hängen.
Die Jungfer weiß, wo
unſre Zaͤume haͤngen.
Wenn ſie den Eid hier vor
Gericht will ſchwören.
[ ]
Wenn ſie den
Eid hier vor Gericht will ſchwören.
Wenn ſie den Eid hier
vor Gericht will ſchwoͤren,
So fällt der Mutter Klage weg:
Dagegen iſt nichts weiter einzuwenden.
Frau Walter.
Was ſagt zu der Erklärung
ſie, Frau Marthe.
Was ſagt zu der
Erklaͤrung ſie, Frau Marthe?
Frau Marthe.
Wenn ich gleich was Erkleckliches nicht
aufbring’,
Geſtrenger Herr, ſo glaubt, ich bitt’ euch
ſehr,
Daß mir der Schlag bloß jetzt
hier
jetzt die Zunge lähmte.
Daß mir der Schlag bloß
jetzt die Zunge lähmte.
Daß mir der Schlag bloß
hier die Zunge lähmte.
Daß mir der Schlag
bloß jetzt die Zunge lähmte.
Daß mir der Schlag bloß
jetzt die Zunge laͤhmte.
68.
Wenn
Die
Jungfer Eve hier den Eid will
ſchwören,
weiß, w
wo unſre Zäume hängen.
Wenn Jungfer
Eve hier den Eid will ſchwören,
Die
Jungfer weiß, wo unſre Zäume hängen.
Die Jungfer weiß, wo
unſre Zaͤume haͤngen.
Wenn ſie den Eid hier vor
Gericht will ſchwören.
[ ]
Wenn ſie den
Eid hier vor Gericht will ſchwören.
Wenn ſie den Eid hier
vor Gericht will ſchwoͤren,
So fällt der Mutter Klage weg:
Dagegen iſt nichts weiter einzuwenden.
Frau Walter.
Was ſagt zu der Erklärung
ſie, Frau Marthe.
Was ſagt zu der
Erklaͤrung ſie, Frau Marthe?
Frau Marthe.
Wenn ich gleich was Erkleckliches nicht
aufbring’,
Geſtrenger Herr, ſo glaubt, ich bitt’ euch
ſehr,
Daß mir der Schlag bloß jetzt
hier
jetzt die Zunge lähmte.
Daß mir der Schlag bloß
jetzt die Zunge lähmte.
Daß mir der Schlag bloß
hier die Zunge lähmte.
Daß mir der Schlag
bloß jetzt die Zunge lähmte.
Daß mir der Schlag bloß
jetzt die Zunge laͤhmte.
68.
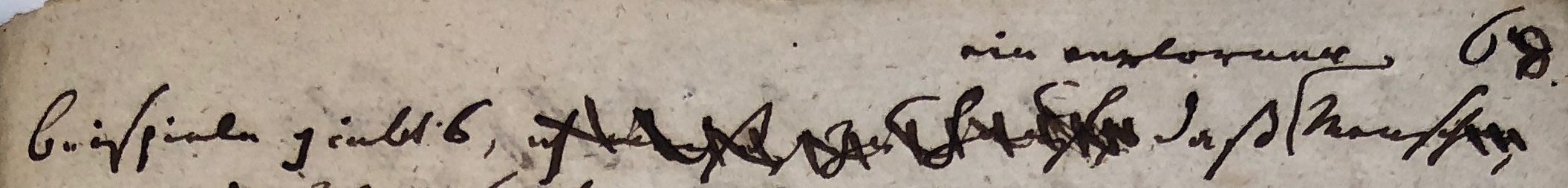 Beiſpiele giebt’s, ich
weiß, zu Hauf, daß ein
verlorner Menſchen,
Beiſpiele giebt’s, ich
weiß, zu Hauf, daß Menſchen,
Beiſpiele giebt’s,
daß ein verlorner Menſch,
Beiſpiele giebts, daß
ein verlohrner Menſch,
Um vor der Welt zu Ehren ſich zu
bringen,
Beiſpiele giebt’s, ich
weiß, zu Hauf, daß ein
verlorner Menſchen,
Beiſpiele giebt’s, ich
weiß, zu Hauf, daß Menſchen,
Beiſpiele giebt’s,
daß ein verlorner Menſch,
Beiſpiele giebts, daß
ein verlohrner Menſch,
Um vor der Welt zu Ehren ſich zu
bringen,
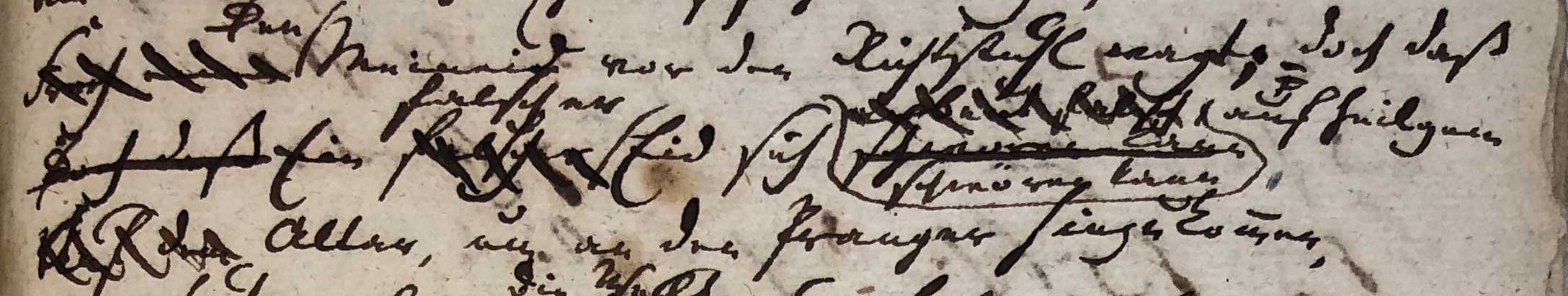 Frech einen
Den
Meineid vor den Richtſtuhl wagent;
;
doch daß
Frech einen
Meineid vor den Richtſtuhl wagen;
Den Meineid vor
den Richtſtuhl wagt;
doch daß
Den Meineid vor dem
Richterſtuhle wagt; doch daß
Doch daß
eEin falſcher
falſcher Eid ſich ſchwören
kann
erbeut
falſch,ſchwören kann auf
heilgem
Doch daß ein falſcher Eid
ſich ſchwören kann
Doch daß
ein Eid ſich eerbeut falſch, auf
heilgem
Ein falſcher Eid
ſich ſchwören kann, auf heilgem
Ein falſcher Eid ſich
ſchwoͤren kann, auf heil’gem
Auf dem
Altar, um an den Pranger hinzukom̄en,
Auf dem Altar,
um an den Pranger hinzukom̄en,
Altar, um an den
Pranger hinzukom̄en,
Altar, um an den
Pranger hinzukommen,
Frech einen
Den
Meineid vor den Richtſtuhl wagent;
;
doch daß
Frech einen
Meineid vor den Richtſtuhl wagen;
Den Meineid vor
den Richtſtuhl wagt;
doch daß
Den Meineid vor dem
Richterſtuhle wagt; doch daß
Doch daß
eEin falſcher
falſcher Eid ſich ſchwören
kann
erbeut
falſch,ſchwören kann auf
heilgem
Doch daß ein falſcher Eid
ſich ſchwören kann
Doch daß
ein Eid ſich eerbeut falſch, auf
heilgem
Ein falſcher Eid
ſich ſchwören kann, auf heilgem
Ein falſcher Eid ſich
ſchwoͤren kann, auf heil’gem
Auf dem
Altar, um an den Pranger hinzukom̄en,
Auf dem Altar,
um an den Pranger hinzukom̄en,
Altar, um an den
Pranger hinzukom̄en,
Altar, um an den
Pranger hinzukommen,
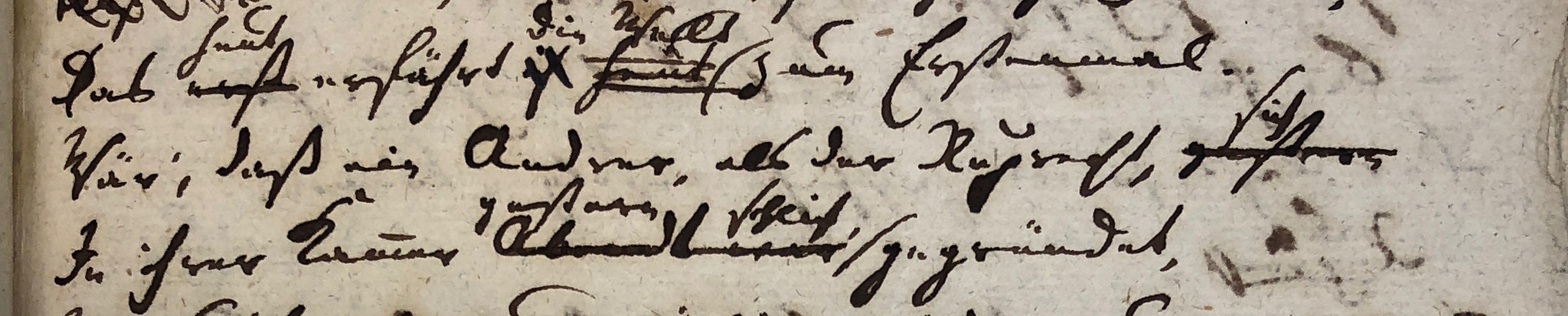 Das erſt
heut
erfaähret
ich
die
Welt
heut zum Erſtenmal.
Das erſt
erfahre
ich heut zum Erſtenmal.
Das erstMöglicherweise hat Kleist bereits in der
Variante b das ›erst‹ gestrichen, was nicht
endgültig entscheidbar ist. Da die Schriftmerkmale
(Stricheigenschaften, Schriftlage) dafür sprechen,
dass die Ergänzungen ›heut‹ und ›die Welt‹ im
gleichen Zuge geschrieben wurden, ist auch nicht
auszuschließen, dass Kleist direkt in Variante c
korrigiert hat, Variante b würde entsprechend
entfallen. erfährt
heut die Welt zum Erſtenmal.
Das
heut erfährt die Welt zum
Erſtenmal.
Das heut erfaͤhrt die
Welt zum erſtenmal.
Wär’, daß ein Andrer, als der Ruprecht,
geſtern
ſich
Wär’, daß ein Andrer, als
der Ruprecht, geſtern
Wär’, daß ein
Andrer, als der Ruprecht, ſich
Waͤr’, daß ein Andrer,
als der Ruprecht ſich
In ihrer Kam̄er Abends
war,Komma unter
Einfügemarke verdeckt. BKA liest ohne
Komma.
geſtern ſchlich,
gegründet,
In ihrer Kam̄er Abends
war, gegründet,
In ihrerKleist
übersieht bei seiner Korrektur der Verse 1289f die
Änderung von ›ihrer‹ in ›ihre‹. In E entsprechend
korrigiert. Kam̄er geſtern
ſchlich, gegründet,
In ihre Kammer geſtern
ſchlich, gegruͤndet,
Wär’s überall nur möglich, gnäd’ger
Herr,
Verſteht mich wohl, — ſo ſäumt
ich hier nicht länger.
Verſteht mich wohl, ſo
ſäumt ich hier nicht länger.
Verſteht mich
wohl, — ſo ſäumt ich hier nicht länger.
Verſteht mich wohl, —
ſo ſaͤumt ich hier nicht laͤnger.
Den Stuhl ſetzt’ ich, zur erſten
Einrichtung,
Ihr vor die Thür’, und ſagte, geh, mein
Kind,
Die Welt iſt weit, da zahlſt du keine
Miethe,
Und lange Haare erbteſt
du von mir,
haſt du auch geerbt,
Und lange Haare
erbteſt du von mir,
Und lange Haare
haſt du auch geerbt,
Und lange Haare haſt du
auch geerbt,
Woran du dich, kom̄t Zeit, kom̄t Rath,
kannſt hängen.
Walter.
Ruhig, ruhig, Frau Marthe.
Frau Marthe.
Da ich jedoch
Hier den Beweis noch anders führen
kann,
Als bloß durch ſie, die dieſen dDienſt mir weigert,
Und überzeugt bin völlig, daß nur er
Mir, und kein Anderer, den Krug
zerſchlug,
So bringt die Luſt, es
kurzhin abzuſchwören,ſchwören,
So bringt die Luſt, es
kurz hin abzuſchwoͤren,
Mich jetzt auf einen
ſchändlichen Verdacht.
Mich noch auf einen
ſchaͤndlichen Verdacht.
E Die Nacht von
geſtern birgt ein anderes
Verbrechen noch, als bloß die Krugzerſtörverwüſtung.
Verbrechen noch, als bloß die
Krugzerſtör
Verbrechen noch, als
bloß die Krugverwüſtung.
Verbrechen noch, als
bloß die Krugverwuͤſtung.
Ich muß euch ſagen, gnäd’ger Herr, daß
Ruprecht
Zur Conſcription gehört, in wenig Tagen
Soll er den Eid zur Fahn’ in Utrecht
ſchwören.
Die jungen Landesſöhne reißen aus.
69.
Geſetzt, er hätte geſtern Nacht geſagt:
Was meinſt du, Evchen?
Kom̄. Die Welt iſt groß,
Was meinſt du, Evchen?
Komm. Die Welt iſt groß.
Zu Kiſt’ und Kaſten haſt du ja die
Schlüſſel —
Und ſie, ſie hätt’ ein wenig ſich
geſperrt:
So hätte ohngefähr, da ich ſie ſtörte,
— Bei ihm aus Rach’, aus Liebe noch bei ihr
—
Der Reſt, ſo wie geſchehn, erfolgen
können.
Ruprecht.
Das Rabenaas! Was das für Reden ſind!
Zu Kiſt’ und Kaſten —
Walter.
Still!
Eve.
Er, austreten!
Walter.
Zur Sache hier. Vom Krug iſt hier die Rede.
—
Das erſt
heut
erfaähret
ich
die
Welt
heut zum Erſtenmal.
Das erſt
erfahre
ich heut zum Erſtenmal.
Das erstMöglicherweise hat Kleist bereits in der
Variante b das ›erst‹ gestrichen, was nicht
endgültig entscheidbar ist. Da die Schriftmerkmale
(Stricheigenschaften, Schriftlage) dafür sprechen,
dass die Ergänzungen ›heut‹ und ›die Welt‹ im
gleichen Zuge geschrieben wurden, ist auch nicht
auszuschließen, dass Kleist direkt in Variante c
korrigiert hat, Variante b würde entsprechend
entfallen. erfährt
heut die Welt zum Erſtenmal.
Das
heut erfährt die Welt zum
Erſtenmal.
Das heut erfaͤhrt die
Welt zum erſtenmal.
Wär’, daß ein Andrer, als der Ruprecht,
geſtern
ſich
Wär’, daß ein Andrer, als
der Ruprecht, geſtern
Wär’, daß ein
Andrer, als der Ruprecht, ſich
Waͤr’, daß ein Andrer,
als der Ruprecht ſich
In ihrer Kam̄er Abends
war,Komma unter
Einfügemarke verdeckt. BKA liest ohne
Komma.
geſtern ſchlich,
gegründet,
In ihrer Kam̄er Abends
war, gegründet,
In ihrerKleist
übersieht bei seiner Korrektur der Verse 1289f die
Änderung von ›ihrer‹ in ›ihre‹. In E entsprechend
korrigiert. Kam̄er geſtern
ſchlich, gegründet,
In ihre Kammer geſtern
ſchlich, gegruͤndet,
Wär’s überall nur möglich, gnäd’ger
Herr,
Verſteht mich wohl, — ſo ſäumt
ich hier nicht länger.
Verſteht mich wohl, ſo
ſäumt ich hier nicht länger.
Verſteht mich
wohl, — ſo ſäumt ich hier nicht länger.
Verſteht mich wohl, —
ſo ſaͤumt ich hier nicht laͤnger.
Den Stuhl ſetzt’ ich, zur erſten
Einrichtung,
Ihr vor die Thür’, und ſagte, geh, mein
Kind,
Die Welt iſt weit, da zahlſt du keine
Miethe,
Und lange Haare erbteſt
du von mir,
haſt du auch geerbt,
Und lange Haare
erbteſt du von mir,
Und lange Haare
haſt du auch geerbt,
Und lange Haare haſt du
auch geerbt,
Woran du dich, kom̄t Zeit, kom̄t Rath,
kannſt hängen.
Walter.
Ruhig, ruhig, Frau Marthe.
Frau Marthe.
Da ich jedoch
Hier den Beweis noch anders führen
kann,
Als bloß durch ſie, die dieſen dDienſt mir weigert,
Und überzeugt bin völlig, daß nur er
Mir, und kein Anderer, den Krug
zerſchlug,
So bringt die Luſt, es
kurzhin abzuſchwören,ſchwören,
So bringt die Luſt, es
kurz hin abzuſchwoͤren,
Mich jetzt auf einen
ſchändlichen Verdacht.
Mich noch auf einen
ſchaͤndlichen Verdacht.
E Die Nacht von
geſtern birgt ein anderes
Verbrechen noch, als bloß die Krugzerſtörverwüſtung.
Verbrechen noch, als bloß die
Krugzerſtör
Verbrechen noch, als
bloß die Krugverwüſtung.
Verbrechen noch, als
bloß die Krugverwuͤſtung.
Ich muß euch ſagen, gnäd’ger Herr, daß
Ruprecht
Zur Conſcription gehört, in wenig Tagen
Soll er den Eid zur Fahn’ in Utrecht
ſchwören.
Die jungen Landesſöhne reißen aus.
69.
Geſetzt, er hätte geſtern Nacht geſagt:
Was meinſt du, Evchen?
Kom̄. Die Welt iſt groß,
Was meinſt du, Evchen?
Komm. Die Welt iſt groß.
Zu Kiſt’ und Kaſten haſt du ja die
Schlüſſel —
Und ſie, ſie hätt’ ein wenig ſich
geſperrt:
So hätte ohngefähr, da ich ſie ſtörte,
— Bei ihm aus Rach’, aus Liebe noch bei ihr
—
Der Reſt, ſo wie geſchehn, erfolgen
können.
Ruprecht.
Das Rabenaas! Was das für Reden ſind!
Zu Kiſt’ und Kaſten —
Walter.
Still!
Eve.
Er, austreten!
Walter.
Zur Sache hier. Vom Krug iſt hier die Rede.
—
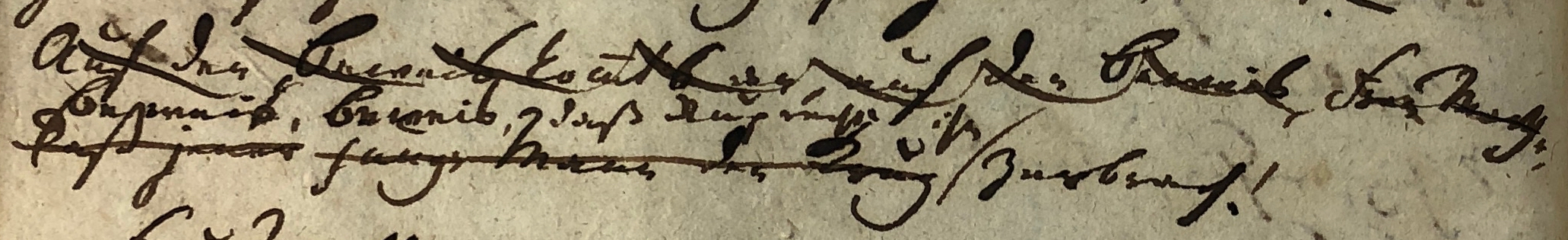 Auf den Beweis
kom̄t’s an, auf den Beweis, Frau Marthe,
Auf den Beweis
kom̄t’s an, auf den Beweis, Frau Marthe,
[ ]
[ ]
Daß jener junge Mann
den Krug
Beweiſs, Beweis, daß
Ruprecht ihn zerbrach!
Daß jener junge Mann
den Krug zerbrach!
Beweis, Beweis, daß Ruprecht ihn
zerbrach!
Beweis, Beweis, daß
Ruprecht ihn zerbrach!
Frau Marthe
Gut, gnäd’ger Herr. Erſt will ich hier
beweiſen,
Daß Ruprecht mir den Krug zerſchlug,
Und dann will ich im Hauſe unterſuchen.
—
Auf den Beweis
kom̄t’s an, auf den Beweis, Frau Marthe,
Auf den Beweis
kom̄t’s an, auf den Beweis, Frau Marthe,
[ ]
[ ]
Daß jener junge Mann
den Krug
Beweiſs, Beweis, daß
Ruprecht ihn zerbrach!
Daß jener junge Mann
den Krug zerbrach!
Beweis, Beweis, daß Ruprecht ihn
zerbrach!
Beweis, Beweis, daß
Ruprecht ihn zerbrach!
Frau Marthe
Gut, gnäd’ger Herr. Erſt will ich hier
beweiſen,
Daß Ruprecht mir den Krug zerſchlug,
Und dann will ich im Hauſe unterſuchen.
—
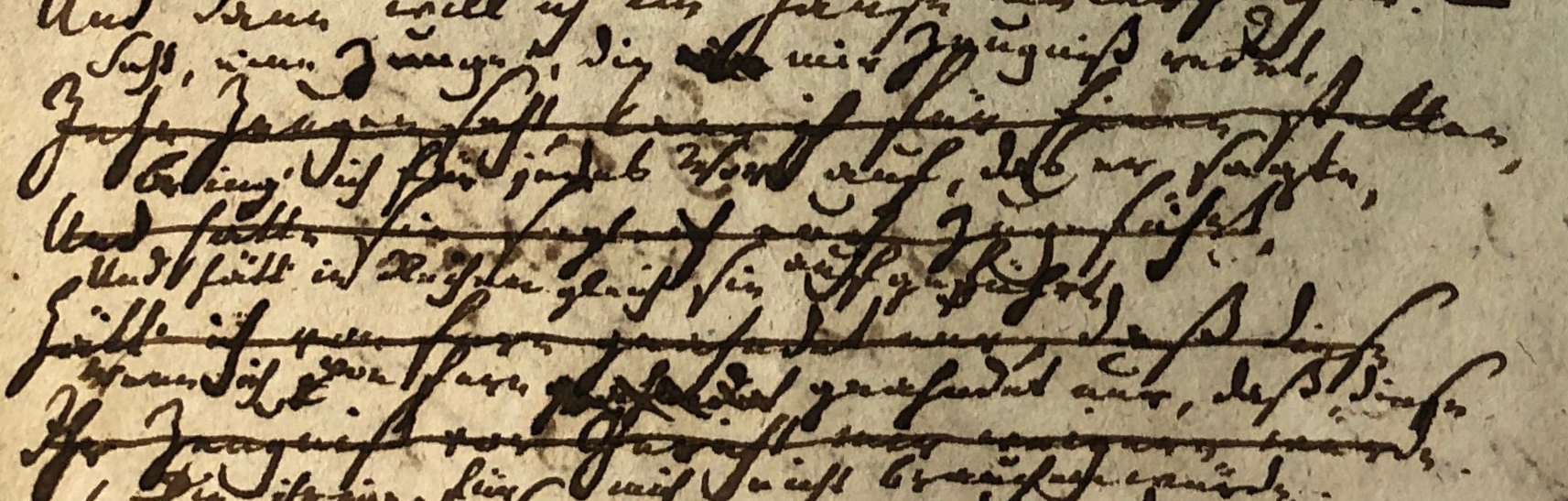 Zehn
Zeugen
liest ›Zeugen,‹
liest ›Zeugen,‹
ſeht, kann ich für Einen ſtellen,
Seht, eine Zunge, die mir mir Zeugniß
redet,
Zehn Zeugen ſeht, kann
ich für Einen ſtellen,
Seht, eine
Zunge, die mir Zeugniß redet,
Seht eine Zunge, die
mir Zeugniß redet,
Und hätte ſie ſogleich
euch zugeführt,
Bring’ ich für jedes Wort
auf, das er ſagte,
Und hätte ſie ſogleich
euch zugeführt,
Bring’ ich
für jedes Wort auf, das er ſagte,
Bring’ ich fuͤr jedes
Wort auf, das er ſagte,
Hätt’ ich von fern
geahndet nur, daß dieſe
Und hätt’ in Reihen gleich
ſie aufgeführt,
Hätt’ ich von fern
geahndet nur, daß dieſe
Und hätt’ in
Reihen gleich ſie aufgeführt,
Und haͤtt’ in Reihen
gleich ſie aufgefuͤhrt,
Ihr Zeugniß vor Gericht
mir weigern würde.
Wenn ich g von fern geahndet
geahndet nur, daß dieſe
Ihr Zeugniß vor
Gericht mir weigern würde.
Wenn ich von
fern geahndet nur, daß dieſe
Wenn ich von fern
geahndet nur, daß dieſe
Zehn
Zeugen
liest ›Zeugen,‹
liest ›Zeugen,‹
ſeht, kann ich für Einen ſtellen,
Seht, eine Zunge, die mir mir Zeugniß
redet,
Zehn Zeugen ſeht, kann
ich für Einen ſtellen,
Seht, eine
Zunge, die mir Zeugniß redet,
Seht eine Zunge, die
mir Zeugniß redet,
Und hätte ſie ſogleich
euch zugeführt,
Bring’ ich für jedes Wort
auf, das er ſagte,
Und hätte ſie ſogleich
euch zugeführt,
Bring’ ich
für jedes Wort auf, das er ſagte,
Bring’ ich fuͤr jedes
Wort auf, das er ſagte,
Hätt’ ich von fern
geahndet nur, daß dieſe
Und hätt’ in Reihen gleich
ſie aufgeführt,
Hätt’ ich von fern
geahndet nur, daß dieſe
Und hätt’ in
Reihen gleich ſie aufgeführt,
Und haͤtt’ in Reihen
gleich ſie aufgefuͤhrt,
Ihr Zeugniß vor Gericht
mir weigern würde.
Wenn ich g von fern geahndet
geahndet nur, daß dieſe
Ihr Zeugniß vor
Gericht mir weigern würde.
Wenn ich von
fern geahndet nur, daß dieſe
Wenn ich von fern
geahndet nur, daß dieſe
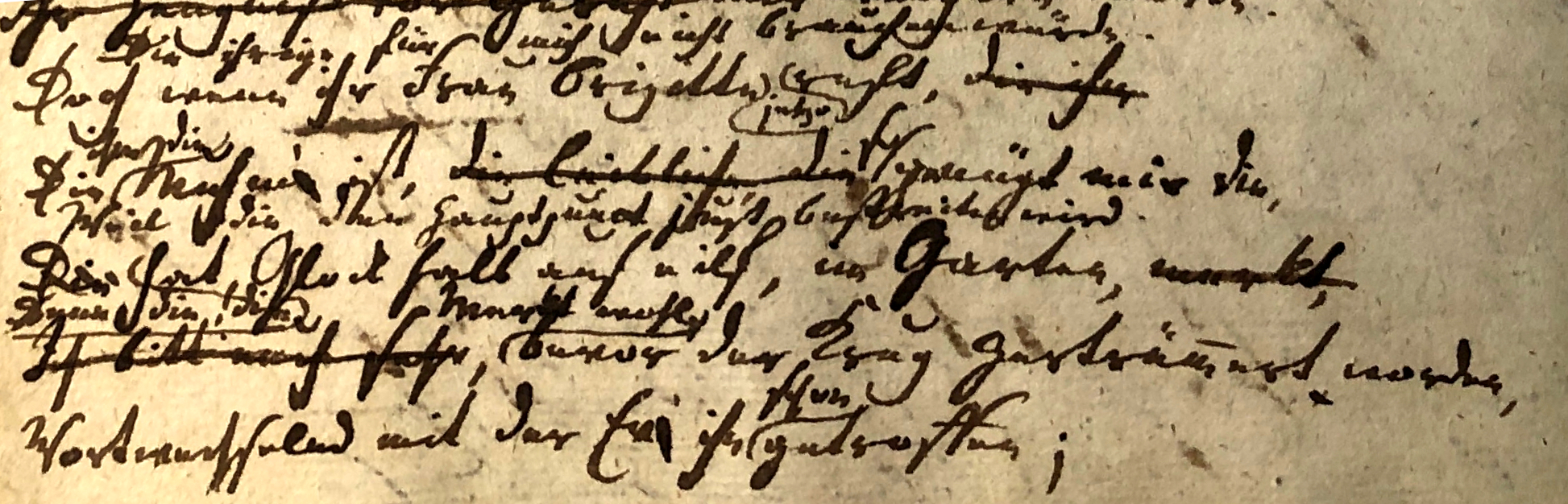 Die
ihrige für mich nicht brauchen würde.
[ ]
Die ihrige
für mich nicht brauchen würde.
Die ihrige fuͤr mich
nicht brauchen wuͤrde.
Doch wenn ihr Frau Brigitte jetzo
ruft, die ihm
Doch wenn ihr Frau Brigitte
ruft, die ihm
Doch wenn ihr Frau
Brigitte jetzo ruft,
Doch wenn ihr Frau
Brigitte jetzo ruft,
Die ihm die Muhme’ iſt, die
leibliche, die
ſo
genügt mir
die,
Die Muhme ist,
die leibliche, die gnügt
Die ihm
die Muhm’ iſt, ſo
genügt mir die,
Die ihm die Muhm’ iſt,
ſo genuͤgt mir die,
Weil die den
Hauptpunct juſt beſtreiten wird.
[ ]
Weil die den
Hauptpunct juſt beſtreiten wird.
Weil die den Hauptpunkt
juſt beſtreiten wird.
Die
Denn die, die hat,
Glock halb auf eilf, im Garten, merkt,
Die hat, Glock
halb auf eilf, im Garten, merkt,
Denn die,
die hat, Glock halb auf eilf, im Garten,
Denn die, die hat Glock
halb auf eilf im Garten,
Ich bitt’ euch ſehr,
Merkt wohl, bevor der Krug
zertrüm̄ert,
worden,
Ich bitt’ euch
ſehr, bevor der Krug zertrüm̄ert,
Merkt
wohl, bevor der Krug zertrüm̄ert
worden,
Merkt wohl, bevor der
Krug zertruͤmmert worden,
Wortwechſelnd mit der Eve’ ihn ſchon getroffen;
Wortwechſelnd mit der
Eve ihn getroffen;
Wortwechſelnd mit
der Ev’ ihn ſchon getroffen;
Wortwechſelnd mit der
Ev’ ihn ſchon getroffen;
70.
Die
ihrige für mich nicht brauchen würde.
[ ]
Die ihrige
für mich nicht brauchen würde.
Die ihrige fuͤr mich
nicht brauchen wuͤrde.
Doch wenn ihr Frau Brigitte jetzo
ruft, die ihm
Doch wenn ihr Frau Brigitte
ruft, die ihm
Doch wenn ihr Frau
Brigitte jetzo ruft,
Doch wenn ihr Frau
Brigitte jetzo ruft,
Die ihm die Muhme’ iſt, die
leibliche, die
ſo
genügt mir
die,
Die Muhme ist,
die leibliche, die gnügt
Die ihm
die Muhm’ iſt, ſo
genügt mir die,
Die ihm die Muhm’ iſt,
ſo genuͤgt mir die,
Weil die den
Hauptpunct juſt beſtreiten wird.
[ ]
Weil die den
Hauptpunct juſt beſtreiten wird.
Weil die den Hauptpunkt
juſt beſtreiten wird.
Die
Denn die, die hat,
Glock halb auf eilf, im Garten, merkt,
Die hat, Glock
halb auf eilf, im Garten, merkt,
Denn die,
die hat, Glock halb auf eilf, im Garten,
Denn die, die hat Glock
halb auf eilf im Garten,
Ich bitt’ euch ſehr,
Merkt wohl, bevor der Krug
zertrüm̄ert,
worden,
Ich bitt’ euch
ſehr, bevor der Krug zertrüm̄ert,
Merkt
wohl, bevor der Krug zertrüm̄ert
worden,
Merkt wohl, bevor der
Krug zertruͤmmert worden,
Wortwechſelnd mit der Eve’ ihn ſchon getroffen;
Wortwechſelnd mit der
Eve ihn getroffen;
Wortwechſelnd mit
der Ev’ ihn ſchon getroffen;
Wortwechſelnd mit der
Ev’ ihn ſchon getroffen;
70.
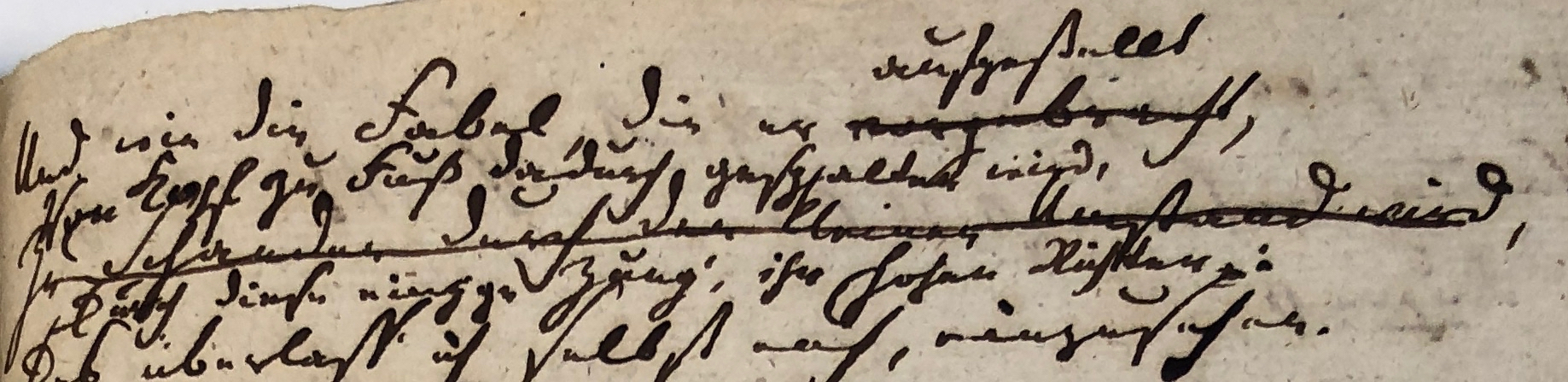 Und wie die Fabel, die er
vorgebracht
aufgeſtellt,
Und wie die Fabel, die er
vorgebracht,
Und wie die Fabel,
die er aufgeſtellt,
Und wie die Fabel, die
er aufgeſtellt,
Zu Schanden durch den
kleinen Umſtand wird,
Von Kopf zu Fuß dadurch
geſpalten wird,
Zu Schanden durch den
kleinen Umſtand wird,
Von Kopf zu
Fuß dadurch geſpalten wird,
Vom Kopf zu Fuß dadurch
geſpalten wird,
Durch dieſe
einz’ge Zung’, ihr hohen Richter,:
[ ]
Durch dieſe einz’ge Zung’,
ihr hohen Richter,
Durch dieſe
einz’ge Zung’, ihr hohen Richter:
Durch dieſe einz’ge
Zung’, ihr hohen Richter,
Das überlaſſ’ ich ſelbſt
euch, einzuſehen.
Das uͤberlaß’ ich
ſelbſt euch einzuſehn.
Ruprecht.
Wer hat mich —?
Veit.
Schweſter Briggÿ?
Ruprecht.
Mich? Mit Eve’?
—?
Im Garten?
Mich? Mit Eve
—?
Mich? Mit
Ev’? Im Garten?
Mich mit Ev’? Im
Garten?
Und wie die Fabel, die er
vorgebracht
aufgeſtellt,
Und wie die Fabel, die er
vorgebracht,
Und wie die Fabel,
die er aufgeſtellt,
Und wie die Fabel, die
er aufgeſtellt,
Zu Schanden durch den
kleinen Umſtand wird,
Von Kopf zu Fuß dadurch
geſpalten wird,
Zu Schanden durch den
kleinen Umſtand wird,
Von Kopf zu
Fuß dadurch geſpalten wird,
Vom Kopf zu Fuß dadurch
geſpalten wird,
Durch dieſe
einz’ge Zung’, ihr hohen Richter,:
[ ]
Durch dieſe einz’ge Zung’,
ihr hohen Richter,
Durch dieſe
einz’ge Zung’, ihr hohen Richter:
Durch dieſe einz’ge
Zung’, ihr hohen Richter,
Das überlaſſ’ ich ſelbſt
euch, einzuſehen.
Das uͤberlaß’ ich
ſelbſt euch einzuſehn.
Ruprecht.
Wer hat mich —?
Veit.
Schweſter Briggÿ?
Ruprecht.
Mich? Mit Eve’?
—?
Im Garten?
Mich? Mit Eve
—?
Mich? Mit
Ev’? Im Garten?
Mich mit Ev’? Im
Garten?
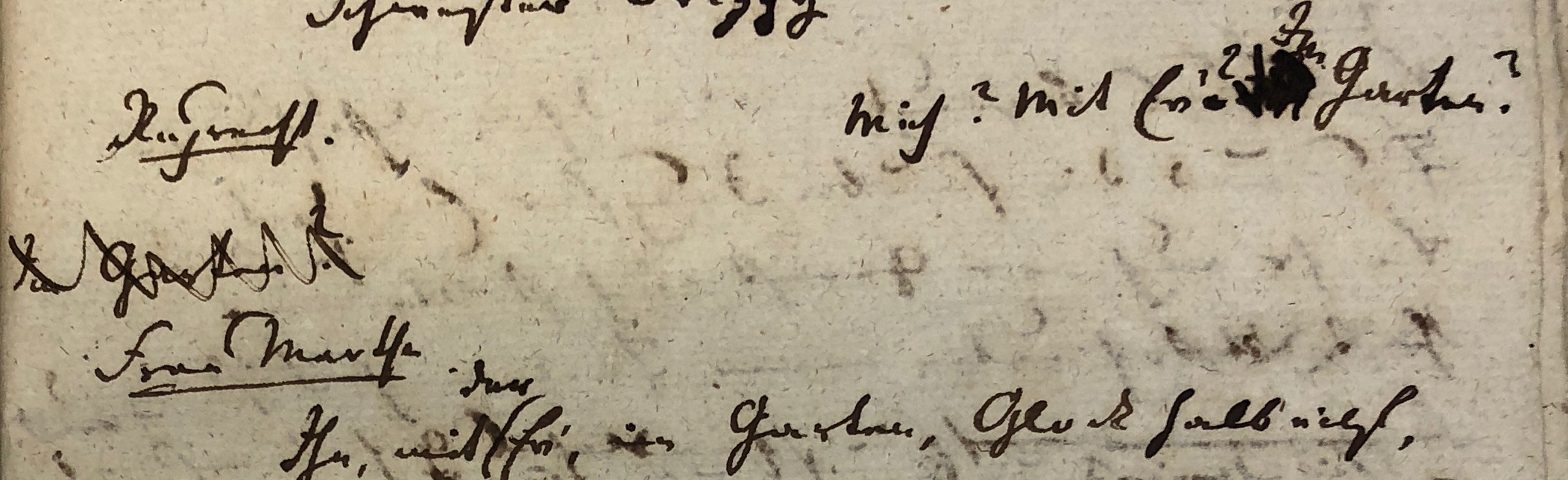 Im
Garten?In der ursprünglichen
Fassung bildete ›Im Garten?‹ den Eingangshalbvers
von Vers 1341. In der Korrektur hat Kleist diese
Worte dann dem vorhergehenden Vers 1340
zugeschlagen und in Vers 1341 ›mit Ev’‹ aus
metrischen Gründen ergänzt zu ›mit der
Ev’‹.
Im Garten?
[ ]
[ ]
Frau Marthe.
Im
Garten?In der ursprünglichen
Fassung bildete ›Im Garten?‹ den Eingangshalbvers
von Vers 1341. In der Korrektur hat Kleist diese
Worte dann dem vorhergehenden Vers 1340
zugeschlagen und in Vers 1341 ›mit Ev’‹ aus
metrischen Gründen ergänzt zu ›mit der
Ev’‹.
Im Garten?
[ ]
[ ]
Frau Marthe.
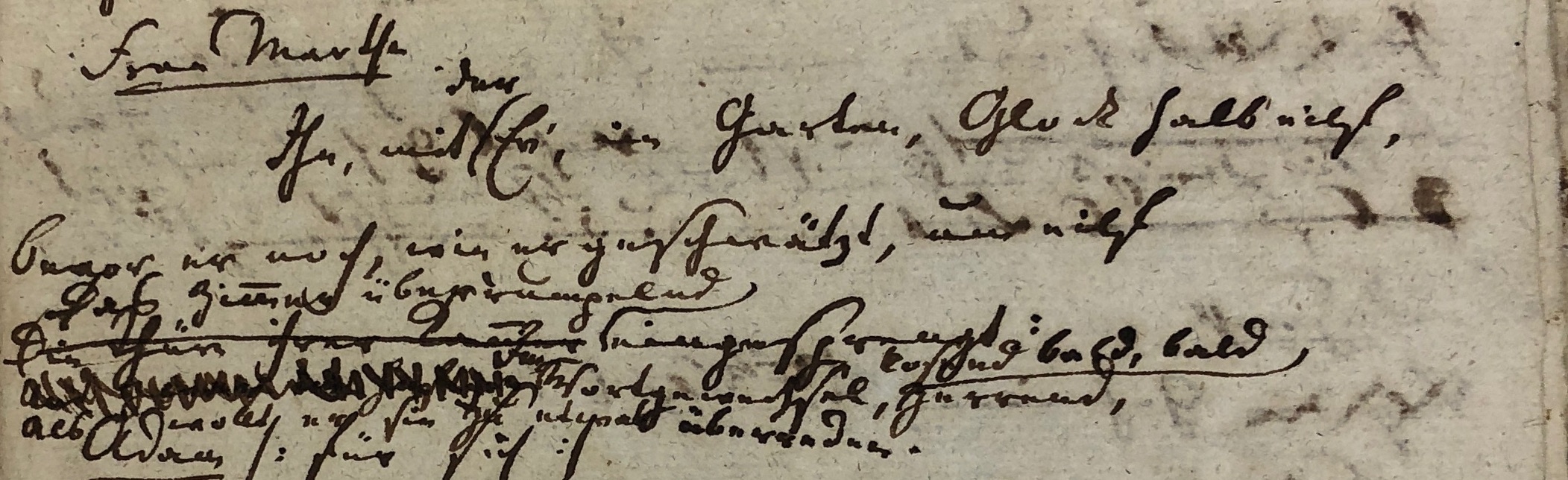 Ihn mit der Ev’, im Garten, Glock
halb’ eilf,
Ihn mit Ev’, im Garten,
Glock halb’ eilf,
Ihn mit
der Ev’, im Garten, Glock halb’
eilf,
Ihn mit der Ev’, im
Garten, Glock halb eilf,
Bevor er noch, wie er geſchwätzt, um
eilf
Die Thüre ihre Kam̄er
Das Zim̄er überrumpelnd
eingeſprengt.:
Die Thüre ihrer
Kam̄er eingeſprengt.
Das Zim̄er
überrumpelnd eingeſprengt:
Das Zimmer
uͤberrumpelnd eingeſprengt:
Und zwar im heft’gen
Im
Wortgewechſel ,
koſend bald, bald
zerrend,
[ ]
Und zwar im
heft’gen Wortgewechſel zerrend,
Im
Wortgewechſel,
koſend bald, bald zerrend,
Im Wortgewechſel,
koſend bald, bald zerrend,
Als wollt er ſie zu etwas
überreden.
[ ]
Als wollt er
ſie zu etwas überreden.
Als wollt’ er ſie zu
etwas uͤberreden.
Adam
/: für ſich :/
Verflucht! Der Teufel iſt mir gut.
Walter.
Schafft dieſe Frau herbei.
Ruprecht.
Ihr Herrn, ich
bitt euch.
Ihr Herrn, ich bitt’
euch:
Das iſt kein wahres Wort.
Das ist nicht möglich.
Das iſt kein wahres
Wort, das iſt nicht moͤglich.
Adam.
O wart, Hallunke! — He! Der Büttel!
Hanfried! —
Denn auf der Flucht
zerſchlagen ſich die Krüge —
[ ]
Denn auf der
Flucht zerſchlagen ſich die Krüge —
Denn auf der Flucht
zerſchlagen ſich die Kruͤge —
— Herr Schreiber, geht, ſchafft Frau
Brigitt’ herbei!
Veit.
Hör, du verfluchter Schlingel, du, was
machſt du?
Dir brech’ ich alle Knochen
noch.
Dir brech ich alle
Knochen noch.
Ruprecht.
Weshalb auch?
Veit.
Warum verſchwiegſt du, daß du mit der
Dirne
71.
Glock halb auf eilf im Garten ſchon
ſcharwenzt?
Warum verſchwiegſt du’s?
Ruprecht.
Warum ich’s verſchwieg?
Gott’s Schlag und Donner!, weil’s nicht wahr iſt, Vater.
Gott’s Schlag und
Donner! weil’s nicht wahr iſt,
Vater.
Gott’s Schlag und
Donner, weil’s nicht wahr iſt,
Vater.
Gott’s Schlag und
Donner, weil’s nicht wahr iſt, Vater!
Wenn das die Muhme Briggÿ zeugt, ſo hängt
mich;.
Und bei den
Beinen ſie meinthalben
obenein dazu.
Und ſie meinthalben
obenein dazu.
Und bei den
Beinen ſie meinthalb dazu.
Und bei den Beinen ſie
meinthalb dazu.
Veit.
Wenn
aber ſie’s bezeugt — nim̄
dich in Acht,!
ſag’ ich!
Wenn ſie’s bezeugt — nim̄ dich in
Acht,
ſag’ ich!
Wenn
aber ſie’s bezeugt — nim̄ dich in
Acht!
Wenn aber ſie’s
bezeugt — nimm dich in Acht!
Du und die ſaubre Jungfer
Eve dort,
Du und die ſaub’re
Jungfer Eve dort,
Wie ihr auch vor Gericht euch ſtellent,
mögt,ihr ſteckt
Wie ihr auch vor Gericht
euch ſtellen
mögt,
Wie ihr auch vor
Gericht euch ſtellt,
ihr ſteckt
Wie ihr auch vor
Gericht euch ſtellt, ihr ſteckt
Ihr ſteckt
dDoch unter einer Decke noch.
S’ iſt irgend
Ihr ſteckt
doch unter einer Decke noch.
Doch
unter einer Decke noch. S’ iſt irgend
Doch unter einer Decke
noch. S’ iſt irgend
S’ iſt irgend
noch
eEin schändliches Geheimniß
noch, von dem
S’ iſt irgend
noch
ein ſchändliches Geheimniß
Ein
ſchändliches Geheimniß noch, von dem
Ein ſchaͤndliches
Geheimniß noch, von dem
Das ſie aus Liebe nur
zu dir verſchweigt.
Sie weiß, und nur aus
Schonung hier nichts ſagt.
Das ſie aus Liebe nur
zu dir verſchweigt.
Sie weiß, und
nur aus Schonung hier nichts ſagt.
Sie weiß, und nur aus
Schonung hier nichts ſagt.
Ruprecht.
Welch ein Geheimniß?!
Welches?
Welch ein
Geheimniß?
Geheimniß!
Welches?
Geheimniß!
Welches?
Veit.
Warum haſt du geſtern eingepackt?
Warum haſt du
geſtern eingepackt?
Warum haſt du
eingepackt?
Warum haſt du
eingepackt?
He? Warum haſt Du geſtern Abend
eingepackt?
Ruprecht.
Die Sachen?
Veit.
Röcke, Hoſen, ja, und Wäſche;
Ein Bündel, wie’s ein Reiſender juſt
auf
Die Schulter wirft?
Die Schultern wirft?
Ruprecht.
Weil ich nach Utrecht ſoll!
Weil ich zum Regiment ſoll! Him̄el,-Donner —!
Weil ich zum Regiment ſoll!
Him̄el, Donner —!
Weil ich zum Regiment
ſoll! Him̄el-Donner —!
Weil ich zum Regiment
ſoll! Himmel⸗Donner —!
Glaubt er, daß ich —?
Veit.
Nach Utrecht? Ja, nach
Utrecht!
Du haſt geeilt, nach Utrecht
hinzukom̄en!
Vorgeſtern wußteſt du noch nicht, ob du
Den fünften oder ſechſten Tag wirſt
reiſen.
72.
Walter.
Weiß er zur Sache was zu melden, Vater?
Veit.
— Geſtrenger Herr, ich will noch nichts
behaupten.
Ich war daheim, als ſich der Krug
zerſchlug,
Und auch von einer andern Unternehmung
Hab’ ich, die Wahrheit zu geſtehn, noch
nichts,
Wenn ich jedweden Umſtand wohl erwäge,
Das meinen Sohn verdächtig macht,
bemerkt.
Von ſeiner Unſchuld völlig überzeugt,
Kam ich hierher, nach
abgemachtem Streit
Kam ich hieher, nach
abgemachtem Streit
Sein ehelich Verlöbniß aufzuzlöſen,
Und ihm das Silberkettlein
einzufordern,
Zuſamt dem Schaupfennig, den er der
Jungfer
Bei dem Verlöbniß vorgen Herbſt
verehrt.
Wenn jetzt von Flucht was, und
Verrätherei
An meinem grauen Haar zu Tage komt,
So iſt mir das ſo neu, ihr Herrn, als
euch:
Doch dann der Teufel ſoll den Hals ihm
brechen.
Walter.
Schafft Frau Brigitt’ herbei, Herr Richter
Adam.
Adam.
— Wird Ew. Gnaden dieſe Sache nicht
Ermüden? Sie zieht ſich in die Länge.
Ew. Gnaden haben meine Caſſen noch,
Und die Regiſtratur — Was iſt die
Glocke?
Licht.
Es ſchlug ſo eben halb.
Adam.
Auf eilf!
73.
Licht.
Verzeiht! Auf
zwölfe.
Verzeiht, auf
zwoͤlfe.
Walter.
Gleichviel.
Adam.
Ich glaub’, die Zeit iſt, oder ihr
verrückt.
/: er ſieht nach der Uhr :/
Ich bin kein ehrlicher Mann. — Ja, was
befehlt ihr?
Walter.
Ich bin der Meinung —
Adam.
Abzuſchließen?
Gut —
Abzuſchließen? Gut
—!
Walter.
Erlaubt! Ich bin der Meinung,
fortzufahren.
Adam
Ihr ſeid der Meinung — Auch gut. Sonſt
würd’ ich
Auf Ehre, morgen früh, Glock neun, die
Sache,
Zu euerer Zufriedenheit beend’gen.
Walter.
Ihr wißt um meinen Willen.
Adam.
Wie ihr befehlt.
Herr Schreiber, ſchickt
die Büttel ab, ſie ſollen
Herr Schreiber, ſchickt
die Buͤttel ab; ſie ſollen
Sogleich in’s Amt die
Frau Brigitte laden.
Sogleich ins Amt die
Frau Brigitte laden.
Walter.
Und nehmt euch — Zeit, die mir viel werth,
zu ſparen —
Gefälligſt ſelbſt der Sach’ ein wenig
an.
Licht
/: ab :/
Adam.
/: aufſtehend
:/In E Beginn ›Zehnter
Auftritt‹.
Inzwiſchen könnte man, wenn’s ſo
gefällig,
Vom Sitze ſich ein wenig lüften —?
74.
Walter.
Hm! O ja.
Was ich ſagen wollte’ —
Was ich ſagen
wollte —
Was ich ſagen
wollt’ —
Was ich ſagen wollt’
—
Adam
Erlaubt ihr gleichfalls,
Daß die Parthei’n, bis Frau Brigitt’
erscheint —?
Walter
Was? Die Parthei’n?
Adam.
Ja, vor die Thür, wenn ihr —
Walter
/: für ſich :/
Verwünſcht!
/: laut :/
Herr Richter Adam, wißt ihr
was?
Gebt ein Glas Wein mir in der
Zwiſchenzeit.
Adam.
Von ganzen Herzen gern.
He! Margarethe!
Von ganzem Herzen gern.
He! Margarethe!
Ihr macht mich glücklich, gnäd’ger Herr. —
Margrethe!
Die Magd
/: trit auf :/
Die Magd.
Hier.
Adam.
Was befehlt ihr? — Tretet ab, ihr
Leute.
Franz? — Auf dem Vorſaal draußen. — Oder
Rhein?
Walter
Von unſerm Rhein.
Adam.
Gut. — Bis ich rufe. Marſch!
Walter
Wohin?
Adam.
Geh. Vom
Verſiegelten, Margrethe. —
Geh, vom Verſiegelten,
Margrethe. —
Was? Auf den Flur bloß
draußen. Hier die Schlüssel.Kleist
hat ›Schlüſſel.‹ bis in den Falz ausgeschrieben, dann
gestrichen und aus Gründen der Lesbarkeit unter der
Zeile neu geschrieben. BKA liest unter der Streichung
nur ›Schlüſſ.‹.
Schlüssel.
Was? Auf den Flur bloß
draußen. — Hier. — Der Schluͤſſel.
75.
Walter.
Hm! Bleibt.
Adam.
Fort! Marſch, ſag’ ich! — Geh,
Margarethe,!
Und Butter, friſchgeſtampft, Käſ’ auch aus
Limburg,
Und von der fetten pom̄erſchen Räuchergans.
Walter.
Halt! Einen Augenblick! Macht nicht ſo
viel
Umſtänd’, ich bitt’ euch ſehr,
Herr Richter.
Umſtaͤnd’ ich bitt euch
ſehr, Herr Richter.
Adam.
Schert
Zum Teufel euch, ſag’ ich! Thu, wie ich
sagte.
Walter.
Schickt ihr die Leute fort, Herr Richter?
Adam.
Ew. Gnaden?
Walter.
Ob ihr —?
Adam.
Sie treten ab, wenn ihr
erlaubt.
Bloß ab, bis Frau Brigitt’ erſcheint.
Wie, oder ſoll’s nicht etwa —?
Walter.
Hm! Wie ihr wollt.
Doch ob’s der Mühe ſich verlohnen wird?
Meint ihr, daß es ſo lange Zeit wird
währen,
Bis man im Ort ſie trifft?
Adam.
S’ ist heute Holztag,
Gestrenger Herr. Die Weiber
größtentheils
Sind in den Fichten, Sträucher
einzuſam̄eln.
Es könnte leicht —
Ruprecht.
Die Muhme iſt zu Hauſe.
76.
Walter.
Zu Hauſ’. Laßt ſein.
Ruprecht.
Die wird sogleich erſcheinen.
Walter.
Die wird uns gleich erſcheinen. Schafft den
Wein.
Adam
/: für ſich :/
Verflucht!
Walter.
Macht fort. Doch
nichts zum Imbiß, bitt’ ich,
Macht fort. Doch nichts
zum Imbiß, bitt ich,
Als ein Stück trocknen Brodes nur, und
Salz.
Adam
/: für ſich :/
Ihn mit der Ev’, im Garten, Glock
halb’ eilf,
Ihn mit Ev’, im Garten,
Glock halb’ eilf,
Ihn mit
der Ev’, im Garten, Glock halb’
eilf,
Ihn mit der Ev’, im
Garten, Glock halb eilf,
Bevor er noch, wie er geſchwätzt, um
eilf
Die Thüre ihre Kam̄er
Das Zim̄er überrumpelnd
eingeſprengt.:
Die Thüre ihrer
Kam̄er eingeſprengt.
Das Zim̄er
überrumpelnd eingeſprengt:
Das Zimmer
uͤberrumpelnd eingeſprengt:
Und zwar im heft’gen
Im
Wortgewechſel ,
koſend bald, bald
zerrend,
[ ]
Und zwar im
heft’gen Wortgewechſel zerrend,
Im
Wortgewechſel,
koſend bald, bald zerrend,
Im Wortgewechſel,
koſend bald, bald zerrend,
Als wollt er ſie zu etwas
überreden.
[ ]
Als wollt er
ſie zu etwas überreden.
Als wollt’ er ſie zu
etwas uͤberreden.
Adam
/: für ſich :/
Verflucht! Der Teufel iſt mir gut.
Walter.
Schafft dieſe Frau herbei.
Ruprecht.
Ihr Herrn, ich
bitt euch.
Ihr Herrn, ich bitt’
euch:
Das iſt kein wahres Wort.
Das ist nicht möglich.
Das iſt kein wahres
Wort, das iſt nicht moͤglich.
Adam.
O wart, Hallunke! — He! Der Büttel!
Hanfried! —
Denn auf der Flucht
zerſchlagen ſich die Krüge —
[ ]
Denn auf der
Flucht zerſchlagen ſich die Krüge —
Denn auf der Flucht
zerſchlagen ſich die Kruͤge —
— Herr Schreiber, geht, ſchafft Frau
Brigitt’ herbei!
Veit.
Hör, du verfluchter Schlingel, du, was
machſt du?
Dir brech’ ich alle Knochen
noch.
Dir brech ich alle
Knochen noch.
Ruprecht.
Weshalb auch?
Veit.
Warum verſchwiegſt du, daß du mit der
Dirne
71.
Glock halb auf eilf im Garten ſchon
ſcharwenzt?
Warum verſchwiegſt du’s?
Ruprecht.
Warum ich’s verſchwieg?
Gott’s Schlag und Donner!, weil’s nicht wahr iſt, Vater.
Gott’s Schlag und
Donner! weil’s nicht wahr iſt,
Vater.
Gott’s Schlag und
Donner, weil’s nicht wahr iſt,
Vater.
Gott’s Schlag und
Donner, weil’s nicht wahr iſt, Vater!
Wenn das die Muhme Briggÿ zeugt, ſo hängt
mich;.
Und bei den
Beinen ſie meinthalben
obenein dazu.
Und ſie meinthalben
obenein dazu.
Und bei den
Beinen ſie meinthalb dazu.
Und bei den Beinen ſie
meinthalb dazu.
Veit.
Wenn
aber ſie’s bezeugt — nim̄
dich in Acht,!
ſag’ ich!
Wenn ſie’s bezeugt — nim̄ dich in
Acht,
ſag’ ich!
Wenn
aber ſie’s bezeugt — nim̄ dich in
Acht!
Wenn aber ſie’s
bezeugt — nimm dich in Acht!
Du und die ſaubre Jungfer
Eve dort,
Du und die ſaub’re
Jungfer Eve dort,
Wie ihr auch vor Gericht euch ſtellent,
mögt,ihr ſteckt
Wie ihr auch vor Gericht
euch ſtellen
mögt,
Wie ihr auch vor
Gericht euch ſtellt,
ihr ſteckt
Wie ihr auch vor
Gericht euch ſtellt, ihr ſteckt
Ihr ſteckt
dDoch unter einer Decke noch.
S’ iſt irgend
Ihr ſteckt
doch unter einer Decke noch.
Doch
unter einer Decke noch. S’ iſt irgend
Doch unter einer Decke
noch. S’ iſt irgend
S’ iſt irgend
noch
eEin schändliches Geheimniß
noch, von dem
S’ iſt irgend
noch
ein ſchändliches Geheimniß
Ein
ſchändliches Geheimniß noch, von dem
Ein ſchaͤndliches
Geheimniß noch, von dem
Das ſie aus Liebe nur
zu dir verſchweigt.
Sie weiß, und nur aus
Schonung hier nichts ſagt.
Das ſie aus Liebe nur
zu dir verſchweigt.
Sie weiß, und
nur aus Schonung hier nichts ſagt.
Sie weiß, und nur aus
Schonung hier nichts ſagt.
Ruprecht.
Welch ein Geheimniß?!
Welches?
Welch ein
Geheimniß?
Geheimniß!
Welches?
Geheimniß!
Welches?
Veit.
Warum haſt du geſtern eingepackt?
Warum haſt du
geſtern eingepackt?
Warum haſt du
eingepackt?
Warum haſt du
eingepackt?
He? Warum haſt Du geſtern Abend
eingepackt?
Ruprecht.
Die Sachen?
Veit.
Röcke, Hoſen, ja, und Wäſche;
Ein Bündel, wie’s ein Reiſender juſt
auf
Die Schulter wirft?
Die Schultern wirft?
Ruprecht.
Weil ich nach Utrecht ſoll!
Weil ich zum Regiment ſoll! Him̄el,-Donner —!
Weil ich zum Regiment ſoll!
Him̄el, Donner —!
Weil ich zum Regiment
ſoll! Him̄el-Donner —!
Weil ich zum Regiment
ſoll! Himmel⸗Donner —!
Glaubt er, daß ich —?
Veit.
Nach Utrecht? Ja, nach
Utrecht!
Du haſt geeilt, nach Utrecht
hinzukom̄en!
Vorgeſtern wußteſt du noch nicht, ob du
Den fünften oder ſechſten Tag wirſt
reiſen.
72.
Walter.
Weiß er zur Sache was zu melden, Vater?
Veit.
— Geſtrenger Herr, ich will noch nichts
behaupten.
Ich war daheim, als ſich der Krug
zerſchlug,
Und auch von einer andern Unternehmung
Hab’ ich, die Wahrheit zu geſtehn, noch
nichts,
Wenn ich jedweden Umſtand wohl erwäge,
Das meinen Sohn verdächtig macht,
bemerkt.
Von ſeiner Unſchuld völlig überzeugt,
Kam ich hierher, nach
abgemachtem Streit
Kam ich hieher, nach
abgemachtem Streit
Sein ehelich Verlöbniß aufzuzlöſen,
Und ihm das Silberkettlein
einzufordern,
Zuſamt dem Schaupfennig, den er der
Jungfer
Bei dem Verlöbniß vorgen Herbſt
verehrt.
Wenn jetzt von Flucht was, und
Verrätherei
An meinem grauen Haar zu Tage komt,
So iſt mir das ſo neu, ihr Herrn, als
euch:
Doch dann der Teufel ſoll den Hals ihm
brechen.
Walter.
Schafft Frau Brigitt’ herbei, Herr Richter
Adam.
Adam.
— Wird Ew. Gnaden dieſe Sache nicht
Ermüden? Sie zieht ſich in die Länge.
Ew. Gnaden haben meine Caſſen noch,
Und die Regiſtratur — Was iſt die
Glocke?
Licht.
Es ſchlug ſo eben halb.
Adam.
Auf eilf!
73.
Licht.
Verzeiht! Auf
zwölfe.
Verzeiht, auf
zwoͤlfe.
Walter.
Gleichviel.
Adam.
Ich glaub’, die Zeit iſt, oder ihr
verrückt.
/: er ſieht nach der Uhr :/
Ich bin kein ehrlicher Mann. — Ja, was
befehlt ihr?
Walter.
Ich bin der Meinung —
Adam.
Abzuſchließen?
Gut —
Abzuſchließen? Gut
—!
Walter.
Erlaubt! Ich bin der Meinung,
fortzufahren.
Adam
Ihr ſeid der Meinung — Auch gut. Sonſt
würd’ ich
Auf Ehre, morgen früh, Glock neun, die
Sache,
Zu euerer Zufriedenheit beend’gen.
Walter.
Ihr wißt um meinen Willen.
Adam.
Wie ihr befehlt.
Herr Schreiber, ſchickt
die Büttel ab, ſie ſollen
Herr Schreiber, ſchickt
die Buͤttel ab; ſie ſollen
Sogleich in’s Amt die
Frau Brigitte laden.
Sogleich ins Amt die
Frau Brigitte laden.
Walter.
Und nehmt euch — Zeit, die mir viel werth,
zu ſparen —
Gefälligſt ſelbſt der Sach’ ein wenig
an.
Licht
/: ab :/
Adam.
/: aufſtehend
:/In E Beginn ›Zehnter
Auftritt‹.
Inzwiſchen könnte man, wenn’s ſo
gefällig,
Vom Sitze ſich ein wenig lüften —?
74.
Walter.
Hm! O ja.
Was ich ſagen wollte’ —
Was ich ſagen
wollte —
Was ich ſagen
wollt’ —
Was ich ſagen wollt’
—
Adam
Erlaubt ihr gleichfalls,
Daß die Parthei’n, bis Frau Brigitt’
erscheint —?
Walter
Was? Die Parthei’n?
Adam.
Ja, vor die Thür, wenn ihr —
Walter
/: für ſich :/
Verwünſcht!
/: laut :/
Herr Richter Adam, wißt ihr
was?
Gebt ein Glas Wein mir in der
Zwiſchenzeit.
Adam.
Von ganzen Herzen gern.
He! Margarethe!
Von ganzem Herzen gern.
He! Margarethe!
Ihr macht mich glücklich, gnäd’ger Herr. —
Margrethe!
Die Magd
/: trit auf :/
Die Magd.
Hier.
Adam.
Was befehlt ihr? — Tretet ab, ihr
Leute.
Franz? — Auf dem Vorſaal draußen. — Oder
Rhein?
Walter
Von unſerm Rhein.
Adam.
Gut. — Bis ich rufe. Marſch!
Walter
Wohin?
Adam.
Geh. Vom
Verſiegelten, Margrethe. —
Geh, vom Verſiegelten,
Margrethe. —
Was? Auf den Flur bloß
draußen. Hier die Schlüssel.Kleist
hat ›Schlüſſel.‹ bis in den Falz ausgeschrieben, dann
gestrichen und aus Gründen der Lesbarkeit unter der
Zeile neu geschrieben. BKA liest unter der Streichung
nur ›Schlüſſ.‹.
Schlüssel.
Was? Auf den Flur bloß
draußen. — Hier. — Der Schluͤſſel.
75.
Walter.
Hm! Bleibt.
Adam.
Fort! Marſch, ſag’ ich! — Geh,
Margarethe,!
Und Butter, friſchgeſtampft, Käſ’ auch aus
Limburg,
Und von der fetten pom̄erſchen Räuchergans.
Walter.
Halt! Einen Augenblick! Macht nicht ſo
viel
Umſtänd’, ich bitt’ euch ſehr,
Herr Richter.
Umſtaͤnd’ ich bitt euch
ſehr, Herr Richter.
Adam.
Schert
Zum Teufel euch, ſag’ ich! Thu, wie ich
sagte.
Walter.
Schickt ihr die Leute fort, Herr Richter?
Adam.
Ew. Gnaden?
Walter.
Ob ihr —?
Adam.
Sie treten ab, wenn ihr
erlaubt.
Bloß ab, bis Frau Brigitt’ erſcheint.
Wie, oder ſoll’s nicht etwa —?
Walter.
Hm! Wie ihr wollt.
Doch ob’s der Mühe ſich verlohnen wird?
Meint ihr, daß es ſo lange Zeit wird
währen,
Bis man im Ort ſie trifft?
Adam.
S’ ist heute Holztag,
Gestrenger Herr. Die Weiber
größtentheils
Sind in den Fichten, Sträucher
einzuſam̄eln.
Es könnte leicht —
Ruprecht.
Die Muhme iſt zu Hauſe.
76.
Walter.
Zu Hauſ’. Laßt ſein.
Ruprecht.
Die wird sogleich erſcheinen.
Walter.
Die wird uns gleich erſcheinen. Schafft den
Wein.
Adam
/: für ſich :/
Verflucht!
Walter.
Macht fort. Doch
nichts zum Imbiß, bitt’ ich,
Macht fort. Doch nichts
zum Imbiß, bitt ich,
Als ein Stück trocknen Brodes nur, und
Salz.
Adam
/: für ſich :/
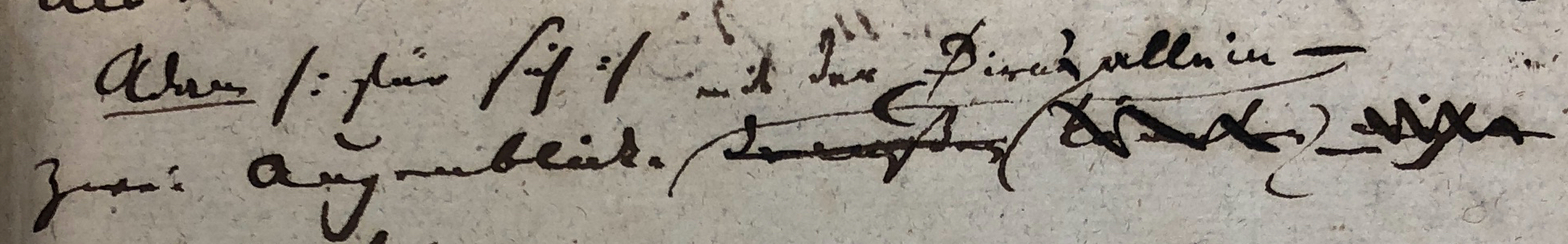 Zwei Augenblicke draußen
könnten
mich —
—
mit der Dirne’
allein —
Zwei Augenblicke
draußen könnten mich —
Zwei Augenblicke mit der
Dirne könnten
—
Zwei Augenblicke mit der
Dirn’
allein —
Zwei Augenblicke mit
der Dirn’ allein —
/: laut :/
Ach! Trocknes Brod! Was! Salz!
Geht doch.
Ach trocknes Brod!
Was! Salz! Geht doch.
Walter.
Gewiß.
Adam.
Zwei Augenblicke draußen
könnten
mich —
—
mit der Dirne’
allein —
Zwei Augenblicke
draußen könnten mich —
Zwei Augenblicke mit der
Dirne könnten
—
Zwei Augenblicke mit der
Dirn’
allein —
Zwei Augenblicke mit
der Dirn’ allein —
/: laut :/
Ach! Trocknes Brod! Was! Salz!
Geht doch.
Ach trocknes Brod!
Was! Salz! Geht doch.
Walter.
Gewiß.
Adam.
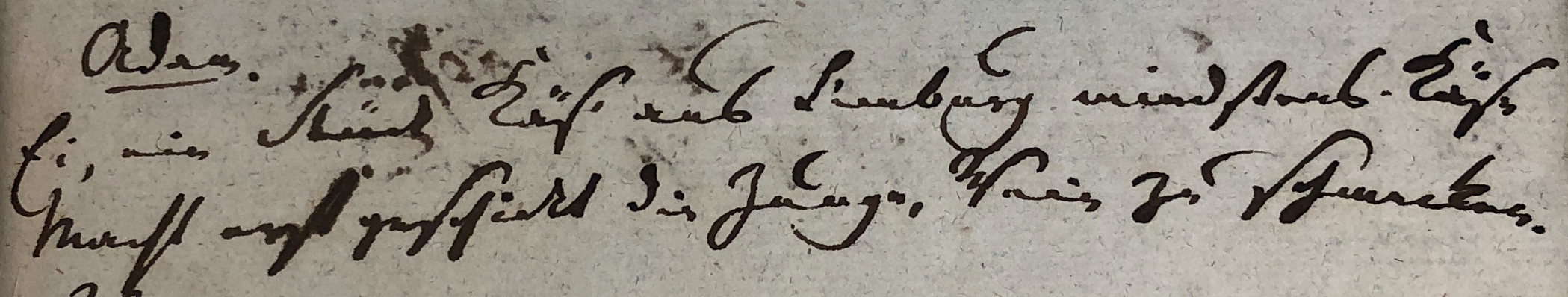 Ei, ein Stück Käs’ aus
Limburg
mindstens
liest ›mindstens.‹
liest ›mindstens.‹
Käse BKA (I/3, S. 378) und HAM
(S. 188) lesen ›mindſtens. Käſe‹. Träfe dieses zu,
ergäbe sich in H eine andere Aussage als in E. Statt
›mindſtens Käſe‹ – und zwar egal welcher – mache ›erſt
geſchickt die Zunge‹, hieße es in H stattdessen
sinngemäß ›ein Stück Käſ’ aus Limburg mindſtens‹ mache
›erſt geſchickt die Zunge‹. Aus Sicht des Verfassers
handelt es sich hier in H allerdings eher um ein
Artefakt, einen zufälligen Tintenausfluss oder
Tintendurchschlag, ähnlich wie in der folgenden Zeile
das Artefakt hinter ›erst‹. Der Abstand zwischen
›mindſtens‹ und ›Käſe‹ wäre für Kleists
Schreibgewohnheit auch viel zu gering, wenn dort noch
ein Punkt hätte stehen sollen. Nicht zuletzt steht die
Gestaltung in E gegen die Annahme eines Punktes, da
Kleist hier zur Verdeutlichung ›mindſtens Käſe‹
zusätzlich zwischen zwei Gedankenstrichen einschließt.
Die Antwort Walters (Vers 1449) unterstützt diese
Lesart.
Ei, ein Stuͤck Kaͤſ’
aus Limburg — mindſtens Kaͤſe —
Macht erſt geſchickt die Zunge, Wein zu
ſchmecken.
Walter.
Gut. Ein Stück Käſe denn.
Doch weiter nichts.
Gut. Ein Stuͤck Kaͤſe
denn, doch weiter nichts.
Adam.
So geh. Und weiß, von Damaſt,
aufgedeckt.
Schlecht Alles zwar, doch recht.
Die Magd /: ab
:/
Das iſt der Vortheil
Von uns verrufnen hageſtolzen Leuten,
Daß wir, was Andre, knapp
und kum̄ervoll,
Daß wir, was Andre
knapp und kummervoll,
Mit Weib und Kindern täglich theilen
müͤſſen,
Mit einem Freunde, zur
gelegnen Stunde,
Mit einem Freunde zur
gelegnen Stunde,
Vollauf genießen.
77.
Walter.Ab hier mit neuer Feder
geschrieben.
Was ich ſagen wollte —
Wie kamt ihr doch zu eurer Wund’, Herr
Richter?
Das iſt ein böſes Loch, fürwahr, im Kopf,
das!
Adam.
— Ich fiel.
Walter.
Ihr fielt. Hm! So. Wann? Geſtern
Abend?
Adam.
Heut, Glock halb ſechs, verzeiht, am
Morgen, früh,
Da ich ſo eben aus dem Bette ſtieg.
Walter.
Worüber?
Adam
Über — Gnäd’ger
Herr Gerichtsrath,
Ueber — gnaͤd’ger Herr
Gerichtsrath,
Die Wahrheit euch zu ſagen, über mich.
Ei, ein Stück Käs’ aus
Limburg
mindstens
liest ›mindstens.‹
liest ›mindstens.‹
Käse BKA (I/3, S. 378) und HAM
(S. 188) lesen ›mindſtens. Käſe‹. Träfe dieses zu,
ergäbe sich in H eine andere Aussage als in E. Statt
›mindſtens Käſe‹ – und zwar egal welcher – mache ›erſt
geſchickt die Zunge‹, hieße es in H stattdessen
sinngemäß ›ein Stück Käſ’ aus Limburg mindſtens‹ mache
›erſt geſchickt die Zunge‹. Aus Sicht des Verfassers
handelt es sich hier in H allerdings eher um ein
Artefakt, einen zufälligen Tintenausfluss oder
Tintendurchschlag, ähnlich wie in der folgenden Zeile
das Artefakt hinter ›erst‹. Der Abstand zwischen
›mindſtens‹ und ›Käſe‹ wäre für Kleists
Schreibgewohnheit auch viel zu gering, wenn dort noch
ein Punkt hätte stehen sollen. Nicht zuletzt steht die
Gestaltung in E gegen die Annahme eines Punktes, da
Kleist hier zur Verdeutlichung ›mindſtens Käſe‹
zusätzlich zwischen zwei Gedankenstrichen einschließt.
Die Antwort Walters (Vers 1449) unterstützt diese
Lesart.
Ei, ein Stuͤck Kaͤſ’
aus Limburg — mindſtens Kaͤſe —
Macht erſt geſchickt die Zunge, Wein zu
ſchmecken.
Walter.
Gut. Ein Stück Käſe denn.
Doch weiter nichts.
Gut. Ein Stuͤck Kaͤſe
denn, doch weiter nichts.
Adam.
So geh. Und weiß, von Damaſt,
aufgedeckt.
Schlecht Alles zwar, doch recht.
Die Magd /: ab
:/
Das iſt der Vortheil
Von uns verrufnen hageſtolzen Leuten,
Daß wir, was Andre, knapp
und kum̄ervoll,
Daß wir, was Andre
knapp und kummervoll,
Mit Weib und Kindern täglich theilen
müͤſſen,
Mit einem Freunde, zur
gelegnen Stunde,
Mit einem Freunde zur
gelegnen Stunde,
Vollauf genießen.
77.
Walter.Ab hier mit neuer Feder
geschrieben.
Was ich ſagen wollte —
Wie kamt ihr doch zu eurer Wund’, Herr
Richter?
Das iſt ein böſes Loch, fürwahr, im Kopf,
das!
Adam.
— Ich fiel.
Walter.
Ihr fielt. Hm! So. Wann? Geſtern
Abend?
Adam.
Heut, Glock halb ſechs, verzeiht, am
Morgen, früh,
Da ich ſo eben aus dem Bette ſtieg.
Walter.
Worüber?
Adam
Über — Gnäd’ger
Herr Gerichtsrath,
Ueber — gnaͤd’ger Herr
Gerichtsrath,
Die Wahrheit euch zu ſagen, über mich.
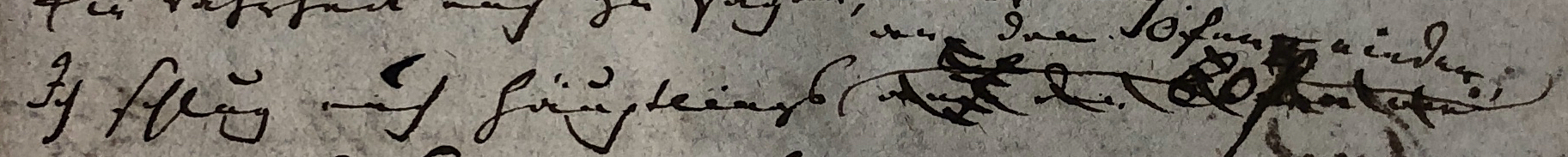 Ich ſchlug euch häuptlings auf den BoOdfen an
an den Ofen nieder,
Ich ſchlug euch häuptlings auf
den Boden an
Ich ſchlug euch häuptlings
auf den Ofen an
Ich ſchlug euch
häuptlings an den Ofen nieder,
Ich ſchlug euch
haͤuptlings an den Ofen nieder,
Bis dieſe Stunde weiß ich nicht, warum?
Walter.
Von hinten?
Adam.
Wie? Von hinten —
Walter.
Oder vorn?
Ihr habt zwo zWunden, vorne Ein’ und
hinten.
Adam.
Von vorn und hinten. — Margarethe!
Die beiden
MagdKleist übersieht, nach
Einfügen von ›beiden‹ auch ›Magd‹ in die Pluralform zu
ändern.
/: mit Wein u. ſ. w. Sie
decken auf, und
Ich ſchlug euch häuptlings auf den BoOdfen an
an den Ofen nieder,
Ich ſchlug euch häuptlings auf
den Boden an
Ich ſchlug euch häuptlings
auf den Ofen an
Ich ſchlug euch
häuptlings an den Ofen nieder,
Ich ſchlug euch
haͤuptlings an den Ofen nieder,
Bis dieſe Stunde weiß ich nicht, warum?
Walter.
Von hinten?
Adam.
Wie? Von hinten —
Walter.
Oder vorn?
Ihr habt zwo zWunden, vorne Ein’ und
hinten.
Adam.
Von vorn und hinten. — Margarethe!
Die beiden
MagdKleist übersieht, nach
Einfügen von ›beiden‹ auch ›Magd‹ in die Pluralform zu
ändern.
/: mit Wein u. ſ. w. Sie
decken auf, und gehen wieder ab :/ Walter. Wie? Adam. Erſt ſo, dann ſo. Erſt auf die Ofenkante, Die vorn die Stirn mir einſtieß, und ſodann 78 Vom Ofen rückwärts auf den Boden wieder, Wo ich mir noch den Hinterkopf zerschlug. /: Er er ſchenkt ein :/ Iſt’s euch gefällig. Iſt’s euch gefaͤllig? Walter. /: nimt das Glas :/ Hättet ihr ein Weib, So würd’ ich wunderliche Dinge glauben, Herr Richter. Adam. Wie so? Walter. Ja, bei meiner Treu, So rings ſeh ich zerkritzt euch und zerkratzt. So rings ſeh’ ich zerkritzt euch und zerkratzt. Adam /: lacht :/
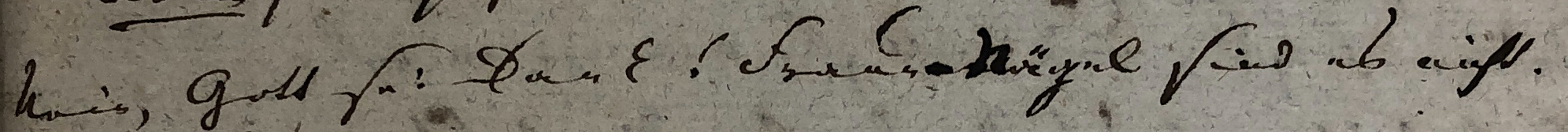 Nein, Gott ſei Dank! Frauenn-NägelKleist
ändert aus metrischen Gründen ›Frauennägel‹ in
›Fraun-Nägel‹. Hierbei lässt er in der Korrektur das
›e‹ in ›Frauen‹ stehen und vertraut aufgrund der
Ähnlichkeit von ›e‹ und ›n‹ in der Current-Handschrift
darauf, dass das ›e‹ nun als ›n‹ gelesen wird, also
statt ›Fraue‹ ›Fraun‹. ſind es nicht.
Nein, Gott ſei Dank!
Frauennägel ſind es nicht.
Nein, Gott ſei Dank!
Fraun-Nägel ſind es nicht.
Nein, Gott ſei Dank!
Fraunnaͤgel ſind es nicht.
Walter.
Glaub’s. Auch ein Vortheil noch der
Hageſtolzen.
Adam
/: fortlachend :/
Strauchwerk, für Seidenwürmer, das man
trocknend,
Mir an dem Ofenwinkel aufgeſetzt. —
Auf euer Wohlergehn!
/: sie trinken :/
Walter.
Und grad’ auhKleist schreibt ›auh‹ statt
›auch‹. heut
Noch die Perücke ſeltſam
einzubüßen.
Noch die Peruͤcke
ſeltſam einzubuͤßen!
Die hätt’ euch eure
Wunden noch bedeckt.
Die haͤtt’ euch eure
Wunde noch bedeckt.
Adam.
Ja, ja. Jedwedes Übel iſt ein Zwilling.
—
Hier — von dem fetten jetzt — kann ich —?
Walter.
Ein Stückchen.
Aus Limburg?
Adam.
Rect’ aus Limburg, gnäd’ger
Herr.
79.
Walter.
— Wie Teufel aber, ſagt mir, gieng das
zu?
Adam.
Was?
Walter.
Daß ihr die
Perücken eingebüßt.
Daß ihr die Peruͤcke
eingebuͤßt.
Adam.
Ja ſeht. Ich ſitz’ und leſe geſtern
Abend
Ein Actenstück, und weil ich mir die
Brille
Verlegt, duck’ ich ſo tief mich in den
Streit,
Daß bei der Kerze Flam̄e lichterloh
Mir die Perücke angeht. Ich, ich denke,
Feu’r fällt vom hHim̄el auf mein ſündig Haupt,
Und greife ſie, und will ſie von mir
werfen;
Doch eh’ ich noch das
Nackenband gelöſ’t,
Doch eh ich noch das
Nackenband geloͤßt,
Brennt ſie wie Sodom und Gomorrha
ſchon.
Kaum daß ich die drei Haare noch mir
rette.
Walter.
Verwünſcht! Und eure
andr’ iſt in der Stadt.
Verwuͤnſcht! Und eure
andre iſt in der Stadt.
Adam.
Bei dem Perückenmacher. — Doch zur
Sache.
Walter.
Nicht allzuraſch, ¿
ich bitt’, Herr Richter Adam.
Adam.
Ei was! Die Stunde rollt.
Ein Gläschen. Hier.
Ei, was! Die Stunde
rollt. Ein Glaͤschen hier.
/: Er
er
ſchenkt ein :/
Walter.
Der Lebrecht, —
wenn der Kauz dort wahr geſprochen —
Er auch hat einen böſen Fall gethan.
Adam.
Auf meine Ehr’.
/: er trinkt :/
80.
Walter.
Wenn hier die Sache,
Wie ich faſt fürchte, unentworren
bleibt,
So werdet ihr, in eurem Ort, den Thäter
Leicht noch aus ſeiner Wund’ entdecken
können.
/: er trinkt :/
Nierſteiner?
Adam.
Was?
Walter.
Oder guter Oppenheimer?
Adam.
Nierſtein. Sieh da! Auf Ehre! Ihr
verſteht’s.
Aus Nierſtein, gnäd’ger Herr, als hätt’ ich
ihn geholt.
Walter.
Ich prüft’ ihn, vor drei Jahren, an der
Kelter.
Adam
/: ſchenkt wieder ein
:/
Walter.
— Wie hoch iſt euer
Fenſter — dort! Frau Marthe!
— Wie hoch iſt euer
Fenſter — dort! Frau Marthe.
Frau Marthe.
Mein Fenſter?
Walter.
Das Fenſter
jener Kam̄er, ja,
Das Fenſter jener
Kammer ja,
Worin die Jungfer ſchläft?
Frau Marthe.
Die Kam̄er zwar
Iſt nur vom erſten Stock, ein Keller
drunter,
Mehr als neun Fuß das Fenſter nicht vom
Boden;
Jedoch die ganze,
wohlerwogene,
Jedoch die ganze,
wohlerwogene
Gelegenheit ſehr ungeſchickt zum
Springen.
Denn auf zwei Fuß ſteht von der Wand ein
Weinſtock,
Der ſeine knot’gen Äſte rankend hin
Durch ein Spalier treibt
längs der ganzen
Wand:
liest ›Wand‹
Ein Doppelpunkt hinter ›Wand‹ ist unter einem
Tintenausfluss noch erkennbar. Entsprechend auch in E
übertragen. BKA und Hamacher lesen ›Wand‹.
Durch ein Spalier
treibt, laͤngs der ganzen Wand:
Das Fenſter ſelbst iſt
noch iſtKleist
übersieht, das überflüssige zweite ›ist‹ im Vers zu
streichen. davon umſtrickt.
Das Fenſter ſelbſt iſt
noch davon umſtrickt.
81.
Es würd’ ein Eber, ein gewaffneter,
Müh mit den Fängern haben,
durchzubrechen.
Adam
Es hieng auch keiner drin.
/: er ſchenkt ſich ein :/
Walter.
Meint ihr?
Adam.
Ach, geht!
/: er trinkt :/
Walter
/: zu Ruprecht :/
Wie traf er denn den Sünder? Auf den
Kopf?
Adam.
Hier.
Walter.
Laßt.
Adam.
Gebt her.
Walter.
S’ iſt halb noch voll.
Adam.
Will’s füllen.
Wills fuͤllen.
Walter
Ihr hört’s.
Adam.
Ei, für die gute Zahl.
Walter.
Ich bitt’ euch.
Adam.
Ach, was! Nach der Pythagoräer-Regel.
/: er ſchenkt ihm ein :/
Walter.
/: wieder zu Ruprecht
:/
Wie oft traf er dem Sünder denn den
Kopf?
Adam.
Eins iſt der Herr. Zwei
iſt das finſtre Chaos.
Eins iſt der Herr. Zwei
iſt das finſtre Chaos;
Drei iſt die Welt. Drei Gläser lob’ ich
mir.
Im dDritten trinkt man mit
den Tropfen Sonnen,
Und Firmamente mit den übrigen.
82.
Walter.
Wie oftmals auf den Kopf traf er den
Sünder?
Er, Ruprecht, ihn dort frag’ ich!
Adam.
Wird Wird
man’s hören?
Wie oft trafſt du den Sündenbock? Na, heraus!
Wie oft trafſt du den
Sündenbock?
Wie oft trafſt du
den Sündenbock? Na, heraus!
Wie oft trafſt du den
Suͤndenbock? Na, heraus!
Na, heraus!
Gott’s Blitz, ſeht, weiß der Kerl wohl ſelbſt, ob er
—
Na, heraus!
Gott’s Blitz, ſeht, weiß der Kerl wohl ſelbſt,
Gott’s Blitz,
ſeht, weiß der Kerl wohl ſelbſt, ob er
—
Gott’s Blitz, ſeht,
weiß der Kerl wohl ſelbſt, ob er —
Vergaßt du’s?
Ruprecht.
Mit der Klinke?
Adam.
Ja, was weiß’
ich.
Ja, was weiß ich.
Walter.
Vom Fenſter, als er nach ihm herunter
hieb?
Ruprecht.
Zweimal, ihr Herrn.
Adam.
Hallunk’e! Das behielt
er!
Hallunk’!
Hallunke!
Das behielt er!
Hallunke! das behielt
er!
/: er trinkt :/
Walter.
Zweimal! Er konnt’ ihn mit zwei ſolchen
Hieben
Erſchlagen, weiß er —?
Ruprecht.
Hätt’ ich ihn erſchlagen,
So hätt’ ich ihn. Es wär mir grade
recht.
Läg er hier vor mir,
todt, ſo könnt’ ich ſagen,
Laͤg’ er hier vor mir,
todt, ſo koͤnnt’ ich ſagen,
Der war’s, ihr Herrn, ich
hab’ ¿ euch nicht belogen.
Der war’s, ihr Herrn,
ich hab euch nicht belogen.
Adam.
Ja, todt! Das glaub’ ich. Aber ſo —
/: er ſchenkt ein :/
Walter.
Konnt’ er ihn n denn im Dunkel nicht
erkennen?
Konnt’ er ihn denn im
dunkeln nicht erkennen?
Ruprecht.
Nicht einen Stich,
geſtrenger Herr. Wie ſollt’ ich?
Nicht einen Stich,
geſtrenger Herr. Wie ſollt ich?
Adam.
Warum ſperrt’ſt du nicht die Augen auf —
Stoßt an!
83.
Ruprecht.
Die Augen auf! Ich hatt’ ſie
aufgeſperrt.
Der Satan warf ſie mir voll Sand.
Adam
/: in den Bart :/
Voll Sand, ja!
Warum ſperrt’ſt du deine großen Augen
auf.
— Hier. Was wir lieben, gnäd’ger Herr!
Stoßt an!
Walter.
— Was recht und gut und treu iſt, Richter
Adam!
/: ſie trinken :/
Adam.
Noch Eins. Die Stunde
rollt. Wir müſſen’s ſchließen.
Nun denn, zum Schluß jetzt,
wenn’s gefällig iſt.
Noch Eins. Die Stunde
rollt. Wir müſſen’s ſchließen.
Nun denn, zum
Schluß jetzt, wenn’s gefällig iſt.
Nun denn, zum Schluß
jetzt, wenns gefaͤllig iſt.
/: er ſchenkt ein :/
Walter.
Ihr ſeid zuweilen bei Frau Marthe wohl,
Herr Richter Adam. Sagt mir doch,
Wer, außer Ruprecht, geht dort aus und
ein.
Adam.Die folgenden Verse bis Blattende ebenso wie
die ersten sechs Zeilen der Folgeseite 84 streicht
Kleist nach Abschrift wieder. Die Erwiderung Walters
am Ende der Streichung auf Seite 84 wir gar nicht mehr
ausgeführt, bzw. abgeschrieben. Die nach der
Streichung folgenden Verse auf Seite 84 sind mit
anderer Feder als die vorhergehenden geschrieben. Da
aber das Schriftbild ab Seite 85 wieder dem der Verse
bis einschließlich der Streichung auf Seite 83f
entspricht, kann man davon ausgehen, dass Kleist den
Rest der Seite 84 zunächst frei läßt, und ab Seite 85
mit der Abschrift fortfährt. Später wurden die neu
geschriebenen Verse dann auf Seite 84 ergänzt und
teilweise direkt korrigiert.
Ich, gnäd’ger Herr?
Niemals!
Walter.
Niemals?
Adam.
Wie komt
ihr —?
Walter.
Frau Marthe!
Frau Marthe.
Was?
Walter.
Habt ihr’s
mit Richter Adam
Verdorben? Sollt’ er
die Wittwe nicht
Zuweilen eines
ſeel’gen Freund’s beſuchen?
Frau Marthe
Ob ich’s mit Richter Adam
—?
Walter.
Ja.
Frau Marthe.
Verdorben?
84.
Das wüßt’ ich nicht,
geſtrenger Herr,
Vielmehr denk’ ich,
er iſt mein guter Freund.
Walter.
Das ſag’ ich auch?.
Adam.
Das hab’
ich nicht geläugnet.
Walter.
Adam.
Nein, Gott ſei Dank! Frauenn-NägelKleist
ändert aus metrischen Gründen ›Frauennägel‹ in
›Fraun-Nägel‹. Hierbei lässt er in der Korrektur das
›e‹ in ›Frauen‹ stehen und vertraut aufgrund der
Ähnlichkeit von ›e‹ und ›n‹ in der Current-Handschrift
darauf, dass das ›e‹ nun als ›n‹ gelesen wird, also
statt ›Fraue‹ ›Fraun‹. ſind es nicht.
Nein, Gott ſei Dank!
Frauennägel ſind es nicht.
Nein, Gott ſei Dank!
Fraun-Nägel ſind es nicht.
Nein, Gott ſei Dank!
Fraunnaͤgel ſind es nicht.
Walter.
Glaub’s. Auch ein Vortheil noch der
Hageſtolzen.
Adam
/: fortlachend :/
Strauchwerk, für Seidenwürmer, das man
trocknend,
Mir an dem Ofenwinkel aufgeſetzt. —
Auf euer Wohlergehn!
/: sie trinken :/
Walter.
Und grad’ auhKleist schreibt ›auh‹ statt
›auch‹. heut
Noch die Perücke ſeltſam
einzubüßen.
Noch die Peruͤcke
ſeltſam einzubuͤßen!
Die hätt’ euch eure
Wunden noch bedeckt.
Die haͤtt’ euch eure
Wunde noch bedeckt.
Adam.
Ja, ja. Jedwedes Übel iſt ein Zwilling.
—
Hier — von dem fetten jetzt — kann ich —?
Walter.
Ein Stückchen.
Aus Limburg?
Adam.
Rect’ aus Limburg, gnäd’ger
Herr.
79.
Walter.
— Wie Teufel aber, ſagt mir, gieng das
zu?
Adam.
Was?
Walter.
Daß ihr die
Perücken eingebüßt.
Daß ihr die Peruͤcke
eingebuͤßt.
Adam.
Ja ſeht. Ich ſitz’ und leſe geſtern
Abend
Ein Actenstück, und weil ich mir die
Brille
Verlegt, duck’ ich ſo tief mich in den
Streit,
Daß bei der Kerze Flam̄e lichterloh
Mir die Perücke angeht. Ich, ich denke,
Feu’r fällt vom hHim̄el auf mein ſündig Haupt,
Und greife ſie, und will ſie von mir
werfen;
Doch eh’ ich noch das
Nackenband gelöſ’t,
Doch eh ich noch das
Nackenband geloͤßt,
Brennt ſie wie Sodom und Gomorrha
ſchon.
Kaum daß ich die drei Haare noch mir
rette.
Walter.
Verwünſcht! Und eure
andr’ iſt in der Stadt.
Verwuͤnſcht! Und eure
andre iſt in der Stadt.
Adam.
Bei dem Perückenmacher. — Doch zur
Sache.
Walter.
Nicht allzuraſch, ¿
ich bitt’, Herr Richter Adam.
Adam.
Ei was! Die Stunde rollt.
Ein Gläschen. Hier.
Ei, was! Die Stunde
rollt. Ein Glaͤschen hier.
/: Er
er
ſchenkt ein :/
Walter.
Der Lebrecht, —
wenn der Kauz dort wahr geſprochen —
Er auch hat einen böſen Fall gethan.
Adam.
Auf meine Ehr’.
/: er trinkt :/
80.
Walter.
Wenn hier die Sache,
Wie ich faſt fürchte, unentworren
bleibt,
So werdet ihr, in eurem Ort, den Thäter
Leicht noch aus ſeiner Wund’ entdecken
können.
/: er trinkt :/
Nierſteiner?
Adam.
Was?
Walter.
Oder guter Oppenheimer?
Adam.
Nierſtein. Sieh da! Auf Ehre! Ihr
verſteht’s.
Aus Nierſtein, gnäd’ger Herr, als hätt’ ich
ihn geholt.
Walter.
Ich prüft’ ihn, vor drei Jahren, an der
Kelter.
Adam
/: ſchenkt wieder ein
:/
Walter.
— Wie hoch iſt euer
Fenſter — dort! Frau Marthe!
— Wie hoch iſt euer
Fenſter — dort! Frau Marthe.
Frau Marthe.
Mein Fenſter?
Walter.
Das Fenſter
jener Kam̄er, ja,
Das Fenſter jener
Kammer ja,
Worin die Jungfer ſchläft?
Frau Marthe.
Die Kam̄er zwar
Iſt nur vom erſten Stock, ein Keller
drunter,
Mehr als neun Fuß das Fenſter nicht vom
Boden;
Jedoch die ganze,
wohlerwogene,
Jedoch die ganze,
wohlerwogene
Gelegenheit ſehr ungeſchickt zum
Springen.
Denn auf zwei Fuß ſteht von der Wand ein
Weinſtock,
Der ſeine knot’gen Äſte rankend hin
Durch ein Spalier treibt
längs der ganzen
Wand:
liest ›Wand‹
Ein Doppelpunkt hinter ›Wand‹ ist unter einem
Tintenausfluss noch erkennbar. Entsprechend auch in E
übertragen. BKA und Hamacher lesen ›Wand‹.
Durch ein Spalier
treibt, laͤngs der ganzen Wand:
Das Fenſter ſelbst iſt
noch iſtKleist
übersieht, das überflüssige zweite ›ist‹ im Vers zu
streichen. davon umſtrickt.
Das Fenſter ſelbſt iſt
noch davon umſtrickt.
81.
Es würd’ ein Eber, ein gewaffneter,
Müh mit den Fängern haben,
durchzubrechen.
Adam
Es hieng auch keiner drin.
/: er ſchenkt ſich ein :/
Walter.
Meint ihr?
Adam.
Ach, geht!
/: er trinkt :/
Walter
/: zu Ruprecht :/
Wie traf er denn den Sünder? Auf den
Kopf?
Adam.
Hier.
Walter.
Laßt.
Adam.
Gebt her.
Walter.
S’ iſt halb noch voll.
Adam.
Will’s füllen.
Wills fuͤllen.
Walter
Ihr hört’s.
Adam.
Ei, für die gute Zahl.
Walter.
Ich bitt’ euch.
Adam.
Ach, was! Nach der Pythagoräer-Regel.
/: er ſchenkt ihm ein :/
Walter.
/: wieder zu Ruprecht
:/
Wie oft traf er dem Sünder denn den
Kopf?
Adam.
Eins iſt der Herr. Zwei
iſt das finſtre Chaos.
Eins iſt der Herr. Zwei
iſt das finſtre Chaos;
Drei iſt die Welt. Drei Gläser lob’ ich
mir.
Im dDritten trinkt man mit
den Tropfen Sonnen,
Und Firmamente mit den übrigen.
82.
Walter.
Wie oftmals auf den Kopf traf er den
Sünder?
Er, Ruprecht, ihn dort frag’ ich!
Adam.
Wird Wird
man’s hören?
Wie oft trafſt du den Sündenbock? Na, heraus!
Wie oft trafſt du den
Sündenbock?
Wie oft trafſt du
den Sündenbock? Na, heraus!
Wie oft trafſt du den
Suͤndenbock? Na, heraus!
Na, heraus!
Gott’s Blitz, ſeht, weiß der Kerl wohl ſelbſt, ob er
—
Na, heraus!
Gott’s Blitz, ſeht, weiß der Kerl wohl ſelbſt,
Gott’s Blitz,
ſeht, weiß der Kerl wohl ſelbſt, ob er
—
Gott’s Blitz, ſeht,
weiß der Kerl wohl ſelbſt, ob er —
Vergaßt du’s?
Ruprecht.
Mit der Klinke?
Adam.
Ja, was weiß’
ich.
Ja, was weiß ich.
Walter.
Vom Fenſter, als er nach ihm herunter
hieb?
Ruprecht.
Zweimal, ihr Herrn.
Adam.
Hallunk’e! Das behielt
er!
Hallunk’!
Hallunke!
Das behielt er!
Hallunke! das behielt
er!
/: er trinkt :/
Walter.
Zweimal! Er konnt’ ihn mit zwei ſolchen
Hieben
Erſchlagen, weiß er —?
Ruprecht.
Hätt’ ich ihn erſchlagen,
So hätt’ ich ihn. Es wär mir grade
recht.
Läg er hier vor mir,
todt, ſo könnt’ ich ſagen,
Laͤg’ er hier vor mir,
todt, ſo koͤnnt’ ich ſagen,
Der war’s, ihr Herrn, ich
hab’ ¿ euch nicht belogen.
Der war’s, ihr Herrn,
ich hab euch nicht belogen.
Adam.
Ja, todt! Das glaub’ ich. Aber ſo —
/: er ſchenkt ein :/
Walter.
Konnt’ er ihn n denn im Dunkel nicht
erkennen?
Konnt’ er ihn denn im
dunkeln nicht erkennen?
Ruprecht.
Nicht einen Stich,
geſtrenger Herr. Wie ſollt’ ich?
Nicht einen Stich,
geſtrenger Herr. Wie ſollt ich?
Adam.
Warum ſperrt’ſt du nicht die Augen auf —
Stoßt an!
83.
Ruprecht.
Die Augen auf! Ich hatt’ ſie
aufgeſperrt.
Der Satan warf ſie mir voll Sand.
Adam
/: in den Bart :/
Voll Sand, ja!
Warum ſperrt’ſt du deine großen Augen
auf.
— Hier. Was wir lieben, gnäd’ger Herr!
Stoßt an!
Walter.
— Was recht und gut und treu iſt, Richter
Adam!
/: ſie trinken :/
Adam.
Noch Eins. Die Stunde
rollt. Wir müſſen’s ſchließen.
Nun denn, zum Schluß jetzt,
wenn’s gefällig iſt.
Noch Eins. Die Stunde
rollt. Wir müſſen’s ſchließen.
Nun denn, zum
Schluß jetzt, wenn’s gefällig iſt.
Nun denn, zum Schluß
jetzt, wenns gefaͤllig iſt.
/: er ſchenkt ein :/
Walter.
Ihr ſeid zuweilen bei Frau Marthe wohl,
Herr Richter Adam. Sagt mir doch,
Wer, außer Ruprecht, geht dort aus und
ein.
Adam.Die folgenden Verse bis Blattende ebenso wie
die ersten sechs Zeilen der Folgeseite 84 streicht
Kleist nach Abschrift wieder. Die Erwiderung Walters
am Ende der Streichung auf Seite 84 wir gar nicht mehr
ausgeführt, bzw. abgeschrieben. Die nach der
Streichung folgenden Verse auf Seite 84 sind mit
anderer Feder als die vorhergehenden geschrieben. Da
aber das Schriftbild ab Seite 85 wieder dem der Verse
bis einschließlich der Streichung auf Seite 83f
entspricht, kann man davon ausgehen, dass Kleist den
Rest der Seite 84 zunächst frei läßt, und ab Seite 85
mit der Abschrift fortfährt. Später wurden die neu
geschriebenen Verse dann auf Seite 84 ergänzt und
teilweise direkt korrigiert.
Ich, gnäd’ger Herr?
Niemals!
Walter.
Niemals?
Adam.
Wie komt
ihr —?
Walter.
Frau Marthe!
Frau Marthe.
Was?
Walter.
Habt ihr’s
mit Richter Adam
Verdorben? Sollt’ er
die Wittwe nicht
Zuweilen eines
ſeel’gen Freund’s beſuchen?
Frau Marthe
Ob ich’s mit Richter Adam
—?
Walter.
Ja.
Frau Marthe.
Verdorben?
84.
Das wüßt’ ich nicht,
geſtrenger Herr,
Vielmehr denk’ ich,
er iſt mein guter Freund.
Walter.
Das ſag’ ich auch?.
Adam.
Das hab’
ich nicht geläugnet.
Walter.
Adam.
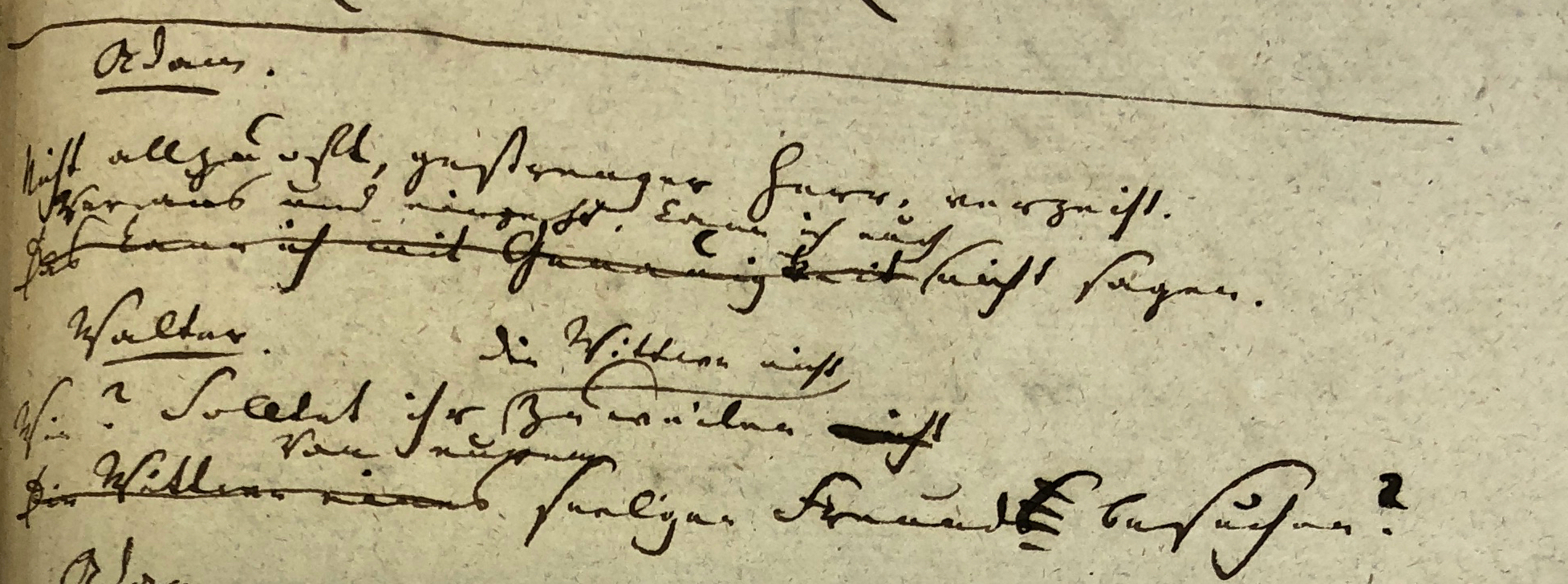 Nicht allzu oft, geſtrenger Herr,
verzeiht.
Das kann ich mit
Genauigkeit
Wer aus und eingeht, kann ich
euch nicht ſagen.
Das kann ich mit
Genauigkeit nicht ſagen.
Wer aus und
eingeht, kann ich euch nicht ſagen.
Wer aus und eingeht,
kann ich euch nicht ſagen.
Walter.
Wie? Solltet ihr die
Wittwe nicht zuweilen nicht
Wie? Solltet ihr zuweilen
nicht
Wie? Solltet ihr
die Wittwe nicht zuweilen
Wie? Solltet ihr die
Wittwe nicht zuweilen
Die Wittwe eines
Von eurem ſeel’gen
Freunds beſuchen?
Die Wittwe eines
ſeel’gen Freunds beſuchen?
Von
eurem ſeel’gen Freund beſuchen?
Von eurem ſeel’gen
Freund beſuchen?
Adam.
Nein, in der That. Sehr ſelten
nur.
Nein, in der That,
ſehr ſelten nur.
Walter.
Frau Marthe!
Nicht allzu oft, geſtrenger Herr,
verzeiht.
Das kann ich mit
Genauigkeit
Wer aus und eingeht, kann ich
euch nicht ſagen.
Das kann ich mit
Genauigkeit nicht ſagen.
Wer aus und
eingeht, kann ich euch nicht ſagen.
Wer aus und eingeht,
kann ich euch nicht ſagen.
Walter.
Wie? Solltet ihr die
Wittwe nicht zuweilen nicht
Wie? Solltet ihr zuweilen
nicht
Wie? Solltet ihr
die Wittwe nicht zuweilen
Wie? Solltet ihr die
Wittwe nicht zuweilen
Die Wittwe eines
Von eurem ſeel’gen
Freunds beſuchen?
Die Wittwe eines
ſeel’gen Freunds beſuchen?
Von
eurem ſeel’gen Freund beſuchen?
Von eurem ſeel’gen
Freund beſuchen?
Adam.
Nein, in der That. Sehr ſelten
nur.
Nein, in der That,
ſehr ſelten nur.
Walter.
Frau Marthe!
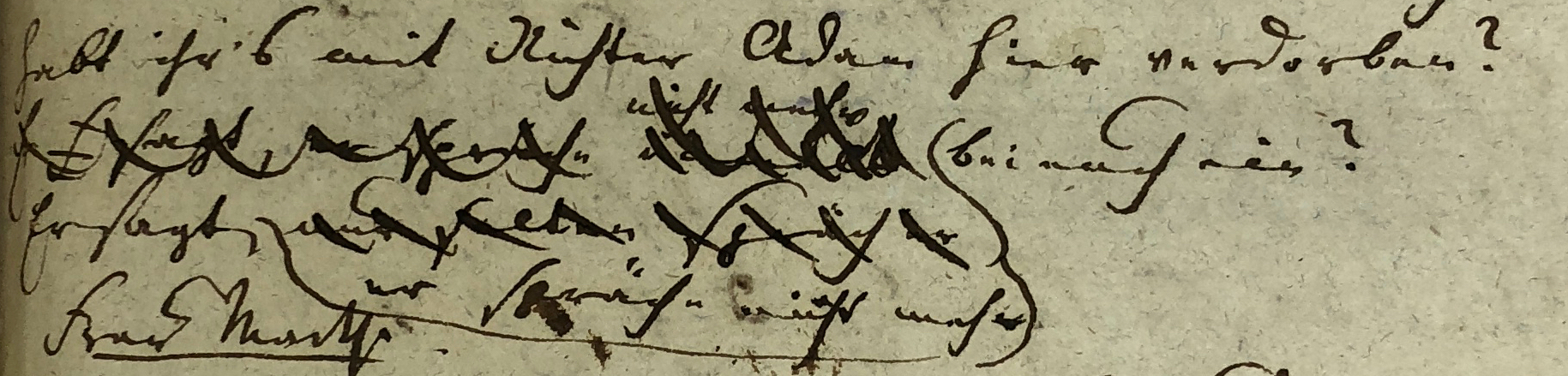 Habt ihr’s mit Richter Adam hier
verdorben?
Er S ſagt, er ſpräche niemalsnicht mehr
Er ſagt, nur ſelten ſpräch’ er
er ſpräche nicht
mehr
bei euch ein?Während
Kleist nach der Abschrift seine Korrekturen (bis auf
kurze Sofortkorrekturen) zwischen die Zeilen schreiben
muss, in der Regel in kleinerer Schrift, korrigiert er
hier den Vers 1567 mehrfach und über zwei Zeilen
direkt während der Niederschrift, erkennbar aus dem
Zeilenabstand, der dem üblichen Abstand bei der
Abschrift entspricht. In diesem Vers ist einzig die
Ergänzung für Versvariante d nachträglich (per
Schweifklammer) eingefügt worden. Dieser Befund ist
ein weiterer Beleg für die Annahme (neben
Schriftmerkmalen und Federwechsel), dass Kleist zwei
Drittel der Seite 84 zunächst frei gelassen hatte, um
die Verse 1561 bis 1576 nachzutragen.
Er ſagt, er ſpräche
niemals bei euch ein?
Er ſagt, er ſpräche
nicht mehr bei euch ein?
Er ſagt, nur ſelten
ſpräch’ er bei euch ein?
Er ſagt, er
ſpräche nicht mehr bei euch ein?
Er ſagt, er ſpraͤche
nicht mehr bei euch ein?
Frau Marthe.
Hm! Gnädger Herr,
verdorben? Das juſt nicht.
Hm! Gnaͤd’ger Herr,
verdorben? Das juſt nicht.
Ich denk’ er nennt mein
guter Freund ſich noch.
Ich denk er nennt mein
guter Freund ſich noch.
Doch daß ich oft in meinem Hauſ’ ihn
ſähe,
Das vom Herrn Vetter kann ich juſt nicht
rühmen.
Neun Wochen ſind’s, daß ich
er’s zuletzt betrat,
Und auch nur da noch im Vorübergehn.
Walter
Wie ſagt ihr?
Frau Marthe
Was?
Walter.
Neun Wochen wären’s —?
Frau Marthe.
Neun
Neun,
Ja — Donnerſtag ſind’s zehn. Er bat ſich
Saamen
Bei mir, für Nelken und
Aurikeln aus.
Bei mir, von Nelken und
Aurikeln aus.
85.
Walter.
Und — Sonntags — wenn er auf das Vorwerk
geht —?
Frau Marthe.
Ja, da — da kuckt er mir
in’s Fenſter wohl,
Ja, da — da gukt er mir
in’s Fenſter wohl,
Und ſagt guten Tag zu mir
und meiner Tochter:
Und ſaget guten Tag zu
mir und meiner Tochter;
Da Doch dann ſo
geht er wieder ſeiner Wege.
Walter
/: für ſich :/
Hm! Sollt’ ich auch dem Manne
wohl —
Hm! Sollt ich auch dem
Manne wohl —
/: er ergr
trinkt :/
Ich glaubte,
Weil ihr die Jungfer Muhme dort
zuweilen
In eurer Wirthſchafft braucht, ſo würdet
ihr
Zum Dank die Mutter dann
und wann beſuchen.
Zu Dank die Mutter dann
und wann beſuchen.
Adam.
Wie ſo, geſtrenger Herr?
Walter.
Wie ſo? Ihr ſagtet,
Die Jungfer helfe euren Hühnern auf,
Die euch im Hof’
erkranken. Hat ſie nicht
Die euch im Hof
erkranken. Hat ſie nicht
Noch heut in dieſer Sach’ euch Rath
ertheilt?
Frau Marthe.
Ja, allerdings, geſtrenger Herr, das thut
ſie.
Vorgeſtern ſchickt’ er ihr ein krankes
Perlhuhn
In’s Haus, das ſchon den Tod im Leibe
hatte.
Vorm Jahre rettete ſie
ihm eEins
vom Pips,
Vorm Jahr rettete ſie
ihm eins vom Pips,
Und dies auch wird ſie mit der Nudel
heilen:
Jedoch zum Dank iſt er noch nicht
erſchienen.
Walter
/: verwirrt :/
— Schenkt ein, Herr Richter Adam, ſeid ſo
gut.
Schenkt gleich mir ein. Wir wollen Eins
noch trinken.
Adam.
Zu eurem Dienſt. Ihr macht mich glücklich.
Hier.
/: er ſchenkt ein :/
86.
Licht.
Walter.Von unbekannter Hand in
roter Tinte ›Licht.‹ gestrichen und ›Walter.‹ ergänzt.
Auch in E erfolgt Zuordnung zu Walter.
Auf euer Wohlergehn! — Der Richter
Adam,
Er wird früh oder ſpät ſchon
zu euch kom̄en.
Er wird ſchon zu
euch kom̄en.
Er wird früh
oder ſpät ſchon kom̄en.
Er wird fruͤh oder
ſpaͤt ſchon kommen.
Frau Marthe.Das ›M‹ in ›Marthe‹ fehlt
aufgrund von Papierverderbnis.
Meint ihr? Ich zweifle.
Könnt’ ich Nierſteiner,
ſolchen wie ihr trinket,
Koͤnnt’ ich
Nierſteiner, ſolchen, wie ihr trinkt,
Und wie mein ſeel’ger Mann, der
Caſtellan,
Wohl auch, von Zeit zu Zeit, im Keller
hatte,
Vorſetzen dem Herrn Vetter, wär’s was
Anders:
Doch ſo beſitz’ ich nichts, ich arme
Wittwe,
In meinem Hauſe, das ihn lockt.
Walter.
Und Um ſo viel beſſer.
Licht. Frau
Brigitte
/: mit einer Perücke in der
Hand :/
Die Mägde
/: treten auf :/
Licht.
Hier, Frau
Brigitt’! Herein!
Hier, Frau Brigitte,
herein.
Walter.
Iſt das die Frau, Herr Schreiber Licht?
Licht.
Das iſt die Frau Brigitte, Ew. Gnaden.
Walter.
Nun denn, ſo laßt die Sach’ uns jetzt
beſchließen.
Nehmt ab, ihr Mägde. Hier.
Die Mägde
/: mit Gläſern & ab
:/
Adam
/: während deſſen :/
Nun, Evchen, höre,
Dreh du mir deine Pille ordentlich,
Wie ſich’s gehört, ſo ſprech’ ich heute
Abend
Auf ein Gericht Karauſchen bei euch
ein.
Sie muß
dDem Luder muß ſie ganz jetzt die
dGurgel,
Sie muß
dem Luder ganz jetzt die Gurgel,
Dem Luder muß
ſie ganz jetzt die Gurgel,
Dem Luder muß ſie ganz
jetzt durch die Gurgel,
Iſt ſie zu groß, ſo mag’s den Tod dran
freſſen.
Walter
/: erblickt die Perücke
:/
Was bringt uns Frau Brigitte dort für
eine
Perücke?
87.
Licht.
Gnäd’ger Herr?
Walter.
Was jene Frau uns dort fürAufgrund eines
Papierschadens ist von ›für‹ nur das ›f‹ zu erkennen.
Der Papierschaden ist möglicherweise ausgelöst durch
abgetrennten roten Siegellack, der an zwei Stellen
nachzuweisen ist. Es ist nicht bekannt, was hier
möglicherweise angesiegelt war. eine
Perücke bringt?
Licht.
Hm!
Walter.
Was?
Licht.
Verzeiht —
Walter.
Werd’ ich’s erfahren?
Werd ich’s
erfahren?
Licht.
Wenn Ew. Gnaden gütigſt
Die Frau, durch den Herrn
Richter, fragen wollen,
Die Frau, durch den
Herrn Richter fragen wollen,
So wird, wem die Perücke angehört,
Sich, und das Weitre,
zweifl’ ich nicht, ergeben.
Sich, und das Weitre,
zweifl’ ich nicht ergeben.
Walter.
— Ich will nicht
nicht wiſſen, wem ſie angehört.
Wie kam die Frau dazu? Wo fand ſie ſie?
Licht.
Die Frau fand die Perücke im Spalier
Bei Frau Margrethe Rull. Sie hieng
geſpießt,
Gleich einem Neſt, im Kreuzgeflecht des
Weinſtocks,
Dicht unterm Fenſter, wo die Jungfer
ſchläft.
Walter Frau Marthe.
Was? Bei mir? Im Spalier?
Walter
/: heimlich :/
Herr Richter Adam,
Habt ihr mir etwas zu vertraun,
So bitt’ ich, um die Ehre des
Gerichtes,
Ihr ſeid ſo gut, und ſagt mir’s an.
Habt ihr’s mit Richter Adam hier
verdorben?
Er S ſagt, er ſpräche niemalsnicht mehr
Er ſagt, nur ſelten ſpräch’ er
er ſpräche nicht
mehr
bei euch ein?Während
Kleist nach der Abschrift seine Korrekturen (bis auf
kurze Sofortkorrekturen) zwischen die Zeilen schreiben
muss, in der Regel in kleinerer Schrift, korrigiert er
hier den Vers 1567 mehrfach und über zwei Zeilen
direkt während der Niederschrift, erkennbar aus dem
Zeilenabstand, der dem üblichen Abstand bei der
Abschrift entspricht. In diesem Vers ist einzig die
Ergänzung für Versvariante d nachträglich (per
Schweifklammer) eingefügt worden. Dieser Befund ist
ein weiterer Beleg für die Annahme (neben
Schriftmerkmalen und Federwechsel), dass Kleist zwei
Drittel der Seite 84 zunächst frei gelassen hatte, um
die Verse 1561 bis 1576 nachzutragen.
Er ſagt, er ſpräche
niemals bei euch ein?
Er ſagt, er ſpräche
nicht mehr bei euch ein?
Er ſagt, nur ſelten
ſpräch’ er bei euch ein?
Er ſagt, er
ſpräche nicht mehr bei euch ein?
Er ſagt, er ſpraͤche
nicht mehr bei euch ein?
Frau Marthe.
Hm! Gnädger Herr,
verdorben? Das juſt nicht.
Hm! Gnaͤd’ger Herr,
verdorben? Das juſt nicht.
Ich denk’ er nennt mein
guter Freund ſich noch.
Ich denk er nennt mein
guter Freund ſich noch.
Doch daß ich oft in meinem Hauſ’ ihn
ſähe,
Das vom Herrn Vetter kann ich juſt nicht
rühmen.
Neun Wochen ſind’s, daß ich
er’s zuletzt betrat,
Und auch nur da noch im Vorübergehn.
Walter
Wie ſagt ihr?
Frau Marthe
Was?
Walter.
Neun Wochen wären’s —?
Frau Marthe.
Neun
Neun,
Ja — Donnerſtag ſind’s zehn. Er bat ſich
Saamen
Bei mir, für Nelken und
Aurikeln aus.
Bei mir, von Nelken und
Aurikeln aus.
85.
Walter.
Und — Sonntags — wenn er auf das Vorwerk
geht —?
Frau Marthe.
Ja, da — da kuckt er mir
in’s Fenſter wohl,
Ja, da — da gukt er mir
in’s Fenſter wohl,
Und ſagt guten Tag zu mir
und meiner Tochter:
Und ſaget guten Tag zu
mir und meiner Tochter;
Da Doch dann ſo
geht er wieder ſeiner Wege.
Walter
/: für ſich :/
Hm! Sollt’ ich auch dem Manne
wohl —
Hm! Sollt ich auch dem
Manne wohl —
/: er ergr
trinkt :/
Ich glaubte,
Weil ihr die Jungfer Muhme dort
zuweilen
In eurer Wirthſchafft braucht, ſo würdet
ihr
Zum Dank die Mutter dann
und wann beſuchen.
Zu Dank die Mutter dann
und wann beſuchen.
Adam.
Wie ſo, geſtrenger Herr?
Walter.
Wie ſo? Ihr ſagtet,
Die Jungfer helfe euren Hühnern auf,
Die euch im Hof’
erkranken. Hat ſie nicht
Die euch im Hof
erkranken. Hat ſie nicht
Noch heut in dieſer Sach’ euch Rath
ertheilt?
Frau Marthe.
Ja, allerdings, geſtrenger Herr, das thut
ſie.
Vorgeſtern ſchickt’ er ihr ein krankes
Perlhuhn
In’s Haus, das ſchon den Tod im Leibe
hatte.
Vorm Jahre rettete ſie
ihm eEins
vom Pips,
Vorm Jahr rettete ſie
ihm eins vom Pips,
Und dies auch wird ſie mit der Nudel
heilen:
Jedoch zum Dank iſt er noch nicht
erſchienen.
Walter
/: verwirrt :/
— Schenkt ein, Herr Richter Adam, ſeid ſo
gut.
Schenkt gleich mir ein. Wir wollen Eins
noch trinken.
Adam.
Zu eurem Dienſt. Ihr macht mich glücklich.
Hier.
/: er ſchenkt ein :/
86.
Licht.
Walter.Von unbekannter Hand in
roter Tinte ›Licht.‹ gestrichen und ›Walter.‹ ergänzt.
Auch in E erfolgt Zuordnung zu Walter.
Auf euer Wohlergehn! — Der Richter
Adam,
Er wird früh oder ſpät ſchon
zu euch kom̄en.
Er wird ſchon zu
euch kom̄en.
Er wird früh
oder ſpät ſchon kom̄en.
Er wird fruͤh oder
ſpaͤt ſchon kommen.
Frau Marthe.Das ›M‹ in ›Marthe‹ fehlt
aufgrund von Papierverderbnis.
Meint ihr? Ich zweifle.
Könnt’ ich Nierſteiner,
ſolchen wie ihr trinket,
Koͤnnt’ ich
Nierſteiner, ſolchen, wie ihr trinkt,
Und wie mein ſeel’ger Mann, der
Caſtellan,
Wohl auch, von Zeit zu Zeit, im Keller
hatte,
Vorſetzen dem Herrn Vetter, wär’s was
Anders:
Doch ſo beſitz’ ich nichts, ich arme
Wittwe,
In meinem Hauſe, das ihn lockt.
Walter.
Und Um ſo viel beſſer.
Licht. Frau
Brigitte
/: mit einer Perücke in der
Hand :/
Die Mägde
/: treten auf :/
Licht.
Hier, Frau
Brigitt’! Herein!
Hier, Frau Brigitte,
herein.
Walter.
Iſt das die Frau, Herr Schreiber Licht?
Licht.
Das iſt die Frau Brigitte, Ew. Gnaden.
Walter.
Nun denn, ſo laßt die Sach’ uns jetzt
beſchließen.
Nehmt ab, ihr Mägde. Hier.
Die Mägde
/: mit Gläſern & ab
:/
Adam
/: während deſſen :/
Nun, Evchen, höre,
Dreh du mir deine Pille ordentlich,
Wie ſich’s gehört, ſo ſprech’ ich heute
Abend
Auf ein Gericht Karauſchen bei euch
ein.
Sie muß
dDem Luder muß ſie ganz jetzt die
dGurgel,
Sie muß
dem Luder ganz jetzt die Gurgel,
Dem Luder muß
ſie ganz jetzt die Gurgel,
Dem Luder muß ſie ganz
jetzt durch die Gurgel,
Iſt ſie zu groß, ſo mag’s den Tod dran
freſſen.
Walter
/: erblickt die Perücke
:/
Was bringt uns Frau Brigitte dort für
eine
Perücke?
87.
Licht.
Gnäd’ger Herr?
Walter.
Was jene Frau uns dort fürAufgrund eines
Papierschadens ist von ›für‹ nur das ›f‹ zu erkennen.
Der Papierschaden ist möglicherweise ausgelöst durch
abgetrennten roten Siegellack, der an zwei Stellen
nachzuweisen ist. Es ist nicht bekannt, was hier
möglicherweise angesiegelt war. eine
Perücke bringt?
Licht.
Hm!
Walter.
Was?
Licht.
Verzeiht —
Walter.
Werd’ ich’s erfahren?
Werd ich’s
erfahren?
Licht.
Wenn Ew. Gnaden gütigſt
Die Frau, durch den Herrn
Richter, fragen wollen,
Die Frau, durch den
Herrn Richter fragen wollen,
So wird, wem die Perücke angehört,
Sich, und das Weitre,
zweifl’ ich nicht, ergeben.
Sich, und das Weitre,
zweifl’ ich nicht ergeben.
Walter.
— Ich will nicht
nicht wiſſen, wem ſie angehört.
Wie kam die Frau dazu? Wo fand ſie ſie?
Licht.
Die Frau fand die Perücke im Spalier
Bei Frau Margrethe Rull. Sie hieng
geſpießt,
Gleich einem Neſt, im Kreuzgeflecht des
Weinſtocks,
Dicht unterm Fenſter, wo die Jungfer
ſchläft.
Walter Frau Marthe.
Was? Bei mir? Im Spalier?
Walter
/: heimlich :/
Herr Richter Adam,
Habt ihr mir etwas zu vertraun,
So bitt’ ich, um die Ehre des
Gerichtes,
Ihr ſeid ſo gut, und ſagt mir’s an.
[…
… …]
Ab hier
fehlen im Autograph die Seiten 88 bis 123. Die Verszählung
orientiert sich im folgenden an der Zählung der Edition
von E in dieser Edition, die identisch ist mit den
Verszählungen der Editionen von Sembdner und
DKV.
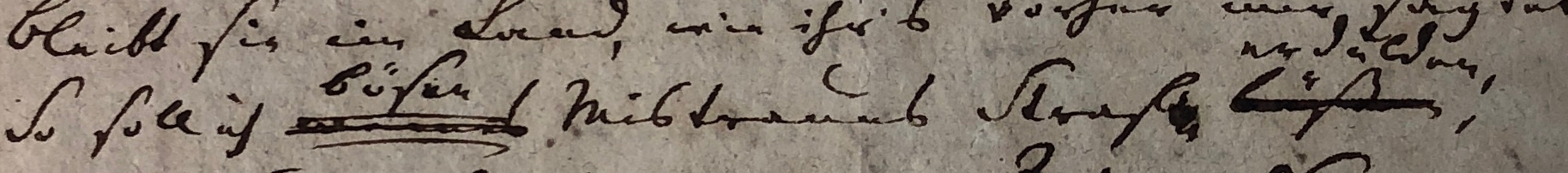 So ſoll ich meines
böſen Mistrauns
Strafe’
büßen,
erdulden,
So ſoll ich meines
Mistrauns Strafe
büßen,
So ſoll ich
böſen Mistrauns Straf’
erdulden,
So ſoll ich boͤſen
Mißtrauns Straf’ erdulden,
Und Beutel, ſamt, wie billig, Intereſſen
—
Ru /: ſie ſieht Ruprecht an
:/
Ruprecht.
Pfui! S’iſt nicht wahr! Es iſt kein wahres
Wort!
Walter.
Was iſt nicht wahr?
Eve.
Da nehmt ihn! Nehmt ihn! Nehmt
ihn!
Walter
Wie?
Eve.
Nehmt, ich
bitt’ euch, gnädger Herr, nehmt, nehmt ihn!
Nehmt, ich bitt’ euch,
gnaͤd’ger Herr, nehmt, nehmt ihn!
Walter.
Den Beutel?
Eve.
O Herr Gott!
128.
Walter.
Das Geld? Warum das?
Vollwichtig, neugeprägte
Gulden ſind’s,
Vollwichtig
neugepraͤgte Gulden ſind’s.
Sieh her, das Antlitz hier des
Spanierkönigs,:
Sieh her, das Antlitz hier des
Spanierkönigs,
Sieh her, das Antlitz
hier des Spanierkönigs:
Sieh her, das Antlitz
hier des Spanierkoͤnigs:
Meinſt du, daß dich der König wird
betrügen?
Eve.
O lieber, guter, edler Herr, verzeiht mir.
—
— O der verwünſchte
Richter!
Ruprecht.
Ei, der Schurke!
Walter.
So glaubſt du jetzt, daß ich dir Wahrheit
gab?
Eve.
Ob ihr mir Wahrheit gabt? O
ſcharfgeprägte,
Und Gottes leuchtend
Antlitz drauf. O Jeſus!
Und Gottes leuchtend Antlitz drauf. O Himmel!
Daß ich nicht ſolche Münze mehr
erkenne!
Walter.
Hör’, jetzt geb’ ich dir einen Kuß. Darf
ich?
Ruprecht.
Und einen tüchtigen. So. Das iſt brav.
Walter.
Du alſo
Du alſo gehſt nach Utrecht?
Ruprecht.
Ich geh nach
Utrecht,
Nach Utrecht geh’ ich,
Und ſtehe tapfer auf den
Wällen Schildwach.
Hier endet
der in E gedruckte ›Variant‹ mit dem Abschlußvers: ›Und
wenn ich das gethan, u.ſ.w....... iſt Eve mein!‹. Die
folgenden 32 Verse bis Vers 2413 finden sich
ausschließlich im Autograph. Sie haben im Erstdruck und
Variant keine Entsprechungen.
Und ſteh ein Jahrlang auf den Waͤllen Schildwach,
So ſoll ich meines
böſen Mistrauns
Strafe’
büßen,
erdulden,
So ſoll ich meines
Mistrauns Strafe
büßen,
So ſoll ich
böſen Mistrauns Straf’
erdulden,
So ſoll ich boͤſen
Mißtrauns Straf’ erdulden,
Und Beutel, ſamt, wie billig, Intereſſen
—
Ru /: ſie ſieht Ruprecht an
:/
Ruprecht.
Pfui! S’iſt nicht wahr! Es iſt kein wahres
Wort!
Walter.
Was iſt nicht wahr?
Eve.
Da nehmt ihn! Nehmt ihn! Nehmt
ihn!
Walter
Wie?
Eve.
Nehmt, ich
bitt’ euch, gnädger Herr, nehmt, nehmt ihn!
Nehmt, ich bitt’ euch,
gnaͤd’ger Herr, nehmt, nehmt ihn!
Walter.
Den Beutel?
Eve.
O Herr Gott!
128.
Walter.
Das Geld? Warum das?
Vollwichtig, neugeprägte
Gulden ſind’s,
Vollwichtig
neugepraͤgte Gulden ſind’s.
Sieh her, das Antlitz hier des
Spanierkönigs,:
Sieh her, das Antlitz hier des
Spanierkönigs,
Sieh her, das Antlitz
hier des Spanierkönigs:
Sieh her, das Antlitz
hier des Spanierkoͤnigs:
Meinſt du, daß dich der König wird
betrügen?
Eve.
O lieber, guter, edler Herr, verzeiht mir.
—
— O der verwünſchte
Richter!
Ruprecht.
Ei, der Schurke!
Walter.
So glaubſt du jetzt, daß ich dir Wahrheit
gab?
Eve.
Ob ihr mir Wahrheit gabt? O
ſcharfgeprägte,
Und Gottes leuchtend
Antlitz drauf. O Jeſus!
Und Gottes leuchtend Antlitz drauf. O Himmel!
Daß ich nicht ſolche Münze mehr
erkenne!
Walter.
Hör’, jetzt geb’ ich dir einen Kuß. Darf
ich?
Ruprecht.
Und einen tüchtigen. So. Das iſt brav.
Walter.
Du alſo
Du alſo gehſt nach Utrecht?
Ruprecht.
Ich geh nach
Utrecht,
Nach Utrecht geh’ ich,
Und ſtehe tapfer auf den
Wällen Schildwach.
Hier endet
der in E gedruckte ›Variant‹ mit dem Abschlußvers: ›Und
wenn ich das gethan, u.ſ.w....... iſt Eve mein!‹. Die
folgenden 32 Verse bis Vers 2413 finden sich
ausschließlich im Autograph. Sie haben im Erstdruck und
Variant keine Entsprechungen.
Und ſteh ein Jahrlang auf den Waͤllen Schildwach,Und wenn ich das gethan, u.ſ.w....... iſt Eve mein! Eve. Und ich geh einen Sonntag um den andern, Und ſuch’ ihn auf den Wällen auf, und bring’ ihm Im kühlen Topf von friſchgekrenterkernter Butter,: Im kühlen Topf von friſchgekernter Butter, Im kühlen Topf von friſchgekernter Butter: [ ] Bis ich ihn einſt mit mir zurückenehme. Ruprecht. Walter. Und ich empfehle meinem Bruder ihn, Dem Hauptmann von der Landmiliz, der ihn Aufnimt, wollt wollt ihr, in ſeine Compagnie? 129. Eve. Das wollt ihr thun? Walter. Das werd’ ich gleich beſorgen. Eve. O guter Herr! O wie beglückt ihr uns. Walter. Und iſt ſein kurzes Dienſtjahr nun verfloßen, So kom̄’ ich Pfingſten, die nächſtfolgenden, Und melde mich als Hochzeitsgaſt: ihr werdet Das Pfingſtfeſt über’s Jahr doch nicht verſäumen? Eve. Nein, mit den nächſten Mai’n blüht unſer Glück. Walter Ihr ſeid damit zufrieden doch, Frau Marthe? Ruprecht. Ihr zürnt mir jetzo nicht mehr, Mutter — nicht? Frau Marthe. Warum ſoll ich zürnen, dum̄er Jung’? Haſt du Den Krug herunter vom Geſims geſchmiſſen? Walter. Nun alſo. — Er auch, Vater. Veit. Von Herzen gern. Walter. — Nun mögt’ ich wiſſen, wo der Richter blieb? Licht. Der Richter? Hm! Ich weiß nicht, Ew. Gnaden, — Der Richter? Hm! Ich weiß nicht, Ew. Gnaden, Der Richter? Hm! Ich weiß nicht, Ew. Gnaden — [ ] Ich ſteh hier ſchon geraume Zeit am Fenſter, Und einen Flüchtling ſeh’ ich, ſchwarz ornirt, Das aufgepflügte Winterfeld durchſtampfen, Als ob er Rad und Galgen flöhe. Walter Wo? 130. Licht. Wollt ihr gefälligſt euch hierher bemühen — /: ſie treten alle an’s Fenſter :/ Walter Iſt das der Richter? Licht. Ja, wer ſcharfe Augen hätte — Ruprecht Der Henker hol’s! Licht Iſt er’s? Ruprecht So wahr ich lebe! Sieh, Ev’, ich bitte dich — Eve. Er iſt’s. Ruprecht’s. Er iſt’s! Ich ſeh’s an ſeinem hinkenden Gallop. Veit. Der dort den Fichtengrund heruntrabt, Der Richter? Frau Marthe. So wahr ich ehrlich bin. Seht nur, Wie die Perücke ihm den Rücken peitſcht. Wie die Peruͤcke ihm den Ruͤcken peitſcht!Dieser Vers ist identisch mit Vers 1959 in E am Ende des 12. Auftritts. Dort ist er mehreren Sprechern zugeordnet: › Mehrere. | Jetzt kommt er auf die Straße. Seht! ſeht! | Wie die Peruͤcke ihm den Ruͤcken peitſcht!‹. Die Verse 2415 bis Ende sind mit Ausnahme der mitgeteilten Abweichungen identisch mit den Versen 1960 bis 1974 in E. Walter. Geſchwind, Herr Schreiber, fort! Holt ihn zurück! Daß er nicht Übel rettend ärger mache. Von ſeinem Amt zwar iſt er ſuspendirt, Und euch beſtell’ ich ich, bis auf weitere Verfügung, hier im Ort es zu verwalten; So Doch ſind die Caſſen richtig, wie ich hoffe, So wird er wohl auf irgend einem Platze Zur Deſertion ihn zwingen will ich nicht. Noch zu erhalten ſein. Fort, holt ihn wieder. Fort! Thut mir den Gefallen, holt ihn wieder! 131. Licht /: ab :/Hier Beginn von ›Letzter Auftritt.‹ in E. Frau Marthe Mit Sagt doch, geſtrenger Herr, wo find’ ich auch Den Sitz in Utrecht der Regierung? Walter. Weshalb, Frau Marthe? Frau Marthe. Hm! Weshalb? Ich weiß nicht — Soll hier dem Kruge nicht ſein Recht geſchehn? Walter. Verzeiht mir. Allerdings. Am großen Markt. Verzeiht mir! Allerdings. Am großen Markt, Und Dienſtag iſt, und Freitag, Seſſion. Und Dienſtag iſt und Freitag Seſſion. Frau Marthe. Gut, auf die Woche ſtell’ ich dort mich ein. Gut! Auf die Woche ſtell’ ich dort mich ein. (Alle ab). Ende.